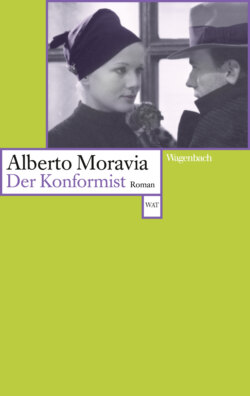Читать книгу Der Konformist - Alberto Moravia - Страница 3
Vorspiel Erstes Kapitel
ОглавлениеAls Marcello noch ein Kind war, erging es ihm wie einer Elster: Alle Dinge um ihn herum bezauberten ihn. Vielleicht deshalb, weil seine Eltern – mehr aus Gleichgültigkeit denn Strenge – nie daran gedacht hatten, seinen Besitztrieb zu befriedigen. Vielleicht aber verbargen sich hinter dieser Habgier andere tiefere und dunkle Instinkte. Jedenfalls wurde er unausgesetzt von dem wilden Wunsch nach den verschiedensten Gegenständen befallen. Wertlose Dinge, wie ein Bleistift mit Gummikappe, ein illustriertes Buch, eine Schleuder, ein Lineal, ein tragbares Tintenfaß aus Ebanit, erweckten eine intensive, unvernünftige Sehnsucht in ihm. Sobald ihm das begehrte Objekt dann gehörte, erfüllte ihn ein jähes, verzaubertes, maßloses Vergnügen.
Marcello hatte daheim ein Zimmer ganz für sich allein, in dem er schlief und lernte. Alle Dinge, die auf seinem Tisch lagen oder in den Schubfächern eingeschlossen waren, besaßen für ihn den Zauber von heiligen oder geweihten Gegenständen – je nachdem, ob er schon vor längerem oder erst vor kurzem in ihren Besitz gelangt war. Sie glichen also nicht einfach den anderen Dingen im Haus, sondern stellten Bruchstücke einer bereits gemachten oder noch zu bestehenden Erfahrung dar und waren darum von Leidenschaft und Dunkel umgeben. Marcello war sich auf seine Art und Weise über den eigentümlichen Charakter seines Besitzes im klaren, und während er einen unauslöschlichen Genuß daraus zog, litt er gleichzeitig darunter wie unter einer Schuld, die sich ständig erneuerte und ihm nicht einmal Zeit zur Reue ließ.
Von allen Dingen, die er begehrte, zogen ihn Waffen am stärksten an – vielleicht deshalb, weil er in ihnen etwas Verbotenes sah. Aber nicht die harmlosen Waffen, mit denen Kinder gerne spielen, faszinierten ihn, die Blechgewehre, die Knallpistolen, die Holzdolche. Ihn faszinierten die wirklichen Waffen, bei denen die Vorstellung von Drohung und Lebensgefahr nicht nur eine Illusion war, sondern die erste und letzte Ursache ihrer Existenz. Mit den Kinderpistolen spielte man »Tod«, ohne die Möglichkeit, ihn wirklich hervorzurufen. Mit den Pistolen der Erwachsenen jedoch konnte man den Tod tatsächlich heraufbeschwören, und nur weise Zurückhaltung vermochte dies zu verhindern. Ein paarmal hatte Marcello richtige Waffen in der Hand gehabt: ein Jagdgewehr und den alten Revolver seines Vaters, den ihm dieser in der Kassette gezeigt hatte. Bei jeder Berührung hatte ihn ein Schauder erfaßt, als hätte seine Hand im Griff der Waffe endlich die natürliche Verlängerung gefunden.
Unter den Kindern der Nachbarschaft hatte Marcello zahlreiche Freunde, und bald war ihm klar, daß seine Freude an Waffen tiefere und dunklere Gründe hatte als die kindlichen Kriegsspiele der anderen. Die spielten Soldaten und taten so, als seien sie wild und grausam. In Wirklichkeit jedoch ging es ihnen nur um das Spiel, und sie führten sich wild auf ohne inneren Anteil. Bei Marcello verhielt es sich gerade umgekehrt: Seine Grausamkeit und Wut suchten im Soldatenspiel einen Ausdruck. Und wenn sich dazu keine Möglichkeit bot, widmete er sich anderen Belustigungen, die immer mit Tod und Zerstörung verknüpft waren.
Zu jener Zeit war Marcello grausam, ohne Reue und ohne Scham. Dies schien ihm ganz natürlich, denn aus der Grausamkeit erwuchsen ihm die einzigen Freuden, die ihm nicht schal vorkamen. Außerdem war seine Grausamkeit noch so kindisch, daß sie weder bei ihm selbst noch bei den anderen Verdacht erweckte. So geschah ihm etwa folgendes: Während der heißen Tageszeit, am Anfang des Sommers, ging er in den Garten hinunter. Es war ein schmaler, aber dichter Garten mit vielen Pflanzen und Bäumen, um die sich seit Jahren niemand gekümmert hatte. Marcello war mit einer dünnen, biegsamen Gerte bewaffnet, die er auf dem Dachboden aus einem alten Teppichklopfer gezogen hatte. Eine Weile schlenderte er auf den Kieswegen unter den glühenden Sonnenstrahlen und dem Spiel der Baumschatten umher und betrachtete die Blumen. Er spürte, daß seine Augen leuchteten, daß sich sein Körper einem Gefühl des Wohlbehagens erschloß, als ginge er ein in die ganze Lebenskraft des sprießenden, lichtübergänzten Gartens. Er fühlte sich glücklich. Doch es war ein angriffslüsternes, grausames Glück, das sich am Unglück anderer messen wollte.
Da sah er inmitten eines Beetes eine schöne Gruppe weiß- und gelbblühender Margeriten und eine Tulpe mit rotem Kelch auf grünem Stengel. Sofort vollführte er einen Hieb mit seiner Gerte, ließ diese gleich einem Degen durch die Luft pfeifen. Die Gerte schnitt den Kelch und einige Blätter glatt ab, die in der Nähe zu Boden fielen … und ließ die geköpften Stengel zurück. Diese Beschäftigung verschaffte Marcello eine Verdoppelung seiner Lebenslust und jenen tiefen Genuß, den die Entfaltung einer zu lange zurückgehaltenen Energie bereitet. Überdies empfand er irgendein Gerechtigkeits- und Machtgefühl: als hätten jene Pflanzen eine Schuld auf sich geladen und wären nun von ihm dafür bestraft worden. Und er war sich bewußt, daß es eben in seiner Macht gelegen hatte, sie zu bestrafen.
Dabei war es ihm nicht ganz unbekannt, wie sehr solcherlei Zeitvertreib verboten und unstatthaft war. Fast gegen seinen Willen sah er sich dann und wann nach der Villa um. Er hatte Angst, seine Mutter könnte ihn vom Salonfenster oder die Köchin vom Küchenfenster aus beobachten. Er fürchtete nicht so sehr einen Vorwurf als vielmehr – und dessen war er sich bewußt – die Gegenwart von Zeugen bei Handlungen, die ihm selbst abnorm und auf geheimnisvolle Weise schuldverstrickt vorkamen.
Der Übergang von den Pflanzen zu den Tieren verlief unmerklich. Zwar empfand Marcello eine noch deutlichere und tiefere Freude, als er nicht mehr die Blumen köpfte, sondern irgendwelchen Tieren Gewalt antat; aber er hätte nicht zu sagen vermocht, wann er sich dieser Freude zuerst bewußt geworden war. Vielleicht hatte ihn nur ein Zufall auf diesen Weg gedrängt, ein Gertenhieb, der anstatt einer Pflanze den Rücken einer schlafenden Eidechse traf. Aber es konnte auch sein, daß eine leichte Übersättigung, ein Überdruß ihn dahin getrieben hatte, sich nach neuen Opfern für seine Grausamkeit umzusehen.
Jedenfalls hatte sich Marcello an einem stillen Nachmittag, während alle im Hause schliefen, von Reue und Scham vernichtet, plötzlich vor einem Eidechsengemetzel gefunden: Es waren sechs Tierchen, die er teils auf Ästen, teils auf Steinen ausfindig gemacht hatte. Gerade als sie durch seine schweigsame Gegenwart mißtrauisch geworden waren und die Flucht ergreifen wollten, wurden sie von ihm mit Gertenhieben getötet. Was ihn wirklich zu dieser Tat veranlaßt hatte, war ihm nicht klar. Oder vielmehr: Er wollte sich darüber keine Rechenschaft ablegen. Jetzt war es nun einmal geschehen. Nichts anderes gab es mehr als die brennende, unreine Sonne auf den blutigen, schmutzigen Leibern der toten Eidechsen. Sie lagen auf dem zementierten Gehsteig, und er stand daneben, die Gerte in der Faust. Noch spürte er auf seinem Gesicht und in seinem Körper die Erregung, die ihn während des Gemetzels befallen hatte, aber sie war nicht mehr wohlig-glühend wie kurz zuvor, sondern nahm langsam die Farbe von Scham und Reue an. Auch war ihm bewußt, daß dieses Mal zu dem ihm schon bekannten Gefühl der Grausamkeit und Macht eine neue, unerklärliche körperliche Lust getreten war. Ihn befiel eine wirre Angst. Er glaubte einen völlig abnormen Charakter zu besitzen, dessen er sich schämen mußte, der ihn für immer von der Gesellschaft gleichaltriger Knaben trennen würde, den es geheimzuhalten galt, wenn er sich nicht auch noch vor den anderen bloßstellen wollte. Kein Zweifel, er war nicht so wie die Jungen seines Alters. Die gaben sich weder gemeinsam noch einzeln einem ähnlichen Zeitvertreib hin. Und diese seine Andersartigkeit war endgültig: Die Eidechsen lebten nicht mehr, daran war nicht zu rütteln. Ihr Tod, den er mit seiner grausamen, wilden Tat heraufbeschworen hatte, war die Gesamtheit aller von ihm begangenen schlechten Handlungen, war also er selbst. So wie er früher die Gesamtheit anderer, völlig harmloser und normaler Handlungen gewesen war.
Noch am selben Tage wollte sich Marcello seine Abnormität bestätigen lassen, er wollte über seine neue und schmerzliche Entdeckung mit seinem kleinen Freund Roberto sprechen, der in der Villa nebenan wohnte. Immer wenn es dämmerte, pflegte Roberto nach der Erledigung seiner Schularbeiten in den Garten zu gehen. Dort, oder im Garten Marcellos, spielten die beiden Jungen dann im Einverständnis mit den Eltern bis zur Abendessenszeit. Nun wartete Marcello den ganzen stillen Nachmittag auf diese Stunden. Die Eltern waren ausgegangen. Im Haus befand sich nur die Köchin, und Marcello hörte sie unten in der Küche leise singen. Meist lernte oder spielte er nachmittags allein in seinem Zimmer. Heute jedoch lag er von Ungeduld gepeinigt auf dem Bett. Weder ein Spiel noch eine Arbeit vermochten ihn zu fesseln. Zwar war ihm das Nichtstun unerträglich und brachte ihn fast zur Raserei, aber es war ihm auch unmöglich, sich mit irgend etwas zu beschäftigen. Der Schrecken über seine Entdeckung lähmte ihn, und zugleich hoffte er ungeduldig, daß die Begegnung mit Roberto diese Lähmung lösen werde. Wenn Roberto ihm sagte, daß auch er Eidechsen tötete, daß es auch ihm Freude bereitete, zu töten, daß er daran nichts Schlechtes finde, dann – so wähnte er – würde das Gefühl des Abnormen wieder schwinden. Er würde diesen Eidechsenmord gleichgültig als einen belanglosen Zwischenfall ohne Folgen hinnehmen können. Warum er gerade auf Robertos Urteil so großen Wert legte, wußte er nicht. Unklar dachte er: Wenn auch Roberto so etwas tut, auf die gleiche Art und mit den gleichen Gefühlen, dann tun es sicher alle. Und was alle tun, ist doch wohl normal, das heißt in Ordnung. Er glaubte mit Bestimmtheit zu wissen, daß von Robertos Antwort seine eigene Seelenruhe abhing.
Ängstlich und mit dem Wunsch, daß alles sich so abspielen werde, wie er es hoffte, erwartete er voll Ungeduld die Dämmerung. Als schließlich aus dem Garten ein langer Pfiff herauftönte, war er gerade drauf und dran einzuschlafen. Dieser Pfiff war das vereinbarte Zeichen, mit dem Roberto sein Kommen anmeldete. Marcello erhob sich von seinem Bett. Ohne das Licht anzuzünden, verließ er in der Dämmerung das Zimmer und ging die Treppe hinab in den Garten.
In der trüben Beleuchtung dieser späten Stunde standen die Bäume regungslos da, und unter ihren Ästen lagen bereits die nächtlichen Schatten. Es roch nach Blumen, Staub und nach dem von der Nachmittagssonne erhitzten Boden. Die Luft schien dicht und bewegungslos. Das Gitter, das den Garten Marcellos von dem Robertos trennte, verschwand völlig unter dem vollen, tiefen Blätterwerk des Efeus, der eine Art grüner Mauer bildete. Marcello ging geradewegs auf eine Ecke im Hintergrund des Gartens zu, dorthin, wo Efeu und Schatten am dunkelsten waren. Er stieg auf einen großen Stein und schob mit einer einzigen entschlossenen Handbewegung einen Teil der Ranken beiseite. Er kannte diese Art Guckloch im Blätterwerk, und es kam seinem Bedürfnis nach Geheimnis und Abenteuer entgegen. Der beiseite geschobene Efeu brachte die Stange des Gartengitters zum Vorschein und dahinter das feine, bleiche Gesicht und die blonden Haare Robertos. Marcello hob sich auf die Zehenspitzen und fragte seinen Freund:
»Hat uns niemand gesehen?«
Das war die stehende Eröffnungsformel ihres Spieles.
Roberto antwortete, als sage er eine Lektion her: »Nein. Niemand …« Und dann, nach einem Augenblick: »Hast du gelernt?« Er sprach im Flüsterton, was gleichfalls zum Ritual gehörte.
Marcello flüsterte zurück: »Nein, heute habe ich nicht gelernt … Ich hatte keine Lust. Ich werde der Lehrerin sagen, daß ich mich nicht wohl gefühlt habe.«
»Ich hab schon den ganzen Aufsatz gemacht«, flüsterte Roberto. »Und eine von den Rechenaufgaben hab ich auch fertig. Die zweite muß ich noch machen. Warum hast du denn nicht gelernt?«
Auf diese Frage hatte Marcello gewartet. »Ich habe nicht gelernt«, antwortete er, »weil ich auf Eidechsen Jagd gemacht habe.«
Er hoffte, Roberto würde antworten: »Ah, tatsächlich? Das tue ich auch manchmal.« Oder so etwas Ähnliches. Aber das Gesicht Robertos zeigte keine Spur von Verständnis oder wenigstens Neugier. So fügte Marcello mit einiger Anstrengung hinzu, wobei er sich auch bemühte, seine Verlegenheit zu verbergen: »Ich hab sie alle umgebracht.«
Roberto fragte vorsichtig: »Wie viele?«
»Im ganzen sieben«, antwortete Marcello. Und dann zwang er sich zu einer technisch-informativen Prahlerei: »Sie saßen auf den Ästen und Steinen … Ich habe gewartet, bis sie sich bewegten und sie so erwischt … mit einem einzigen Gertenschlag … mit einem Schlag für jede.« Befriedigt zeigte er Roberto die Gerte.
Er bemerkte, daß ihn sein Freund jetzt neugierig ansah, beinahe staunend.
»Warum hast du sie denn getötet?« fragte Roberto.
»So …« Marcello sprach nicht weiter. Fast hätte er gesagt: Weil es mir Freude machte. Schließlich fügte er hinzu: »Weil sie schädlich sind. Weißt du nicht, daß die Eidechsen schädlich sind?«
»Nein«, erwiderte Roberto, »Das habe ich nicht gewußt. Wieso schädlich?«
»Sie fressen die Trauben«, gab Marcello zurück. »Vergangenes Jahr, auf dem Land, haben sie alle Trauben an der Laube aufgefressen.«
»Aber hier gibt es doch gar keine Trauben?«
»Außerdem sind sie böse«, fuhr Marcello fort, ohne Robertos Einwand zu beachten. »Eine Eidechse ist, anstatt auszureißen, mit aufgerissenem Maul auf mich zugeschossen. Sie wollte mich angreifen. Wenn ich sie nicht rechtzeitig erwischt hätte …« Er schwieg. Dann fragte er in vertraulichem Ton: »Hast du nie welche umgebracht?«
Roberto schüttelte den Kopf und erwiderte: »Nein. Niemals.« Darauf senkte er den Blick und meinte mit betrübtem Gesicht: »Man sagt, daß man den Tieren nichts Böses tun soll.«
»Wer sagt das?«
»Meine Mutter.«
»Die Erwachsenen sagen viel«, bemerkte Marcello, seiner Sache immer weniger sicher. »Aber du mußt es einmal probieren, Dummkopf! Glaube mir – es ist lustig!«
»Nein, ich werde es nicht probieren.«
»Und warum nicht?«
»Weil es schlecht ist.«
Da ist also nichts zu machen, dachte Marcello enttäuscht. Er wurde jetzt zornig auf diesen Freund, der ihn ahnungslos auf seiner Abnormität festnagelte. Aber es gelang ihm, sich zu beherrschen, und er schlug Roberto vor: »Hör einmal, morgen mache ich wieder Jagd auf Eidechsen. Wenn du mitmachst, schenke ich dir das Paket Spielkarten.«
Marcello wußte, daß dieses Angebot für Roberto etwas Verlockendes hatte. Dieser hatte schon mehrmals den Wunsch nach dem Kartenspiel geäußert.
Und wirklich, Roberto antwortete jetzt, wie von einer plötzlichen Eingebung erleuchtet: »Ich komme mit dir. Aber unter einer Bedingung – wir fangen die Eidechsen lebend, sperren sie in eine Schachtel und lassen sie dann wieder frei. Und du gibst mir die Karten.«
»Nein, nein!« rief Marcello. »Der Hauptspaß besteht ja eben darin, sie mit so einer Gerte zu treffen! Ich möchte wetten, daß du das nicht fertigbringst …«
Der andere gab keine Antwort.
Marcello sprach weiter: »Also … komm morgen … Die Sache ist abgemacht. Du mußt dir nur noch eine Gerte beschaffen.«
»Nein«, sagte Roberto halsstarrig. »Ich komme nicht.«
»Warum denn nicht? Das Kartenspiel ist ganz neu!«
»Gib dir keine Mühe«, fuhr Roberto fort. »Ich töte keine Eidechsen. Nicht einmal, wenn …« Er zögerte und suchte in Gedanken nach einem Gegenstand von angemessenem Wert. »Nicht einmal, wenn du mir deine Pistole gibst.«
Marcello begriff endgültig, daß da nichts zu machen war. Plötzlich ließ er seiner Wut, die schon lange in ihm gesessen hatte, freien Lauf: »Du willst nicht, weil du ein Feigling bist«, sagte er. »Du hast ganz einfach Angst!«
»Angst? Wovor? Daß ich nicht lache!«
»Du hast Angst!« wiederholte Marcello wütend. »Ein Hase bist du! Ein richtiger Angsthase!« Unvermutet griff er mit der Hand durch das Gitter und packte den Freund beim Ohr. Roberto hatte abstehende rote Ohren, und es war nicht das erste Mal, daß Marcello ihn kniff. Noch nie aber hatte er es mit solcher Wut und mit einem so starken Wunsch getan, Roberto Schmerzen zuzufügen. »Gib zu, daß du ein Hase bist!«
»Nein! Laß mich!« jammerte der andere und wand sich. »Au! Au!«
»Gib zu, daß du ein Hase bist!«
»Nein! Laß mich!«
»Gib zu, daß du ein Hase bist!«
Das warme, verschwitzte Ohr schien in Marcellos Hand zu brennen. Tränen traten in die blauen Augen Robertos und er stammelte: »Na gut, von mir aus bin ich ein Hase …« Marcello ließ ihn sofort los. Roberto sprang vom Gitter weg und lief davon. »Ich bin kein Hase!« rief er dabei. »Während ich das sagte, dachte ich das Gegenteil! Ich hab dich reingelegt!« Seine schmerzlich-spöttische Stimme verlor sich in der Ferne, jenseits des Gebüsches, im Nachbargarten. Er war verschwunden.
Marcello blieb mit einem Gefühl tiefen Unbehagens zurück. Roberto hatte ihm die Solidarität verweigert und damit die Absolution. So war er in seiner Abnormität verblieben. Und weil er Roberto gezeigt hatte, wie wichtig ihm Solidarität gewesen war, hatte er sich zur Lüge und Gewalttätigkeit hinreißen lassen: So gesellten sich zur Scham und Reue über den Eidechsenmord neue Scham und neue Reue, weil er Roberto belogen, ihm nicht die wahren Gründe für das Gemetzel anvertraut, sich durch seinen Wutanfall verraten und schließlich Roberto beim Ohr gepackt hatte. Es war ihm unmöglich, alle diese Schuldgefühle abzuwälzen.
Während dieser unerfreulichen Betrachtungen erinnerte er sich immer wieder an den Eidechsenmord. Er hoffte im geheimen, plötzlich keine Reue mehr zu empfinden, die Angelegenheit als etwas Belangloses betrachten zu können. Zugleich wünschte er, daß die Eidechsen nie ums Leben gekommen wären. Aber bei diesem Wunsch mußte er feststellen, daß jenes gar nicht unangenehme und gerade darum so abscheuliche Gefühl körperlicher Erregung, das er bei der Jagd empfunden hatte, wieder zurückkam. Es war ein sehr starkes Gefühl, und deshalb zweifelte er daran, daß er in den kommenden Tagen der Versuchung eines erneuten Mordes würde widerstehen können. Das bestürzte ihn tief: Er war also nicht nur abnorm, sondern er konnte seine Abnormität nicht einmal beherrschen oder wenigstens eindämmen.
Marcello saß in diesem Augenblick in seinem Zimmer, an seinem Tisch, ein geöffnetes Buch vor sich, und erwartete das Abendessen. Nun sprang er auf, ging zum Bett, warf sich auf dem Bettvorleger in die Knie, wie er das beim Beten zu tun pflegte. Mit lauter Stimme, die Hände gefaltet und in einem Tonfall, den er für echt hielt, sagte er:
»Ich schwöre zu Gott, daß ich nie mehr Pflanzen, Blumen oder Eidechsen anrühren werde.«
Doch das Bedürfnis nach Absolution bestand weiter in ihm, jenes Bedürfnis, das ihn veranlaßt hatte, Robertos Spießgesellenschaft zu suchen. Nur hatte es sich jetzt in das Gegenteil verkehrt, nämlich in den Wunsch, verurteilt zu werden. Hätte sich Roberto mit ihm solidarisch erklärt, wäre ihm die Reue erspart geblieben. Doch Marcello allein besaß nicht genug Kraft, in seinem verwirrten Kopf Ordnung zu schaffen. Robertos Urteil war unannehmbar. Es war ja ein Junge wie Marcello – ausreichend als Komplice, doch unzureichend als Richter. Roberto hatte sich auf seine Mutter berufen, als er Marcellos Vorschlag ablehnte. Marcello dachte, daß auch er sich an seine Mutter wenden wolle. Nur sie konnte ihn absolvieren oder verdammen – jedenfalls seine Tat in irgendeine Ordnung bringen. Während er diesen Entschluß faßte, sah er seine Mutter als etwas Abstraktes vor sich, nämlich als die Idealmutter, die sie hätte sein sollen, aber nicht war. Im Grunde seiner Seele zweifelte er darum an einem guten Ausgang dieses Planes. Da er jedoch keine andere Mutter hatte, wurde schließlich das Bedürfnis, sich an sie zu wenden, stärker als alle Zweifel.
Nun wartete Marcello auf den Augenblick nach dem Zubettgehen, wenn seine Mutter in das Zimmer kommen und ihm »Gute Nacht« wünschen würde. Es war dies eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen er sie allein sehen konnte. Denn während der Mahlzeiten oder der seltenen Spaziergänge war stets auch sein Vater zugegen. Instinktiv hatte Marcello nur wenig Vertrauen zu seiner Mutter, aber er liebte sie. Vielleicht mehr noch: Er bewunderte sie in staunendem Entzücken, wie man eine ältere Schwester mit eigenartigen Gewohnheiten und launischer Wesensart bewundert. Marcellos Mutter hatte sehr jung geheiratet und war moralisch und körperlich immer ein kleines Mädchen geblieben. Da sie von zahlreichen gesellschaftlichen Verpflichtungen in Anspruch genommen wurde, kümmerte sie sich nur wenig um ihren Sohn, und es bestand deshalb zwischen den beiden keinerlei Vertraulichkeit. Andererseits hatte sie aber auch nie einen klaren Trennungsstrich zwischen ihrem Leben und dem seinen gezogen. So war Marcello in einem Tumult von überstürzten Auftritten und Abgängen, von probierten und weggeworfenen Kleidern und unablässig wechselnden Launen herangewachsen. Er war groß geworden beim Anhören endloser nichtiger Telefongespräche, lärmender Auftritte mit Schneiderinnen, Lieferanten und Dienstmädchen. Marcello durfte das Zimmer seiner Mutter betreten, wann er wollte, und den neugierigen, unbeachteten Zuschauer einer Intimität spielen, in der für ihn trotzdem keinerlei Platz war. Manchmal riß sich die Mutter wie in einem plötzlichen Reueanfall zusammen und beschloß, sich ihrem Sohn zu widmen. Dann nahm sie ihn mit zur Schneiderin oder Modistin. Dort mußte er stundenlang auf einem Schemel sitzen, während die Mutter Hüte und Kleider probierte. Und schließlich wünschte er unter diesen Umständen beinahe die gewohnte wirbelige Gleichgültigkeit zurück.
Heute abend merkte er sogleich, daß es die Mutter noch eiliger hatte als sonst. Ehe Marcello die Zeit gefunden hatte, seine Schüchternheit zu überwinden, wandte sie ihm schon wieder den Rücken und ging durch das dunkle Zimmer auf die angelehnte Tür zu. Aber Marcello hatte keine Lust, noch einen ganzen Tag auf den Richterspruch zu warten, dessen er bedurfte. Er richtete sich also schnell in seinem Bett auf und rief laut: »Mama!«
Er sah, wie sie sich beinahe ärgerlich auf der Schwelle umwandte. »Was ist denn, Marcello?« fragte sie und ging wieder auf das Bett zu. Jetzt stand sie nahe bei ihm, im Gegenlicht, weiß und zart in ihrem ausgeschnittenen schwarzen Kleid. Das feine, bleiche, von schwarzen Haaren umrahmte Gesicht lag zwar im Schatten, aber Marcello konnte doch Eile, Ungeduld und Unzufriedenheit auf ihren Zügen erkennen. Trotzdem ließ er sich von einem Impuls hinreißen und erklärte: »Mama, ich muß dir etwas sagen …«
»Ja, Marcello, aber mach es rasch. Ich muß gehen. Papa wartet schon.« Dabei nestelte sie mit beiden Händen an dem Verschluß ihrer Halskette.
Marcello wollte nun der Mutter von dem Eidechsenmord erzählen und sie fragen, ob er etwas Schlimmes getan habe. Doch die Eile der Mutter veranlaßte ihn, seinen Plan zu ändern, oder vielmehr den Satz abzuändern, den er in Gedanken bereits vorbereitet hatte. Eidechsen erschienen ihm plötzlich als zu kleine und unbedeutende Tiere, um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu fesseln, der in Eile war. Er erfand also eine Lüge, die seine Missetat vergrößerte. Mit dem Eingeständnis einer enormen Schuld hoffte er, das Gefühl der Mutter erwecken zu können, dessen dumpfe Trägheit er nur ahnte. Mit einer Sicherheit, über die er sich selbst wunderte, sagte er: »Mama, ich habe eine Katze umgebracht!«
Soeben war es der Mutter fast gelungen, die beiden Teile des Halskettenverschlusses zusammenzubringen. Die Hände hinter dem Nacken verschränkt, das Kinn auf die Brust gepreßt, blickte sie zur Erde und klopfte ungeduldig mit dem Schuhabsatz auf den Boden. »Ach so?« fragte sie mit verständnisloser Stimme. Es schien, als hätten ihre Bemühungen um die Halskette ihre Aufmerksamkeit restlos in Anspruch genommen.
Unsicher geworden, setzte Marcello hinzu: »Ich hab sie mit der Schleuder umgebracht …« Die Mutter schüttelte verärgert den Kopf. Sie nahm die Hände vom Nacken, zwischen den Fingern die Halskette, die zu schließen ihr noch immer nicht gelungen war. »Dieser verdammte Verschluß!« rief sie wütend. »Marcello, sei lieb! Hilf mir!« Sie setzte sich schräg aufs Bett, wandte dem Sohn den Rücken zu und fuhr ungeduldig fort: »Gib aber acht, daß der Verschluß wirklich zuschnappt! Sonst springt er gleich wieder auf.«
Während sie sprach, hatte Marcello die mageren, bis zum Kreuz entblößten Schulterblätter vor sich. In dem Lichtschein, der von der Tür ins Zimmer fiel, waren sie weiß wie Papier. Die schlanken Hände mit den spitzen, scharlachroten Fingernägeln hielten das Schmuckstück auf dem zarten, mit einem Schatten dunklen Flaums bedeckten Nacken.
Marcello dachte: Wenn das Kollier geschlossen ist, hört sie mich mit mehr Geduld an. Er beugte sich also vor, ergriff die beiden Teile des Schlosses und brachte sie mit einem Griff zum Einschnappen. Aber jetzt erhob sich die Mutter sofort, neigte sich mit einem flüchtigen Kuß über ihn und sagte: »Danke. Nun schlaf. Gute Nacht!« Und ehe Marcello sie zurückzuhalten vermochte, verschwand sie.
Am folgenden Tag war das Wetter warm, der Himmel bewölkt. Marcello aß schweigend zwischen den beiden schweigenden Eltern, glitt dann von seinem Stuhl und ging in den Garten hinaus. Wie gewöhnlich bewirkte der volle Magen in ihm ein träges Unbehagen, vermischt mit nachdenklicher Sinnlichkeit. Er schritt leise, beinahe auf den Zehenspitzen, über den knirschenden Kies im Schatten der von Insekten umschwirrten Bäume, erreichte das Gartengitter und blickte hinaus. Vor sich hatte er das wohlbekannte Bild der sanft abfallenden Straße mit ihrer Doppelreihe milchiggrüner Pfefferbäume. Sie war zu dieser Stunde menschenleer und unter den tiefen, schwarzen Wolken am Himmel seltsam dunkel. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite waren andere Gitter, andere Gärten, andere Villen, aber alle ähnelten dem Besitz seiner Eltern. Nachdem er die Straße aufmerksam betrachtet hatte, trat Marcello vom Gitter zurück, zog seine Schleuder hervor und bückte sich. Zwischen dem feinen Kies lagen etliche größere weiße Steinchen. Eines dieser Steinchen, in der Form einer Nuß, ergriff Marcello und schob es in die Lederschlaufe der Schleuder. Dann begann er längs der Mauer, die seinen Garten von dem Robertos trennte, auf und ab zu gehen.
Er hatte den Eindruck, daß er sich jetzt im Kriegszustand mit Roberto befand. Er mußte also mit größter Aufmerksamkeit den Efeu an der Trennungsmauer überwachen und bei der geringsten Bewegung im Blätterwerk schießen. In diesem Spiel äußerte sich sein Zorn gegen Roberto, der nicht Komplice bei dem Eidechsenmord hatte sein wollen. Genauso hatte sich Marcellos grausamer Instinkt in dem gestrigen Gemetzel geäußert.
Natürlich wußte Marcello sehr wohl, daß Roberto keineswegs durch den Efeu zu ihm herüberspähte, denn er pflegte um diese Zeit zu schlafen. Trotzdem benahm sich Marcello so, als befände sich der andere in der Nähe. Der alte, gewaltige Efeustock wuchs bis zu den Spitzen des Gitters empor, und seine großen, schwärzlichen, staubigen Blätter lagen dicht übereinander, gleich Spitzenvolants auf einer ruhigen Frauenbrust. Kein Windhauch bewegte sie. Ein paarmal glaubte Marcello, ein Beben im Blätterwerk zu bemerken, das heißt, er redete sich ein, ein solches Beben wahrzunehmen. Da schleuderte er schließlich gezielt seinen Stein ins Gebüsch.
Gleich darauf beugte er sich hastig nieder, suchte einen zweiten Stein und setzte sich wieder in Kampfstellung: die Beine gespreizt, die Arme vorgestreckt, die Schleuder abschußbereit. Konnte es nicht sein, daß Roberto doch hinter den Blättern stand und auf ihn zielte? Aber Roberto ist im Vorteil, dachte Marcello, er ist unsichtbar, während ich ohne jede Deckung bin.
Im Laufe dieses Spiels gelangte er bis ans Ende des Gartens, dorthin, wo er in das Grün des Efeus eine Art Fenster geschnitten hatte. Er blieb stehen und betrachtete aufmerksam die Umfassungsmauer. In seiner Phantasie war das Haus ein Schloß, dessen Mauern von den Kletterpflanzen vollkommen verborgen waren. Nur das Loch im Efeu stellte eine gefährliche, leicht zu überwindende Bresche dar. Plötzlich sah Marcello die Blätter erzittern. Etwas bewegte sich von rechts nach links. Also mußte irgendwer dort sein. Im selben Augenblick dachte er: Roberto kann nicht dort sein, das Ganze ist ein Spiel, also darf ich den Stein ruhig schleudern … Und gleichzeitig dachte er: Roberto ist doch dort, ich darf den Stein nicht schleudern, um ihn nicht zu treffen. Dann, mit plötzlichem, unüberlegtem Entschluß, spannte er die Gummibänder und schoß den Stein in das dichteste Blätterwerk ab. Nicht genug damit, beugte er sich sofort wieder nieder, nahm hastig einen anderen Stein, tat ihn in die Schleuder und schoß zum zweiten Mal. Kurz darauf schoß er zum dritten Mal. Mittlerweile hatte er alle Bedenken und Ängste beiseite geschoben. Es war ihm gleichgültig, ob Roberto dort stand oder nicht. Das einzige, was er empfand, war ein Gefühl kämpferischer Heiterkeit. Er hatte tüchtig in die Blätterwand hineingeschossen, ließ nun die Schleuder keuchend zu Boden fallen und schlich sich an die Mauer heran. Es war, wie er es nicht nur erhofft, sondern sogar gewußt hatte: von Roberto war nichts zu sehen.
Die Gitterstäbe waren sehr weit und gestatteten ihm, seinen Kopf in den fremden Garten zu stecken. Von irgendeiner ganz unklaren Neugier befallen, schaute er zu Boden. An dieser Stelle in Robertos Garten gab es keine Schlinggewächse, sondern eine Irishecke, die zwischen der Mauer und dem Kiesweg verlief. Gerade unter Marcellos Augen, zwischen der Mauer und den weißen und violetten Irisblüten, sah er eine große graue Katze auf der Seite liegen. Er bemerkte die unnatürliche Lage des Tieres – die Pfoten von sich gestreckt, die Schnauze an der Erde – und ein sinnloser Schrecken raubte ihm den Atem. Das dichte bläulich-graue Fell wirkte struppig, ein wenig gesträubt und dabei unbewegt – wie bei jenen toten Tieren, die Marcello vor einer Weile auf dem Marmortisch in der Küche gesehen hatte. Sein Entsetzen steigerte sich immer mehr. Er sprang von seinem Beobachtungsposten hinab, zog aus einem Rosenstrauch eine Stange, kletterte wieder empor, schob den Arm zwischen die Gitterstäbe und stach mit dem erdigen Ende seiner Stange nach der Katze. Doch diese rührte sich nicht. Mit einemmal schienen ihm die Irisblüten auf ihrem hohen grünen Stengel mit den roten und violetten Kronen, rings um den grauen, regungslosen Körper, Totenblumen zu sein, die eine mitleidige Hand für den Leichnam gebracht hatten. Er warf die Stange fort und sprang zur Erde, ohne den Efeu wieder in Ordnung zu bringen.
Marcellos Entsetzen war vielfältiger Art. Sein erster Impuls war, sich in einem Schrank, in einem Verschlag, jedenfalls irgendwo im Dunkeln einzuschließen, um sich selbst zu entfliehen. Entsetzen empfand er, weil er die Katze getötet hatte. Aber noch mehr war er entsetzt, weil er ja diesen Mord am Tag zuvor seiner Mutter bereits mitgeteilt hatte: ein unzweifelhaftes Zeichen dafür, daß ihm grausame, mörderische Taten auf schicksalhaft-geheimnisvolle Weise vorausbestimmt waren. Doch beides wurde von einem noch weit größeren Entsetzen übertroffen: ER hatte tatsächlich die Absicht gehabt, Roberto zu töten. Nur einem Zufall war es zu verdanken, daß die Katze an Stelle seines Freundes ums Leben gekommen war.
Ein Zufall, dem ein Sinn innewohnte: Es ließ sich nicht leugnen, daß ein Fortschritt stattgefunden hatte – von den Blumen zu den Eidechsen, von den Eidechsen zu der Katze, von der Katze zu dem geplanten, beabsichtigten, wenn auch nicht ausgeführten Mord an Roberto. Dieser Mord war immer noch ausführbar, vielleicht sogar unvermeidlich.
So war er also anomal, dachte er. Zu diesem Gedanken trat noch ein lebendiges, körperliches Sichbewußtwerden dieser Abnormität. Das Schicksal hatte ihn demnach ein für allemal gezeichnet und ihn auf eine einsame, bedrohliche, blutige Straße gedrängt. Keine menschliche Kraft würde ihn mehr zurückhalten können.
Unter diesen Betrachtungen ging er zwischen dem Haus und dem Gartengitter hin und her und blickte dabei manchmal zu den Fenstern der Villa empor. Er hoffte beinahe, dort die Gestalt seiner frivolen, gedankenlosen Mutter erscheinen zu sehen. Aber auch sie konnte jetzt nichts mehr für ihn tun, wenn sie überhaupt je etwas hätte tun können. Plötzlich eilte er voll Hoffnung zu der Umfriedung, kletterte an der Mauer hoch und starrte durch die Gitterstäbe. Aber er erblickte keinen leeren Fleck dort, wo er zuvor die Katze gesehen hatte. Sie lag noch immer da – grau und regungslos inmitten des Totenkranzes aus weißen und violetten Blüten. Der Tod, die beginnende Verwesung des Kadavers, hatte einen schwarzen Streifen Ameisen angelockt. Der zog sich über die ganze Hecke, bis zu der Schnauze, ja bis zu den Augen des verendeten Tieres. Marcello starrte auf dieses Schauspiel. Auf einmal sah er – wie bei einer Doppelbelichtung – an Stelle der Katze den toten Roberto zwischen den Irisblüten liegen. Die Ameisen kamen und gingen über seine gebrochenen Augen und über seinen halbgeöffneten Mund. Schaudernd riß sich Marcello von dieser Vision los und sprang wieder hinunter. Dann zog er vorsichtig den Vorhang aus Efeublättern zu. Nun trat zu dem Entsetzen über sich selbst und zur Reue auch noch die Angst, entdeckt und bestraft zu werden.
Er fürchtete sich vor dieser Entdeckung und Bestrafung, fühlte aber gleichzeitig, daß er sie herbeiwünschte – nicht zuletzt deshalb, weil er hoffte, von der abschüssigen Bahn zurückgehalten zu werden, solange dazu noch Zeit war. Von dieser abschüssigen Bahn, an deren Ende unabwendbar der Mord stand. Soweit er sich erinnern konnte, hatten seine Eltern ihn sehr selten bestraft. Sie folgten allerdings nicht irgendwelchen Erziehungsgrundsätzen, die eine Strafe ausschlossen, sondern waren, wie er dunkel begriff, nur gleichgültig. Deshalb litt er jetzt nicht nur unter dem Bewußtsein, ein Verbrechen begangen zu haben und überdies noch zu weit Schlimmerem fähig zu sein, sondern auch darunter, daß er niemanden hatte, der ihn bestrafen würde. Er hatte nicht einmal eine Ahnung, worin diese Strafe bestehen müsse. Derselbe Mechanismus, der ihn dazu getrieben hatte, sich Roberto anzuvertrauen, drängte ihn jetzt dazu, seinen Eltern ein Geständnis abzulegen – darüber war sich Marcello halbwegs im klaren. Von Roberto hatte er hören wollen, daß seine vermeintliche Schuld gar keine Schuld, sondern etwas ganz Alltägliches sei. Von seinen Eltern hoffte er, daß sie in Entrüstungsrufe ausbrechen und erklären würden, diese unerhörte Tat verdiene eine angemessene Strafe. Im ersten Fall wäre die Absolution Robertos für ihn ein Ansporn zu neuen ähnlichen Taten gewesen. Von seinen Eltern erhoffte er eine strenge Verurteilung. Dieser Unterschied machte ihm allerdings wenig aus. In Wirklichkeit ging es ihm, wie er sehr wohl begriff, nur darum, aus der erschreckenden Isolierung, in der er sich befand, wieder auszubrechen – mit jedem Mittel und um jeden Preis.
Vielleicht hätte er sich schon am selben Abend während des Essens dazu entschlossen, seinen Eltern die Tötung der Katze zu gestehen. Aber er hatte plötzlich den Eindruck, daß seine Eltern bereits alles wußten. Sobald er nämlich am Tisch Platz genommen hatte, stellte er mit einer Mischung aus Angst und kaum verhehlter Erleichterung fest, daß Vater und Mutter feindselig und übellaunig wirkten. Die Mutter hatte ihrem kindischen Gesicht einen Ausdruck übertriebener Würde verliehen, saß mit niedergeschlagenen Blicken steif und schweigend da. Der Vater, ihr gegenüber, legte durch verschiedene deutliche Zeichen seine ebenso üble Laune an den Tag. Der Vater war um viele Jahre älter als die Mutter. Oft gab er in bedrückender Weise Marcello das Gefühl, er sei mit seiner Mutter in ein und dieselbe kindische Welt verbannt und seine Mutter sei gar nicht seine Mutter, sondern seine Schwester. Der Vater war hager, hatte ein trockenes und faltiges Gesicht, auf dem nur selten ein kurzes freudloses Lachen sichtbar wurde. Seine hervortretenden Augen funkelten ausdruckslos, wie Minerale; auf seiner Wange erschien häufig ein nervöses Zucken .– beides Dinge, die sicher zusammenhingen. Er liebte die kontrollierten, knappen Bewegungen, wahrscheinlich deshalb, weil er lange Jahre im Militärdienst verbracht hatte. Marcello wußte jedoch, daß er Selbstbeherrschung und Präzision immer übertrieb, wenn er zornig war. Sie verwandelten sich dann in eine seltsame Heftigkeit, die jede noch so einfache Geste mit Bedeutsamkeit erfüllte. An diesem Abend bei Tisch bemerkte Marcello sofort, daß der Vater jede gewohnte und belanglose Handlung unterstrich, als wolle er die Aufmerksamkeit der anderen darauf lenken. Zum Beispiel griff er nach dem Glas, trank einen Schluck, stellte es klirrend wieder hin. Oder er suchte nach dem Salzfaß, nahm etwas Salz heraus, knallte es auf den Tisch zurück. Nicht minder lärmend brach er das Brot in Stücke und legte sie auf den Tisch. Dann schien ihn eine plötzliche Leidenschaft für Symmetrie erfaßt zu haben: Er schob Teller und Bestecke so lange hin und her, bis Messer, Gabel und Löffel genau rechtwinkelig um den Suppenteller gruppiert waren.
Wäre Marcello weniger um sich selbst besorgt gewesen, hätte ihm schnell klarwerden können, daß alle diese mit bedeutsamer, pathetischer Energie geladenen Bewegungen seines Vaters nicht ihm, sondern der Mutter galten. Die tauchte bei jedem neuen Lärm immer tiefer in ihre Würde ein, seufzte nachsichtig und hob mit dem Ausdruck einer Dulderin die Augenbrauen. Aber Marcello war überzeugt, seine Eltern wüßten alles. Sicher hatte Roberto, dieser Hase, den Zuträger gemacht. Zwar sehnte Marcello eine Bestrafung herbei, als er aber die üble Laune seiner Eltern sah, befiel ihn plötzlich ein Ekel vor der Heftigkeit, derer sein Vater, wie er wußte, fähig war.
Seine Mutter bezeigte ihm nur gelegentlich und sozusagen zufällig ihre Zärtlichkeit – mehr aus Reue als aus Liebe. Der Vater wiederum war nur hin und wieder streng, dann aber unmäßig und ohne wirklichen Grund. Offenbar wollte er nach langen Pausen der Zerstreutheit dann und wann seiner Rolle als Erzieher irgendwie gerecht werden. Erst wenn sich die Mutter oder die Köchin über Marcello beschwert hatten, erinnerte sich der Vater plötzlich, daß er einen Sohn hatte: Er brüllte und tobte und verprügelte den Jungen. Besonders vor den Schlägen hatte Marcello Angst: Der Vater trug am kleinen Finger einen Ring mit einem massiven Stein, der während solcher Szenen stets nach innen gedreht war und zu der erniedrigenden Härte der Ohrfeigen noch einen durchdringenden Schmerz fügte. Marcello vermutete, daß der Vater den Ring absichtlich nach innen drehte, war dessen aber nicht sicher.
Verschüchtert und verschreckt baute er jetzt in aller Eile ein glaubhaftes Lügengebäude auf: Nicht er hatte die Katze getötet, sondern Roberto. Die Katze befand sich ja in Robertos Garten. Wie hätte er sie über die Mauer hinweg, durch den Efeu hindurch, töten können? Dann aber fiel ihm plötzlich ein, daß er ja am Abend zuvor selbst seiner Mutter die Tötung einer Katze gestanden hatte. Er erkannte, daß ihm der Ausweg der Lüge verschlossen war. Wahrscheinlich hatte die Mutter trotz ihrer Zerstreutheit dem Vater sein Geständnis wiedererzählt. Und dann hatte dieser zwischen dem Geständnis und den Anschuldigungen Robertos einen Zusammenhang hergestellt. Da gab es nun keinerlei Ausrede.
An diesem Punkt schlugen Marcellos Gedanken wieder um.
Heftig wünschte er aufs neue eine rasche und entscheidende Strafe herbei. Doch was für eine Strafe? Er erinnerte sich: Roberto hatte eines Tages von Instituten gesprochen, wohin Eltern ihre mißratenen Söhne zur Strafe schickten. Zu seiner eigenen Überraschung wünschte er jetzt, zur Strafe in ein solches Institut geschickt zu werden. In diesem Wunsch kam unbewußt der Widerwille gegen das ungeordnete Familienleben zum Ausdruck. Er ließ ihn das herbeiwünschen, was die Eltern für eine Strafe hielten. Er betrog sich selbst mit der schlauen Berechnung, in so einem Institut seine Reue beschwichtigen und vielleicht sogar sein Schicksal ändern zu können.
Diese Gedankenkette führte ihn zu einigen Phantasiebildern, die zwar beängstigend wirkten, aber zugleich auch angenehm waren: ein strenges, kaltes, graues Gebäude mit vergitterten Fenstern. Eisige, schmucklose Schlafsäle mit Reihen von Betten und hohen, weißgekalkten Wänden. Freudlose Klassenzimmer voller Bänke, vorn ein Katheder. Nackte Korridore, finstere Treppen, massive Türen, unpassierbare Gitter. Alles – mit einem Wort – wie im Gefängnis! Und doch zog Marcello so ein Institut der haltlosen, beängstigenden, unerträglichen Freiheit des Elternhauses vor. Sogar der Gedanke, in einer gestreiften Uniform zu stecken und mit rasiertem Kopf umherzugehen, wie das jene Internatszöglinge taten, die er bisweilen auf der Straße vorbeimarschieren gesehen hatte, sogar diese demütigende und beinahe ekelerregende Vorstellung war ihm jetzt willkommen. Denn er sehnte sich verzweifelt nach irgendeiner Norm und Ordnung.
Während er solchen Phantasien nachging, sah er nicht seinen Vater an, sondern hielt den Blick auf das blendendweiße Tischtuch geheftet. Dann und wann fielen Insekten darauf, die am Lampenschirm abgeprallt waren. Einmal hob er die Augen. Da sah er hinter seinem Vater auf dem Fensterbrett das Profil einer Katze auftauchen. Ehe er jedoch ihre Farbe ausmachen konnte, war sie bereits heruntergesprungen. Sie durchquerte das Speisezimmer und verschwand in Richtung Küche. Obzwar Marcello seiner Sache keineswegs sicher war, weitete sich sein Herz doch bei dem freudigen Gedanken, dies sei die Katze, die er wenige Stunden vorher im Garten Robertos liegen gesehen hatte. Allein die Hoffnung, sie könne es sein, befriedigte ihn. War es nicht ein Beweis dafür, daß ihm das Schicksal dieser Katze näherstand als sein eigenes?
»Die Katze!« rief er laut. Dann warf er die Serviette auf den Tisch, schob ein Bein vor und fragte: »Ich bin fertig, Papa. Darf ich aufstehen?«
»Du bleibst sitzen«, sagte der Vater mit drohender Stimme.
Verschüchtert meinte Marcello: »Aber die Katze lebt doch …«
»Ich habe dir gesagt – bleib sitzen!« befahl der Vater nochmals. Dann, als seien Marcellos Worte für ihn das Signal gewesen, das lange Schweigen zu durchbrechen, wandte er sich an seine Frau: »Also – sag etwas! Sprich!«
»Ich habe nichts zu sagen«, erwiderte sie mit betonter Würde, die Augen niedergeschlagen, einen verächtlichen Zug um den Mund. Sie trug ein schwarzes, ausgeschnittenes Abendkleid. Marcello bemerkte, daß sie zwischen den mageren Fingern ein kleines Taschentüchlein hielt und oftmals an die Nase führte. Mit der anderen Hand griff sie dann und wann nach einem auf dem Tisch liegenden Stück Brot, und zwar mit den Fingerspitzen und den Nägeln, wie ein Vogel, der Krumen aufpickt.
»Sag schon, was du zu sagen hast! Sprich! Zum Donnerwetter!«
»Dir habe ich nichts zu sagen …«
Marcello begriff erst jetzt, daß nicht sein Katzenmord den Ärger der Eltern verursacht hatte. Dann, plötzlich überstürzte sich alles. Der Vater sagte nochmals: »Sprich! Zum Donnerwetter!« Als einzige Antwort zuckte die Mutter mit den Schultern. Da ergriff der Vater das vor ihm stehende Kelchglas und schrie: »Willst du sprechen? Ja oder nein?« Er schmetterte das Glas auf den Tisch, es zerbrach und der Vater führte mit einem Fluch die verletzte Hand zum Mund. Erschrocken erhob sich die Mutter und eilte zur Tür. Beinahe wollüstig sog der Vater das Blut aus seiner Wunde, die Brauen hatte er zu einem dichten Bogen zusammengezogen. Als er sah, daß seine Frau davonlief, unterbrach er sich in seiner Beschäftigung und schrie: »Ich verbiete dir, zu gehen! Verstanden?« Darauf warf die Mutter heftig die Tür ins Schloß. Der Vater sprang auf und lief nun ebenfalls zur Tür. Erregt durch die Heftigkeit der Szene, rannte Marcello hinterher.
Der Vater befand sich auf der Treppe, hatte eine Hand auf dem Geländer, schien sich aber merkwürdigerweise gar nicht zu beeilen, obwohl er immer zwei Stufen auf einmal nahm. Es schien, als schwebe er schweigend zum Erdgeschoß hinab. Marcello mußte an den gestiefelten Kater denken. Er zweifelte gar nicht daran, daß der Vater auf seine Art schneller sein würde als die Mutter, die mit ihren kleinen, unordentlichen Schritten vor ihm die Treppe hinunterlief und dabei von ihrem engen Rock behindert wurde.
Jetzt bringt er sie um! dachte Marcello, der dem Vater folgte.
Im Erdgeschoß angelangt, eilte die Mutter zu ihrem Zimmer. Es gelang ihrem Mann, sich hinter ihr durch den Türspalt zu zwängen. Das alles sah Marcello, während er mit seinen kurzen Knabenbeinen die Treppe hinunterlief, der weder wie sein Vater zwei Stufen auf einmal nahm, noch wie seine Mutter hüpfen konnte. Schließlich unten angelangt, stellte er fest, daß plötzlich auf den Lärm der Verfolgung eine seltsame Stille eingetreten war. Die Tür zum Zimmer seiner Mutter war angelehnt geblieben. Marcello trat zögernd auf die Schwelle.
Zunächst sah er in dem halbdunklen Zimmer nur die beiden großen duftigen Vorhänge an den Fenstern, rechts und links von den Betten. Ein Luftzug wehte sie gerade in die Höhe, sie berührten fast den Deckenlüster. Diese weißen, schweigenden Vorhänge gaben dem halbdunklen Zimmer einen Anstrich von Verlassenheit – als wären die Eltern auf ihrer Verfolgung durch die geöffneten Fenster in die Sommernacht hinausgeflogen. Dann entdeckte Marcello in dem aus dem Korridor hereindringenden Lichtstreifen endlich seine Eltern, das heißt, er sah nur den Rücken des Vaters, unter dem die Mutter fast völlig verschwand. Ihre Haare lagen auf dem Kissen, mit einem Arm tastete sie nach dem Kopfende des Bettes. Krampfhaft suchte sich dieser Arm irgendwo festzuklammern, ohne daß ihm dies gelang. Der Vater, der die Mutter unter sich zu erdrücken schien, vollführte mit Schultern und Händen Bewegungen, als wolle er sie erdrosseln.
Er bringt sie um! dachte Marcello. Er stand immer noch auf der Schwelle und empfand eine seltsame kämpferische und grausame Erregung und den Wunsch, in diesen Kampf einzugreifen. Ob er dem Vater helfen oder die Mutter verteidigen wollte, das wußte er eigentlich nicht. Auf einmal hoffte er, daß durch dieses sich hier anbahnende, viel schlimmere Verbrechen sein eigenes ausgelöscht werde. Was bedeutete schon die Tötung einer Katze, gemessen an der Tötung einer Frau?
Als Marcello gerade sein letztes Zögern überwunden hatte und sich fasziniert und voller Kampfeslust ins Zimmer hineinbewegte, ertönte die Stimme seiner Mutter – nicht wie die eines Menschen, der erdrosselt wird, sondern fast zärtlich. Sie murmelte: »Laß mich …« Doch ihr erhobener Arm, der bis jetzt immer noch das Kopfende des Bettes gesucht hatte, senkte sich und umschlang den Nacken des Mannes. Verwundert und beinahe enttäuscht tat Marcello ein paar Schritte zurück und trat auf den Korridor hinaus.
Langsam und vorsichtig, um keinen Lärm zu machen, wandte er sich dem Untergeschoß und der Küche zu. Schon quälte ihn wieder die Neugier: War die Katze, die vom Fenster gesprungen war, mit der identisch, die er im Garten hatte liegen sehen? Als er die Küchentür aufstieß, bot sich ihm ein Bild häuslichen Friedens: In der weißen Küche saßen zwischen dem elektrischen Herd und dem Eisschrank die ältliche Köchin und das junge Stubenmädchen beim Essen an ihrem Marmortisch. Und auf dem Fußboden, unter dem Fenster, hockte die Katze und leckte mit rosafarbener Zunge Milch aus einer Schüssel. Doch es war, wie Marcello sofort enttäuscht feststellte, keineswegs die bewußte graue Katze, sondern ein ganz anderes, gestreiftes Tier.
Da er nicht wußte, wie er sein Auftauchen in der Küche rechtfertigen sollte, ging er zu der Katze, beugte sich hinab und streichelte ihren Rücken. Das ließ sie sich, ohne ihre Mahlzeit zu unterbrechen, schnurrend gefallen. Die Köchin erhob sich und schloß die Tür. Dann öffnete sie den Eisschrank, nahm einen Teller mit einem Tortenstück heraus, stellte ihn auf den Tisch, schob einen Stuhl heran und sagte zu Marcello: »Willst du ein Stück Torte? Von gestern abend? Ich hab es eigens für dich aufgehoben.« Marcello gab keine Antwort, ließ die Katze, setzte sich und begann zu essen.
Das Stubenmädchen sagte: »Gewisse Dinge verstehe ich einfach nicht. Da haben sie den ganzen Tag Zeit und soviel Platz im Haus – warum müssen sie gerade bei Tisch in Gegenwart des Jungen streiten?«
Die Köchin erwiderte belehrend: »Wenn man sich um seine Kinder nicht kümmern will, soll man sie nicht in die Welt setzen.«
Nach einem kurzen Schweigen bemerkte das Stubenmädchen: »Er könnte seinem Alter nach ihr Vater sein … Natürlich kann das nicht gut gehen.«
»Wenn’s sich nur darum drehte …« meinte die Köchin und warf einen bedeutsamen Blick auf Marcello.
»Außerdem«, fuhr das Stubenmädchen fort, »ist dieser Mann meiner Meinung nach nicht normal.«
Marcello aß zwar weiter, spitzte aber bei dieser Bemerkung die Ohren. »Auch sie ist der gleichen Ansicht«, schwatzte das Mädchen. »Wissen Sie, was sie mir vor kurzem gesagt hat, als ich sie am Abend auskleidete? ›Giacomina‹, hat sie gesagt, ›früher oder später wird mich mein Mann umbringen.‹ Da hab ich gefragt, warum gehen Sie denn dann nicht von ihm fort? Und sie …«
»Psssttt …« unterbrach die Köchin und deutete auf Marcello. Das Stubenmädchen verstand und fragte den Jungen: »Wo sind denn Papa und Mama?«
»Oben im Zimmer«, erwiderte Marcello. Und dann, wie von einem unwiderstehlichen Impuls getrieben, fügte er hinzu: »Papa ist wirklich nicht normal. Wißt ihr, was er getan hat?«
»Nein, was denn?«
»Er hat eine Katze getötet.«
»Eine Katze? Wie denn?«
»Mit meiner Schleuder. Ich hab gesehen, wie er im Garten eine graue Katze verfolgte, die auf der Mauer entlangging. Dann nahm er einen Stein, schoß ihn nach der Katze und traf sie. Die Katze fiel hinunter in den Garten Robertos. Ich habe später nachgeschaut und festgestellt, daß sie wirklich tot war.« Während des Sprechens ereiferte sich Marcello, behielt aber den Ton eines unschuldigen Jungen bei, der ahnungslos und naiv von einer Missetat erzählt, deren Zeuge er gewesen ist.
»Nein so was!« rief das Stubenmädchen und schlug die Hände zusammen. »Eine Katze! Ein Mann dieses Alters, ein Herr, nimmt die Schleuder seines Sohnes und bringt damit eine Katze um! Wenn das nicht verrückt ist!«
»Wer schlecht zu den Tieren ist, der ist auch schlecht zu den Menschen«, sagte die Köchin. »Erst erschlägt man eine Katze und zuletzt einen Menschen.«
»Warum?« fragte Marcello und hob plötzlich die Augen von seinem Teller.
»So sagt man«, erwiderte die Köchin und streichelte ihn. »Obwohl es nicht immer wahr ist …« fuhr sie zu dem Stubenmädchen gewandt fort. »Der Mörder aus Pistoja, der die vielen Leute umgebracht hat … Das hab ich in der Zeitung gelesen, wissen Sie … Haben Sie eine Ahnung, was er jetzt im Gefängnis tut? Er hält sich einen Kanarienvogel!«
Die Torte war zu Ende. Marcello stand auf und verließ die Küche.