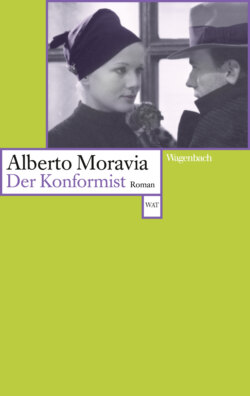Читать книгу Der Konformist - Alberto Moravia - Страница 5
Drittes Kapitel
ОглавлениеJeden Morgen wurde Marcello zu einer bestimmten Zeit von der Köchin geweckt. Sie hatte ihn besonders ins Herz geschlossen. Sie betrat im Finstern das Zimmer, stellte das Tablett mit dem Frühstück auf die Marmorplatte der Kommode und hängte sich an die Gurte des Rolladens, um ihn mit zwei oder drei kräftigen Rucken hochzuziehen. Dann stellte sie das Tablett auf Marcellos Knie und wartete stehend, bis er sein Frühstück beendet hatte. Darauf zog sie ihm sofort die Decken weg und jagte ihn ins Badezimmer. Auch beim Anziehen half sie, indem sie ihm die einzelnen Stücke reichte, oft auch niederkniete, um ihm die Schuhe zuzuschnüren. Diese Köchin war eine lebhafte, fröhliche und durchaus vernünftige Person. Sie hatte den Tonfall und die Gewohnheiten der Provinz, in der sie geboren war.
Montag morgen erwachte Marcello mit der unbestimmten Erinnerung, am Abend vor dem Einschlafen zornige Stimmen gehört zu haben. Doch er hatte keine Ahnung, ob sie aus dem Erdgeschoß oder aus dem Schlafzimmer der Eltern gekommen waren. Er wartete, bis er mit dem Frühstück fertig war, und fragte dann ganz obenhin die Köchin, die wie gewöhnlich neben seinem Bett stand:
»Was ist denn gestern abend los gewesen?«
Sie sah ihn mit übertriebener, unechter Verwunderung an: »Nichts, wovon ich wüßte!«
Marcello begriff, daß sie sich zwar verstellte, ihm aber doch sehr gern etwas anvertrauen wollte: Die falsche Verwunderung, das maliziöse Funkeln ihrer Augen, ihre ganze Haltung verrieten es ihm.
Er sagte: »Ich habe Schreie gehört …«
»Ach das!« sagte die Frau. »Das ist doch das Übliche. Weißt du nicht, daß dein Papa und deine Mama oft schreien?«
»Ja«, gab Marcello zurück, »aber sie schrien lauter als sonst …«
Die Köchin lächelte, stützte sich mit beiden Händen auf das Fußende des Bettes und sagte: »So werden sie einander wenigstens besser verstanden haben, meinst du nicht?«
Dies war eine ihrer Besonderheiten: Fragen zu stellen, auf die sie keine Antwort erwartete.
Marcello erkundigte sich: »Aber warum haben sie geschrien?«
Die Köchin lächelte von neuem: »Warum schreien die Leute? Weil sie sich nicht vertragen.«
»Und warum vertragen sie sich nicht?«
»Die?« rief sie, glücklich über diese Frage des Knaben. »Ach … aus tausend Gründen. Einen Tag vielleicht, weil deine Mama bei offenem Fenster schlafen möchte und dein Papa nicht. Dann wieder, weil er früh zu Bett gehen möchte, sie aber nicht. An Gründen fehlt es da nie, wie?«
Marcello sagte plötzlich ernst und überzeugt, als handelte es sich um ein langgehegtes Gefühl: »Ich möchte nicht mehr länger hierbleiben.«
»Und was möchtest du statt dessen tun?« rief die Köchin, immer vergnügter. »Du bist klein und kannst nicht einfach von daheim fortgehen. Du mußt schon warten, bis du erwachsen bist.«
»Mir wär’s lieber«, sagte Marcello, »wenn sie mich in eine Anstalt schickten.«
Die Frau sah ihn gerührt an und rief: »Du hast recht! In einer Anstalt hättest du wenigstens jemanden, der sich um dich kümmerte. Willst du wissen, warum dein Papa und deine Mama heute nacht so gestritten haben?«
»Ja. Warum?«
»Warte, ich will dir was zeigen!« rief die Köchin. Sie eilte zur Tür und verschwand. Marcello hörte, wie sie Hals über Kopf die Treppe hinuntereilte, und fragte sich von neuem, was wohl am vergangenen Abend vorgefallen sein mochte. Gleich darauf hörte er die Köchin zurückkommen. Fröhlich und geheimnisvoll trat sie ein und hielt in der Hand einen Gegenstand, den Marcello wiedererkannte: eine große Fotografie im Silberrahmen, die für gewöhnlich im Salon auf dem Klavier stand. Die Aufnahme stammte aus einer Zeit, in der Marcello kaum mehr als zwei Jahre alt gewesen war. Man sah darauf Marcellos Mutter in einem weißen Kleid mit dem Kind im Arm, das ebenfalls ein weißes Kleidchen trug und eine weiße Schleife im Haar hatte.
»Siehst du, was mit diesem Bild geschehen ist?« fragte die Köchin. Dann fuhr sie fort: »Als deine Mama gestern abend aus dem Theater heimkam und den Salon betrat, war diese Fotografie das erste, was sie erblickte. Die Arme wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Siehst du, was dein Papa mit dieser Fotografie angestellt hat?«
Marcello betrachtete verblüfft das Bild: Irgendwer hatte mit der Spitze eines Federmessers oder mit einem Pfriem die Augen der Mutter und des Sohnes durchlöchert und beiden unter die Lider mit Rotstift hervorströmendes Blut gemalt. Die ganze Angelegenheit war so seltsam, unerwartet und zugleich dunkel-unheilvoll, daß Marcello zunächst gar nicht wußte, was er davon halten sollte.
»Ja, dein Papa hat das gemacht!« rief die Köchin. »Und deshalb hatte deine Mama allen Grund, zu schreien.«
»Aber warum hat er das gemacht?«
»Eine Hexerei! Eine fattura! Weißt du, was das ist?«
»Nein.«
»Wenn man jemandem etwas Böses wünscht … Man kann auch statt der Augen die Brust durchlöchern in der Gegend des Herzens … Und dann geschieht etwas.«
»Was?«
»Die betreffende Person stirbt … Oder es stößt ihr ein Unglück zu, je nachdem …«
Marcello stammelte: »Aber ich habe Papa doch nichts Böses getan …!«
»Und deine Mama? Was hat die ihm getan?« rief die Köchin entrüstet. »Aber weißt du, was dein Papa ist? Verrückt ist er! Und weißt du, wo er enden wird? In Sant’ Onofrio, im Irrenhaus! Und jetzt los, zieh dich an! Es ist höchste Zeit, daß du in die Schule gehst. Ich stelle die Fotografie wieder an ihren Platz.« Quietschvergnügt eilte sie davon, und Marcello blieb allein.
In Gedanken versunken und unfähig, sich den Vorfall mit dem Bild irgendwie zu erklären, zog er sich an. Er hatte für seinen Vater nie besondere Gefühle gehegt. Dessen Feindseligkeit, ob echt oder vorgetäuscht, war ihm nie nahegegangen. Aber die Worte der Köchin über die böse Kraft einer Hexerei gaben ihm doch zu denken. Er war nicht abergläubisch und hielt es eigentlich nicht für möglich, daß man durch Beschädigung einer Fotografie der darauf abgebildeten Person wirklich ein Unglück zufügen könne. Trotzdem weckte die Wahnsinnstat bei ihm Ängste, von denen er geglaubt hatte, sie seien weitgehend gebannt: Er hatte wieder das beklemmende, ohnmächtige Gefühl, in ein tragisches Schicksal verstrickt zu sein. Fast den ganzen Sommer lang hatte ihn dieses Gefühl gequält, war dann aber allmählich verschwunden. Und jetzt, vor dieser mit blutigen Tränen besudelten Fotografie, hatte es sich wieder gemeldet.
War das Unglück wie ein schwarzer, immer größer werdender Punkt im heiteren Blau des Himmels, dachte er, der sich schließlich als ein räuberischer Geier entpuppt, bereit, das unglückliche Opfer anzufallen? Oder war das Unglück ein Fluch der Ungeschicklichkeit, der Unvorsichtigkeit, der Blindheit, mit der das Blut und alle Sinne geschlagen sind? Diese letzte Definition schien ihm die richtigste, denn sie führte das Unglück auf einen Mangel an Gnade, auf eine dunkle, undurchschaubare Fatalität zurück. Es gab also doch so etwas wie eine verhängnisvolle Straße. Das hatte ihm nun die Tat seines Vaters von neuem bewiesen. Er wußte: Diese Fatalität wollte, daß er einen Mord beging. Aber nicht das war es, was ihn im Grunde erschreckte. Wovor er schauderte, war die Erkenntnis, bereits zu allem, was er in Zukunft tun würde, verdammt zu sein. Und es war ihm klar, daß allein schon das Wissen um diese Dinge einen Antrieb darstellte, ihnen zu erliegen.
Später, in der Schule, vergaß er dann mit seinem knabenhaften Gemüt ganz plötzlich die soeben durchgemachten Ängste. Als Banknachbar hatte er einen seiner Quäler, einen gewissen Turchi. Der war zwar der Älteste, aber zugleich auch der Unwissendste der ganzen Klasse. Turchi hatte als einziger ein paar Stunden Boxunterricht genommen, das Boxen also nach allen Regeln der Kunst zu lernen begonnen. Sein hartes, eckiges Gesicht mit dem Haar im Bürstenschnitt, der breiten Nase und den schmalen Lippen wirkte schon wie das eines Berufsboxers. Von Latein hatte Turchi keine Ahnung. Doch auf der Straße, außerhalb der Schule, genügte es, daß er mit knotiger Hand einen Zigarettenstummel aus dem Mund nahm und sagte: »Meiner Meinung nach wird Colucci die Meisterschaft machen«, um alle anderen Jungen voll Respekt verstummen zu lassen. Turchi konnte auch die Nase mit zwei Fingern zur Seite zerren und so beweisen, daß seine Membran kaputt war: ein Kennzeichen des wahren Boxers! Er beschäftigte sich nicht nur mit Boxen, sondern auch mit Fußball und allen anderen populären und kampfbetonten Sportarten. Marcello gegenüber hatte Turchi eine sarkastische, in ihrer Brutalität beinahe nüchterne Haltung. Er war es gewesen, der zwei Tage zuvor Marcellos Arme festgehalten hatte, während die anderen vier ihm das Röckchen überzogen. Marcello glaubte nun an diesem Morgen, endlich einen Weg gefunden zu haben, um sich die Achtung Turchis zu verschaffen.
In dem Augenblick, als sich der Geographielehrer umwandte und dann mit einem langen Stab auf die Karte von Europa zeigte, schrieb Marcello in aller Eile auf ein Heft: »Heute werde ich eine wirkliche Pistole bekommen!« Darauf schob er das Heft dem Turchi zu. Dieser war zwar völlig unwissend, aber was das Betragen anging, ein Musterschüler: aufmerksam, regungslos, beinahe düster in seinem Ernst. Marcello wunderte sich deshalb immer wieder, daß Turchi nicht einmal imstande war, auch nur die einfachsten Fragen zu beantworten. Und es war ihm rätselhaft, woran Turchi während des Unterrichts dachte und warum er, obwohl er nie lernte, einen solchen Eifer vortäuschte. Angesichts des Heftes machte Turchi jetzt eine ungeduldige Bewegung, die soviel heißen sollte wie: Laß mich in Ruhe! Siehst du denn nicht, daß ich dem Unterricht folge? Marcello versetzte ihm einen Rippenstoß. Das veranlaßte Turchi zwar nicht, seine Haltung zu ändern, aber er senkte doch den Blick und begann zu lesen. Dann griff Turchi nach einem Bleistift und schrieb auf: »Glaub ich nicht!« An einer empfindlichen Stelle getroffen, beeilte sich Marcello, seine Behauptung zu bekräftigen. Er schrieb: »Ehrenwort!« Der ungläubige Turchi fragte: »Was für eine Marke?« Aus dem Konzept gebracht, antwortete Marcello nach einem kleinen Zögern: »Eine Wilson.« Er meinte eigentlich »Weston«, denn diesen Namen hatte er vor kurzem von Turchi selbst gehört. Turchi schrieb sogleich: »Nie gehört!« Darauf erwiderte Marcello: »Ich bringe sie morgen in die Schule mit.« Hier nahm das schriftliche Zwiegespräch ein plötzliches Ende, denn der Lehrer wandte sich um und fragte Turchi nach dem größten Fluß Deutschlands. Turchi erhob sich, dachte eine Weile nach und gestand endlich mit beinahe sportlicher Offenheit, diesen Fluß nicht zu kennen. In diesem Augenblick ging die Tür auf, der Schuldiener erschien auf der Schwelle und verkündete das Ende des Unterrichts.
Als Marcello bald darauf der Platanenallee zustrebte, war ihm klar, daß er Lino zur Einhaltung des Versprechens zwingen und unbedingt die Pistole erhalten müsse. Natürlich würde ihm Lino die Waffe nur freiwillig oder gar nicht geben. Es galt also, eine Haltung anzunehmen, mit der dieses Ziel am sichersten zu erreichen war. Zwar verstand er den wahren Beweggrund Linos noch immer nicht, doch mit instinktiver, beinahe weiblicher Koketterie wußte er, wie er sich würde benehmen müssen: Um in den Besitz der Pistole zu gelangen, mußte er das tun, was Lino selbst von ihm am Samstag verlangt hatte, durfte ihn nicht beachten, mußte seine Angebote überhören, seine Bitten abweisen, mußte sich – mit einem Wort – kostbar machen. Ich darf das Auto erst dann besteigen, dachte er, wenn ich sicher sein kann, daß mir die Pistole bereits gehört. Wie gesagt, warum Lino eigentlich so großen Wert auf ihn legte und ihm damit diese Art von Erpressung ermöglichte, wußte Marcello nicht. Doch mit demselben Instinkt, der ihm empfahl, Lino zu erpressen, fühlte er, daß sich hinter seinem Verhältnis zu dem Chauffeur der Schatten einer ungewöhnlichen Zuneigung verbarg. Und er ahnte auch, daß er über Lino eine ebenso peinliche wie geheimnisvolle Macht besaß. Allerdings hätte er mit Sicherheit behaupten können, diese Zuneigung und diese beinahe weibliche Rolle, die ihm in der ganzen Angelegenheit zufiel, sei ihm wirklich unangenehm. Er wollte nur vermeiden, daß ihm Lino noch einmal den Arm um die Hüften legte, wie dies im Korridor der Villa während ihres ersten Beisammenseins geschehen war.
Er bog in die Allee ein. Genau wie am vergangenen Samstag war auch heute das Wetter stürmisch und bewölkt. Der warme Wind führte überall auf seinen Wegen etwas mit sich: welkes Laub, Papierfetzen, Federn, Flocken, Zweige, Staub. Inmitten der Allee wirbelte eine Bö gerade jetzt einen Laubhaufen empor. Die Blätter stiegen bis zu den kahlen Ästen der Platanen auf. Sie kreisten unter dem düsteren Himmel und sahen aus wie zahllose gelbe Hände mit auseinandergespreizten Fingern. Marcello belustigte sich damit, dies Spiel der Blätter anzuschauen. Als er dann den Blick senkte, sah er durch das Gewirbel der Goldhände hindurch das lange schwarze, funkelnde Auto am Gehsteig halten. Langsam ging er an dem Wagen vorüber. Sogleich öffnete sich, wie ein Signal, der Schlag. Lino, ohne Mütze, beugte den Kopf heraus und fragte: »Marcello, willst du einsteigen?«
Marcello konnte nicht umhin, sich über den Ernst dieser Einladung zu wundern – nach allem, was bei ihrer ersten Begegnung besprochen worden war. Es erschien ihm geradezu komisch, wie Lino genau das tat, was er nicht zu tun sich geschworen hatte. Marcello ging weiter, als hätte er nichts gehört, und bemerkte mit dunkler Genugtuung, daß sich der Wagen wieder in Bewegung setzte und ihm nachfuhr. Links und rechts in der menschenleeren Allee erhoben sich die gleichförmigen Villen mit ihren vielen Fenstern und die dicken, schrägen Stämme der Platanen. Das Auto folgte ihm im Schritt – mit einem leisen Summen, das sich wohlig anhörte. Nach etwa zwanzig Metern fuhr der Wagen vor, hielt an, der Schlag öffnete sich von neuem. Ohne auch nur den Kopf zu wenden, ging Marcello unbeirrt weiter und vernahm die flehende Stimme: »Marcello – steig ein! Ich bitte dich, vergiß, was ich vorgestern zu dir gesagt habe … Marcello, hörst du mich?«
Marcello konnte nicht umhin, zu denken, daß diese Stimme einigermaßen widerwärtig war. Was hatte Lino denn so zu wimmern? Beinahe hätte sich Marcello für ihn geschämt.
Immerhin wollte er Lino nicht völlig entmutigen. Also wandte er sich nach ein paar Schritten halb um, ermunterte Lino auf diese Weise, die Verfolgung fortzusetzen. Der Blick, den er hinter sich warf, hatte einen lockenden Ausdruck – das fühlte Marcello sofort. Und plötzlich empfand er unverkennbar das gleiche, das er empfunden hatte, als ihm die Kameraden das Röckchen umbanden: eine Erniedrigung, die nicht ganz unangenehm war, eine Unwahrhaftigkeit in der eigenen Haltung. Hatte er vielleicht doch nichts dagegen, lag es vielleicht doch in seiner Natur, die Rolle eines hochmütigen, koketten weiblichen Wesens zu spielen?
Inzwischen war ihm der Wagen wieder gefolgt. Marcello fragte sich, ob der Augenblick des Nachgebens schon gekommen sei. Dann entschied er, daß es mit dem Nachgeben noch etwas Zeit habe. Ohne anzuhalten, glitt das Auto langsam an ihm vorbei. Er hörte die Stimme des Mannes, die ihn rief: »Marcello …!« Darauf fuhr der Wagen plötzlich davon. Marcello befürchtete, Lino habe die Geduld verloren. Er erschrak vor der Vorstellung, sich morgen ohne Pistole in der Schule einfinden zu müssen. Also begann er zu laufen und rief: »Lino …! Lino … Halt!« Doch der Wind entführte seine Worte wie die welken Blätter, die wirbelnd durch die Luft flogen. Das Auto wurde sichtlich kleiner. Lino hatte wohl Marcellos Rufen nicht gehört und fuhr nun heim. Marcello würde die Pistole nicht bekommen, und Turchi würde ihn noch mehr verhöhnen. Gleich darauf aber schöpfte er tief Atem und setzte seinen Weg mit fast normalen Schritten fort: er wußte auf einmal, daß der Wagen nicht vorausgefahren war, um ihm zu entfliehen, sondern um ihn an der nächsten Querstraße zu erwarten.
Wirklich, dort stand das Auto und versperrte mit seiner ganzen Länge den Weg! Marcello ärgerte sich, daß es Lino gelungen war, ihm einen so demütigenden Schrecken einzujagen. Und mit plötzlicher Grausamkeit beschloß er, Lino dies mit wohlberechneter Härte zu vergelten. Er war jetzt ohne Eile bei der Querstraße angelangt. Der Wagen wartete: lang, schwarz, funkelnd mit all seinem Messing und seiner ganzen altmodischen Karosserie. Marcello tat, als wolle er um das Auto herumgehen. Sogleich öffnete sich der Schlag, und Lino wurde sichtbar.
»Marcello«, begann er mit verzweifelter Entschlossenheit, »vergiß, was ich zu dir am Samstag gesagt habe! Du hast deine Pflicht nur zu gut getan. Komm, Marcello!«
Marcello war neben der Motorhaube stehengeblieben. Jetzt tat er einen Schritt zurück und sagte kühl, ohne Lino anzusehen:
»Nein, ich komme nicht mit dir. Aber nicht darum, weil du das am Samstag so wolltest, sondern weil ich keine Lust habe.«
»Und warum hast du keine Lust?«
»Deshalb! Warum sollte ich einsteigen?«
»Um mir eine Freude zu machen.«
»Aber ich habe gar keine Lust, dir eine Freude zu machen.«
»Warum? Bin ich dir unsympathisch?«
»Ja«, sagte Marcello, schlug die Augen nieder und spielte mit dem Griff des Wagenschlags. Er wußte, daß sein Gesicht vergrämt, unruhig und feindselig aussah, wußte aber selbst nicht, ob er eine Komödie spielte oder nicht. Ja, es ist eine Komödie, die ich mit Lino spiele, dachte er dann. Aber wenn es eine Komödie ist, warum empfinde ich ein so starkes und so kompliziertes Gefühl, gemischt aus Eitelkeit, Abwehr, Erniedrigung, Grausamkeit und Trotz?
Lino lachte leise und zärtlich und fragte dann: »Warum bin ich dir denn unsympathisch?«
Jetzt blickte Marcello auf. Ja, Lino war ihm wirklich unsympathisch. Und angesichts dieser strengen, mageren Züge begriff er auch, warum: Lino hatte ein Doppelgesicht, in dem der Betrug einen geradezu physischen Ausdruck fand. Da war zum Beispiel der Mund – fein, trocken, hochmütig und keusch auf den ersten Blick. Dann aber, wenn ein Lächeln die Lippen aufschloß und umstülpte, wurde eine lüsterne, feuerrote Schleimhaut mit gierigem Speichel sichtbar. Marcello zögerte mit der Antwort und sah Lino noch immer an, der lächelnd wartete. Schließlich bekannte er ehrlich: »Du bist mir unsympathisch, weil dein Mund naß ist.«
Linos Lächeln verschwand, sein Gesicht verdüsterte sich. »Was denkst du dir denn für einen Unsinn aus!« sagte er unbeherrscht. Doch sogleich verfiel er in einen scherzenden Ton und fragte leichthin: »Nun, Herr Marcellino, wollen Sie einsteigen?«
»Ich steige ein«, erklärte Marcello, endlich entschlossen, »aber nur unter einer Bedingung.«
»Und die wäre?«
»Daß du mir wirklich die Pistole gibst.«
»Einverstanden. Komm …!«
»Nein, du mußt sie mir sofort geben«, beharrte Marcello dickköpfig.
»Aber ich habe sie doch nicht hier«, sagte Lino in aufrichtigem Ton. »Sie ist Samstag in meinem Zimmer geblieben, Marcello. Jetzt fahren wir nach Haus und holen sie.«
»Unter diesen Umständen komme ich nicht mit«, entschloß sich Marcello und war darüber selbst überrascht. »Auf Wiedersehen!«
Er tat einen Schritt, als wolle er sich endgültig auf den Weg nach Haus machen. Da verlor Lino die Geduld. »Komm, spiel nicht den kleinen Jungen«, rief er, beugte sich hinaus, ergriff Marcello beim Arm und zog ihn auf den Sitz neben sich. »Jetzt fahren wir sofort zu mir, und ich verspreche dir, daß du die Pistole bekommst.« Marcello war im Grunde zufrieden, daß er dazu gezwungen wurde, den Wagen zu besteigen. Er protestierte also nicht mehr und beschränkte sich darauf, ein knabenhaft-mißlauniges Gesicht zu ziehen. Lino schloß schnell den Schlag, ließ den Motor an, und das Auto fuhr ab.
Eine ganze Weile sprachen sie nicht miteinander. Marcello dachte: Vielleicht schweigt Lino, weil er zu vergnügt ist, um zu sprechen. Er selbst hatte nichts zu sagen. Er würde die Pistole bekommen, würde mit ihr nach Haus zurückkehren und sie am folgenden Tag dem Turchi in der Schule zeigen. Über diese angenehmen Aussichten gingen seine Gedanken nicht hinaus. Allerdings befürchtete er immer noch ein wenig, von Lino betrogen zu werden. In diesem Fall, überlegte er, muß ich irgendeine neue Teufelei ersinnen, um Lino zur Verzweiflung zu bringen und ihn zur Einhaltung seines Versprechens zu zwingen.
Er hatte sein Bücherpaket auf den Knien liegen und sah hinaus auf die vorübergleitenden Platanen und Häuser. Als der Wagen die Steigung zu erklimmen begann, fragte Lino, gleichsam am Ende einer langen Gedankenkette angelangt: »Wer hat dir denn soviel Koketterie beigebracht, Marcello?«
»Warum?« fragte Marcello zurück.
»Na …«
»Du bist der Schlaue«, sagte Marcello. »Du versprichst mir dauernd die Pistole und gibst sie mir nicht.«
Lino lachte und schlug mit einer Hand auf Marcellos bloßes Knie. »Ja«, sagte er, »heute bin ich der Schlaue!« Marcello schob das Knie beiseite. Lino aber ließ weiter seine Hand darauf ruhen und sagte mit triumphierender Stimme: »Weißt du, Marcello, ich bin so froh, daß du gekommen bist … Wenn ich jetzt daran denke, daß ich dich am Samstag gebeten habe, nicht auf mich zu hören, nicht zu mir in den Wagen zu steigen … Wie dumm man bisweilen sein kann! Wirklich – wie dumm! Aber zum Glück bist du gescheiter gewesen als ich, Marcello.«
Marcello gab keine Antwort. Er verstand nicht, was Lino eigentlich meinte. Und diese Hand auf seinem Knie war ihm lästig. Er hatte inzwischen schon mehrmals versucht, mit dem Knie wegzurücken, doch die Hand hatte sich nicht abschütteln lassen. Als ihnen jetzt in einer Kurve ein anderer Wagen entgegenkam, tat Marcello sehr ängstlich und rief: »Achtung, der fährt in uns hinein!« Wirklich erreichte er damit, daß Lino die Hand von seinem Knie nahm und ins Lenkrad griff. Marcello atmete erleichtert auf.
Da war die Landstraße zwischen den Umfassungsmauern und den Hecken. Da war die Einfahrt mit dem grüngestrichenen Gitter. Da war der Zufahrtsweg, flankiert von zerzausten Zypressen, und ganz hinten das Glitzern der Verandafenster. Genau wie das letzte Mal wühlte der Wind in den Baumkronen, und der Himmel war gewittrig dunkel.
Der Wagen hielt an. Lino sprang hinaus und half Marcello beim Aussteigen. Dann ging er mit ihm auf das Tor der Villa zu. Heute schritt Lino nicht voraus, sondern hielt Marcello fest beim Arm, als fürchtete er, der Junge könnte ihm davonlaufen. Marcello wollte Lino sagen, er solle ihn weniger festhalten, aber er kam gar nicht dazu: Lino eilte mit ihm durch den Salon und stieß ihn in den Korridor. Dort packte er ihn ganz unvermutet beim Hals und sagte: »Dummkopf! Warum wolltest du nicht kommen?«
Seine Stimme war nicht mehr scherzhaft, sondern rauh und gebrochen, wenngleich noch immer irgendwie zärtlich. Überrascht wollte Marcello zu ihm aufsehen, erhielt aber einen heftigen Stoß.
Lino hatte ihn wie eine Katze oder einen Hund beim Nacken gepackt und ins Zimmer geschleudert.
Dann sah Marcello, wie Lino den Schlüssel im Schloß umdrehte und einsteckte. Nun wandte sich Lino ihm zu. Auf seinem Gesicht stand ein aus Freude und Wut gemischter Ausdruck. Laut rief er: »Jetzt ist’s Schluß! Du wirst das tun, was ich will! Schluß, Marcello! Tyrann! Kleines Luder! Schluß! Du gehorchst! Und nicht ein Wort mehr!« Dies alles rief er in einer wollüstigen, wilden Freude aus – befehlend und gleichzeitig voll Verachtung. Marcello war bestürzt. Trotz dieser Bestürzung fiel ihm auf, daß Linos Worte gar nicht aus einer Absicht, einer Überlegung herzurühren schienen. Sie wirkten eher wie die sinnlosen Strophen eines Triumphgesanges. Tief erschrocken sah er, wie Lino mit großen Schritten im Zimmer hin und her ging: Er nahm die Mütze vom Kopf und warf sie aufs Fensterbrett; er ballte ein Hemd, das über einem Stuhl hing, zu einem Knäuel zusammen und warf es in ein Schubfach; er strich die Bettdecke glatt. Dann sah Marcello, wie Lino – noch immer unter wirren Reden – das Kruzifix über dem Bett abnahm und mit übertriebener Brutalität in eine Lade warf. Marcello begriff, daß Lino mit dieser Geste zu verstehen gab, er habe nun die letzten Skrupel beiseite geschoben. Als wolle er Marcello in dieser Befürchtung noch bestärken, entnahm er dem Nachttischchen die so begehrte Pistole, zeigte sie dem Knaben und rief: »Siehst du sie? Nie wirst du sie bekommen! Du mußt tun, was ich will – aber ohne Geschenke, ohne Pistole –, aus Liebe oder mit Gewalt!«
Es ist also wahr, dachte Marcello, Lino will mich betrügen, das habe ich doch befürchtet! Er fühlte, wie er vor Wut kreideweiß wurde. »Gib mir die Pistole!« sagte er. »Oder ich gehe!«
»Nichts da! Mit Liebe oder mit Gewalt!« In der einen Hand hielt Lino die Pistole, mit der anderen packte er jetzt Marcello beim Arm und riß ihn aufs Bett nieder. Marcello fiel so heftig hintenüber, daß er mit dem Kopf an die Mauer schlug. Sogleich wechselte Lino von der Gewalttätigkeit zur Zärtlichkeit, vom Befehl zum Flehen hinüber: Er kniete vor Marcello nieder. Mit einem Arm umschlang er dessen Beine. Sein anderer Arm lag auf der Bettdecke. Die Pistole hielt er noch immer zwischen den Fingern. Lino stöhnte und rief Marcello beim Namen. Dann ließ er die Pistole los – schwarz hob sie sich gegen das Weiß der Bettdecke ab. Immer noch stöhnend umschlang Lino die Knie des Knaben mit beiden Armen. Marcello blickte dem vor ihm knienden Lino in das aufgehobene flehende, von Tränen gebadete Gesicht, auf dem die Begierde flammte. Nun senkte Lino das Gesicht und rieb es an Marcellos Beinen – wie dies treue Hunde mit ihrer Schnauze zu tun pflegen.
Marcello ergriff die Pistole. Er stand mit einem Ruck auf. Lino .– offensichtlich im Glauben, Marcello wolle seine Umarmung erwidern – ließ von ihm ab. Marcello trat einen Schritt in die Mitte des Zimmers und wandte sich um.
Wenn Marcello später an das Geschehene zurückdachte, erinnerte er sich, daß die bloße Berührung des kalten Pistolenschaftes eine erbarmungslose Versuchung in ihm geweckt hatte: Lust auf Blut. In diesem Augenblick allerdings spürte er nichts als einen heftigen Schmerz, weil er mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen war. Zugleich war er gereizt und empfand – eine heftige Abneigung gegen Lino. Dieser kniete noch immer vor dem Bett. Als er sah, daß Marcello mit der Pistole auf ihn zielte, wandte er sich vollends um. Er breitete die Arme mit einer theatralischen Geste aus und rief, ohne sich zu erheben, im Ton eines Schmierenkomödianten: »Schieß, Marcello! Schieß mich tot! Schieß mich tot wie einen Hund!«
Marcello fühlte, daß er Lino noch nie so gehaßt hatte wie gerade jetzt: Was für eine abstoßende Mischung aus Sinnlichkeit und Strenge, Reue und Gier! Ihm war, als müsse er die Bitte Linos erfüllen. Also drückte er, entsetzt und bewußt zugleich, auf den Abzug.
Der Knall hallte heftig in dem kleinen Raum. Marcello sah, wie Lino zur Seite fiel, sich wieder erhob, ihm den Rücken zuwandte, mit beiden Händen den Rand des Bettes umklammerte. Dann zog er sich langsam in die Höhe, fiel seitwärts auf das Bett, rührte sich nicht mehr.
Marcello trat an ihn heran, legte die Pistole beiseite und rief halblaut: »Lino!« Darauf ging er sofort, ohne eine Antwort abzuwarten, zur Tür. Da fiel ihm ein, daß die Tür versperrt war, daß Lino den Schlüssel abgezogen und eingesteckt hatte. Marcello zögerte. Es widerstrebte ihm, in die Taschen des Toten zu greifen.
Plötzlich fiel sein Blick auf das Fenster. Er erinnerte sich, daß er sich im Erdgeschoß befand, schwang das Bein über das Fensterbrett und sah sich hastig um. Er wußte: Wenn jemand in diesem Augenblick vorbeikommt, bin ich hier auf dem Fensterbrett zu sehen. Aber es gab keinen anderen Ausweg für ihn. Doch niemand war zu erblicken. Jenseits der spärlichen Bäume, die den Vorplatz umstanden, schien das kühle, hügelige Land weithin verlassen.
Marcello sprang hinunter, nahm das Bücherpaket aus dem Wagen, schritt ohne Hast dem Gartentor zu. Vor sich sah er in Gedanken – wie in einem Spiegel – das eigene Bild: Ein junge in kurzen Hosen, seine Bücher unter dem Arm, geht einen mit Zypressen bestandenen Weg entlang. Eine unverständliche Figur voller Angst und böser Ahnungen.