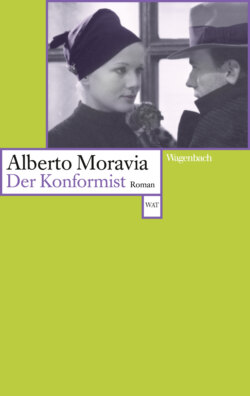Читать книгу Der Konformist - Alberto Moravia - Страница 4
Zweites Kapitel
ОглавлениеDie Köchin hatte gesagt: »Erst erschlägt man eine Katze und zuletzt einen Menschen …« Der Schrecken vor dieser Schicksalhaftigkeit verblaßte bei Marcello während der Sommerferien am Meer, und die ganze Angelegenheit wurde beinahe bedeutungslos. Er dachte zwar noch an den undurchschaubaren grausamen Mechanismus, in dem sein Leben für ein paar Tage gefangen gewesen war, sagte sich aber: Es hat sich nur um ein Alarmsignal gehandelt, jedoch nicht um eine unannehmbare Verurteilung, wie ich das eine Weile befürchtete.
Die Tage verstrichen in Heiterkeit, Sonne und im Rausch der salzigen Meerluft. Es gab Zerstreuungen und Entdeckungen. Marcello kam sich mit jedem Tag mehr als ein Sieger vor: im Kampf gegen ein dunkles, bösartiges, tragisches Verhängnis, das ihn gegen seinen Willen erst zu der Zerstörung der Blumen, dann zum Eidechsengemetzel und schließlich bis zum Mordversuch an Roberto getrieben hatte. Allerdings spürte er, daß jene Macht immer noch gegenwärtig war und immer noch drohte, nur hatte sie ihn nicht mehr direkt in ihren Krallen. Er benahm sich wie in Angstträumen: Man versucht, einem Ungetüm zu entgehen, indem man sich schlafend stellt. Wenn man schon eine drohende Gefahr nicht beseitigen kann, überlegte er, ist es weise, sich wie im Traum zu verhalten.
Der Sommer wurde einer der ausgelassensten, wenn nicht sogar glücklichsten in seinem Leben überhaupt. Es war der letzte Sommer, in dem er noch ein Kind war – ohne einen Widerwillen gegen seine Kindlichkeit zu verspüren.
Zum Teil hing seine Gelöstheit einfach mit seinem Knabenalter zusammen, zum Teil rührte sie aber auch von dem Willen her, um jeden Preis aus der verdammten schicksalhaften Vorausbestimmung zu entfliehen. Er fragte sich nicht, was ihn dazu trieb, zehnmal an einem Vormittag ins Wasser zu springen, mit den wildesten Spielkameraden zu wetteifern, stundenlang auf dem sonnenüberglühten Meer zu rudern, kurzum, alles, was er tat, mit übersteigertem Eifer zu tun. Es war derselbe Impuls, der ihn veranlaßt hatte, die Spießgesellenschaft Robertos nach dem Eidechsenmord zu suchen, die Bestrafung durch die Eltern nach der Tötung der Katze herbeizusehnen: das Bedürfnis nach Normalität und der Wunsch, sich einer allgemein anerkannten Regel anzupassen, also allen anderen gleich zu sein. Denn Anderssein bedeutete ja soviel wie Schuldigsein. Mitunter freilich verriet sich das Gewollte und Künstliche seines Verhaltens in einer plötzlich aufzuckenden schmerzlichen Erinnerung. Er sah wieder die tote Katze zwischen den weiß-violetten Irisblüten in Robertos Garten liegen. Und er erschrak wie ein Schuldner, der im Geist aufs neue seine Unterschrift auf seinem Schuldschein erblickt. Hatte er vielleicht doch mit jener Katzenleiche eine dunkle, fürchterliche Verpflichtung auf sich genommen, der er sich früher oder später nicht würde entziehen können? Auch dann nicht, wenn er sich tief in der Erde verstecken oder über den Ozean entfliehen würde, um seine Spuren zu verwischen?
In solchen Augenblicken tröstete er sich mit dem Gedanken, daß ja zwei, drei Monate schon vergangen waren. Bald würden Jahre vorüber sein. Es kam vor allem darauf an, viel Zeit verstreichen zu lassen, ohne das Ungeheuer zu reizen. Solche Anfälle von Gewissensnöten wurden aber immer seltener und hörten gegen Ende des Sommers völlig auf. Als Marcello schließlich nach Rom zurückkehrte, hatte sich die Katzenepisode und alles, was vorher geschehen war, in seiner Erinnerung fast verflüchtigt. Sie war verblichen, beinahe durchscheinend geworden wie eine in einem anderen Leben gemachte Erfahrung. Sie reichte nur noch als ein folgenloses Ereignis in seine jetzige Existenz hinein, an das ihn keine Verantwortung mehr band.
Nicht wenig trug zu diesem Vergessen auch der Umstand bei, daß er nun in die Schule eintrat. Ein aufregendes Erlebnis! Bisher hatte Marcello zu Hause gelernt. In diesem Jahr begann für ihn die öffentliche Schule. Alles war ihm dort neu: die Mitschüler, die Lehrer, die Klassenzimmer, die Stundenpläne. Unter diesen verschiedenartigsten Eindrücken zog ihn ein Element – nach dem ungeordneten Leben, dem Fehlen jeder festen Regel und seiner Einsamkeit zu Hause – am meisten an, nämlich das der Ordnung und der Disziplin. Auch die Tatsache, daß allen Beschäftigungen gemeinsam nachgegangen wurde, befriedigte ihn. Die Schule glich ein wenig jenem Institut, von dem er einmal geträumt hatte. Doch sie enthielt nur die erfreulichen Seiten seines Traums, sie war kein Gefängnis und ohne jeden demütigenden Zwang. Marcello merkte bald, daß ihm das Schulleben zutiefst zusagte. Es freute ihn, morgens pünktlich aufzustehen, sich rasch zu waschen und anzukleiden, sein Bücherpaket fest zu schnüren und in Wachstuch zu verpacken und dann in Eile der Schule zuzustreben. Es freute ihn, mit der Schar der Kameraden in das alte Gymnasium einzufallen, die schmutzigen Treppen hinaufzulaufen, die düsteren, hallenden Gänge entlangzurasen und dann im Klassenzimmer zu stehen, wo sich die Reihen der Bänke befanden und das Katheder thronte. Vor allem aber gefiel ihm das Ritual der Unterrichtsstunden: der Eintritt des Lehrers, das Aufrufen der Namen, der Wetteifer mit den Kameraden bei der Beantwortung der gestellten Fragen, die Prüfungen, der Erfolg oder Mißerfolg, der ruhige, unpersönliche Ton der Lehrer.
Dennoch war Marcello ein mittelmäßiger Schüler, in verschiedenen Fächern sogar einer der schlechtesten. Denn was er an der Schule liebte, war ja nicht die Arbeit, sondern die ganz neue und seiner Wesensart besser entsprechende Lebensform – die Normalität. Um so mehr, da sie im Schulbetrieb nicht etwas Zufälliges, von den Vorlieben und natürlichen Neigungen Abhängiges war, sondern eine festgelegte Regel, unparteiisch und getragen von nicht zu bezweifelnden Gesetzen.
Seine mangelnde Erfahrung und Naivität aber machten ihn ungeschickt und unsicher, wenn er es mit jenen anderen Regeln zu tun bekam, die jenseits der Schuldisziplin das Verhalten der Schüler untereinander bestimmten. Auch diese anderen Regeln waren ein Aspekt der neuen Normalität; jedoch wurde er mit ihnen viel schwerer fertig. Das wurde ihm zum ersten Mal bewußt, als er zum Katheder gerufen wurde, um seine schriftliche Arbeit vorzuweisen: Der Lehrer nahm ihm das Heft aus der Hand, legte es aufs Pult und begann zu lesen. Marcello, an die familiären, formlosen Beziehungen zu den Lehrerinnen gewöhnt, die ihn zu Hause unterrichtet hatten, blieb nicht etwa abseits auf dem Podium stehen, sondern legte einen Arm um die Schulter des Lehrers und – Kopf an Kopf – begann er, mit ihm die Aufgabe durchzusehen. Ohne jede sichtbare Verwunderung beschränkte sich der Lehrer darauf, Marcellos Arm fortzuschieben. Daraufhin brach die ganze Klasse in schallendes Gelächter aus. In diesem Gelächter glaubte Marcello eine Mißbilligung zu erkennen, die anders und viel weniger duldsam und verständnisvoll war als die des Lehrers. Später, als er sich nicht mehr so sehr schämte, sagte er sich, daß er mit jener naiven Geste gleich zwei verschiedenen Regeln zuwidergehandelt hatte: der Regel der Schule, die Disziplin und Respekt vor dem Lehrer forderte, und der Regel der Schüler, die von ihm Verschlagenheit und Verschlossenheit verlangte. Und was das Sonderbare war: Diese beiden Regeln widersprachen einander nicht, sondern ergänzten sich in geheimnisvoller Weise.
Er begriff, daß es zwar recht leicht war, in kurzer Zeit ein ordentlicher Schüler zu werden, daß es aber viel schwieriger war, sich zu einem gerissenen, unverfrorenen Mitschüler zu entwickeln. Was dieser Umwandlung im Wege stand, war seine mangelnde Erfahrung, seine bisherige Lebensweise und nicht zuletzt auch seine körperliche Erscheinung. Marcello hatte von seiner Mutter regelmäßige und zarte Gesichtszüge von einer fast raffinierten Vollkommenheit geerbt: Er hatte ein rundes Gesicht mit zarten, gebräunten Wangen, eine kleine Nase, einen geschweiften, launischen Mund, ein deutlich gekennzeichnetes Kinn. Unter den in die Stirn hängenden kastanienbraunen Haaren saßen zwei graublaue Augen von etwas dunklem, doch zugleich umschuldigem und zärtlichem Ausdruck. Es war beinahe ein Mädchengesicht. Die derben Jungen in seiner Klasse hätten das wahrscheinlich gar nicht beachtet, wenn Marcellos sanfte Schönheit nicht durch einige ausgesprochen weibliche Kennzeichen unterstrichen worden wäre. So aber konnte man sich wirklich fragen, ob man es hier mit einem Mädchen zu tun hatte, das als Junge verkleidet herumging: Marcello errötete ungewöhnlich leicht, hatte eine nicht zu unterdrückende Neigung, zärtliche Gefühle durch zärtliche Gesten auszudrücken, und sein Wunsch, zu gefallen, war so lebhaft, daß er bis zur Servilität und Koketterie führte. Diese weiblichen Kennzeichen waren Marcello bisher nicht bewußt geworden. Als er schließlich merkte, womit er sich in den Augen seiner Mitschüler lächerlich machte, war es bereits zu spät. Selbst wenn er jetzt imstande gewesen wäre, sich zu beherrschen, hätte er doch seinen Ruf, ein Mädchen in Hosen zu sein, nicht mehr ändern können.
Seine Mitschüler verspotteten ihn dauernd, geradezu automatisch, als wären seine femininen Züge bereits jenseits aller Diskussion. Bald fragten sie ihn mit geheucheltem Ernst, warum er denn nicht in einer Mädchenklasse sitze und wie er auf die Idee verfallen sei, Hosen statt eines Kleides anzuziehen. Bald wollten sie wissen, wie er daheim seine Zeit verbringe. Mit Stricken oder mit Puppenspiel? Bald erkundigten sie sich, warum seine Ohrläppchen nicht durchlöchert seien wie bei den Mädchen. Einmal fand er unter seiner Bank ein Stück Stoff mit Nadel und Fingerhut: eine klare Aufforderung, sich doch mit einer Näharbeit zu beschäftigen. Ein anderes Mal legten sie ihm ein Puderschächtelchen aufs Pult. Dann fand er auf seinem Platz sogar einen rosafarbenen Büstenhalter, den einer der Jungen seiner älteren Schwester entwendet hatte. Und von allem Anfang an hatten sie seinen Vornamen mit einem weiblichen Diminutiv versehen und nannten ihn Marcellina.
Allen diesen Hänseleien gegenüber empfand Marcello eine Mischung aus Ärger und einer Art geschmeichelter Befriedigung, als sei ein Teil seiner selbst darüber gar nicht böse. Er hätte nicht sagen können, ob er über die Ursache der Hänseleien befriedigt war oder einfach über die Tatsache, daß sich seine Kameraden überhaupt mit ihm beschäftigten. Eines Tages jedoch empfingen sie ihn mit dem Gewisper: »Marcellina … Marcellina, ist das wahr, daß du Mädchenhöschen trägst?« Da erhob er sich und beschwerte sich in dem plötzlich eingetretenen Schweigen der Klasse. Mit lauter Stimme sagte er, daß er immer mit einem weiblichen Spitznamen gerufen werde.
Der Lehrer, ein stattlicher Mann mit Bart, hörte ihn lächelnd an und fragte dann:
»Du wirst mit einem weiblichen Spitznamen gerufen? Wie lautet er denn?«
»Marcellina«, antwortete Marcello.
»Und das ist dir nicht recht?«
»Nein, weil ich doch ein Junge bin!«
»Komm her!« sagte der Lehrer. Marcello gehorchte und stellte sich neben das Katheder. »Jetzt zeig der Klasse deine Muskeln«, forderte ihn der Lehrer freundlich auf. Gehorsam beugte Marcello den Arm und ließ den Bizeps schwellen. Der Lehrer neigte sich zu ihm hinüber, betastete Marcellos Oberarm, machte ein spöttisch-beifälliges Gesicht und erklärte dann, zu der Klasse gewandt: »Wie ihr sehen könnt, ist Marcello ein kräftiger Junge und bereit zu beweisen, daß er kein Mädchen ist. Wer fordert ihn zum Zweikampf heraus?«
Ein langes Schweigen folgte. Der Lehrer ließ den Blick durch die Klasse schweifen und sagte: »Niemand? Daraus ist zu ersehen, daß ihr vor ihm Angst habt. Also hört auf, ihn Marcellina zu nennen!«
Die ganze Klasse brach in Gelächter aus. Mit rotem Kopf kehrte Marcello in seine Bank zurück. Aber von diesem Tag an hörten die Hänseleien nicht etwa auf, sondern verdoppelten sich. Es war Marcello bei seinen Kameraden nur abträglich gewesen, daß er gepetzt und damit die stillschweigenden Regeln ihrer Kameradschaft gebrochen hatte.
Marcello begriff, daß er – um dem Spott ein Ende zu machen .– den Jungen beweisen mußte, wie wenig mädchenhaft er in Wirklichkeit war. Allerdings wußte er, daß es keinen Zweck haben würde, nur seine Muskeln vorzuzeigen, wenn auch der Lehrer dieser Meinung gewesen war. Um einen wirklichen Beweis zu erbringen, war etwas Ungewöhnliches erforderlich, was den Kameraden imponieren, was ihre Bewunderung wecken mußte. Was aber?
Ganz allgemein dachte er an eine Handlung oder einen Gegenstand, womit die Vorstellung von Kraft, Männlichkeit, wenn nicht gar Brutalität verbunden war. Er hatte gemerkt, daß die Kameraden einen gewissen Avanzini bewunderten, der ein Paar lederne Boxhandschuhe besaß. Avanzini, ein schmächtiger blonder Junge, konnte mit diesen Boxhandschuhen gar nicht umgehen. Trotzdem hatten sie ihm eine besondere Wertschätzung eingetragen. Ähnlich bewundert wurde auch ein gewisser Pugliese, der behauptete, einen unfehlbaren Griff der japanischen Ringkämpfertechnik zu kennen, mit dem man jeden Gegner fällen könne. Diesen Griff hatte zwar noch niemand gesehen, was die Jungen aber nicht hinderte, Pugliese ebenso zu bewundern wie Avanzini. Marcello begriff also, daß er sobald wie möglich einen Gegenstand wie die Boxhandschuhe herzeigen oder eine Fertigkeit wie diesen japanischen Ringergriff vortäuschen müsse. Zugleich aber war ihm klar, daß es sich um nichts Dilettantisches handeln dürfe wie bei Avanzini oder Pugliese. Er gehörte, wie er deutlich spürte, zu den Menschen, die das Leben und seine Verpflichtungen ernst nahmen. An Stelle von Avanzini hätte er seinem Gegner die Nase kaputtgeschlagen, an Stelle von Pugliese ihm den Hals gebrochen. Angesichts dieser beiden Jungen erfüllte ihn seine Unfähigkeit zu oberflächlicher Rhetorik mit einem unbestimmten Mißtrauen gegen sich selbst: Er wollte zwar den Kameraden einen Beweis für seine Kraft liefern – das schienen sie ja als Preis für ihre Achtung von ihm zu fordern –, hatte aber vor diesem Beweis irgendwie Angst.
Eines Tages bemerkte er, daß die Jungen, die ihn besonders eifrig zu hänseln pflegten, mehrmals untereinander tuschelten. Er glaubte ihren Blicken entnehmen zu müssen, es sei wieder ein neuer Streich gegen ihn geplant. Aber die Unterrichtsstunde verlief ohne jeden Zwischenfall. Als das Schlußzeichen ertönte, machte sich Marcello auf den Heimweg. Er blickte sich nicht um. Es war Anfang November, stürmisch, aber mild. Die letzte duftende Wärme des vergangenen Sommers schien sich mit der ersten, noch ungewissen Strenge des Herbstes zu vereinen. Marcello spürte eine dunkle Erregung. Es war ihm, als entwickle heute die Natur eine zerstörerische, mörderische Wut, nicht unähnlich der, die ihn selbst ein paar Monate zuvor veranlaßt hatte, Blumen zu köpfen und Eidechsen zu töten. Der Sommer war eine gleichmäßige, vollkommene Jahreszeit gewesen mit heiterem Himmel, dichtbelaubten Bäumen und Sträuchern voller Vögel. Jetzt sah Marcello mit Genuß, wie der Herbstwind diese Vollkommenheit zerriß, zerfetzte, wie er dunkle Wolken über den Himmel jagte, die Blätter von den Bäumen fegte und auf dem Boden in Wirbeln umhertrieb, wie er die Vögel verscheuchte, daß sie in schwarzen Schwärmen zwischen Blättern und Wolken das Weite suchten.
An einer Straßenecke bemerkte er, daß eine Gruppe von fünf Kameraden hinter ihm herging. Es war gar nicht zu bezweifeln, daß sie ihn verfolgten, denn zwei von ihnen wohnten in der entgegengesetzten Richtung. Doch in seine herbstlichen Empfindungen versunken, achtete Marcello zunächst nicht weiter darauf. Er hatte es nämlich eilig, zu der großen Platanenallee zu gelangen. Von dort führte eine Seitenstraße zum Hause seiner Eltern. In jener Allee, so wußte er, häuften sich die welken Blätter gelb und raschelnd auf den Gehsteigen, und im voraus genoß er das Vergnügen, mit beiden Füßen in diesen Herbstblättern herumzuwühlen.
Wie zum Spaß suchte er nun seine Verfolger abzuschütteln, indem er bald in ein Haustor trat, bald sich unter die Menge der übrigen Passanten mischte. Doch er mußte feststellen, daß ihn die fünf nach kurzem Suchen immer wieder fanden. Jetzt war die Allee schon ganz nahe. Marcello wollte sich nicht beim Spiel mit den welken Blättern beobachten lassen und beschloß daher, den Kameraden bereits vorher entgegenzutreten. Also wandte er sich um und fragte: »Warum geht ihr mir nach?«
Einer der fünf, ein Blonder mit scharfgeschnittenem Gesicht und kahlgeschorenem Kopf, antwortete prompt: »Wir gehen dir gar nicht nach. Die Straße ist doch für alle da, nicht?«
Marcello erwiderte nichts und setzte seinen Weg fort. Da war die Allee: zwei Reihen riesiger, kahler Platanen, dahinter die vielfenstrigen Häuser. Und da lagen auch die gelben, welken Blätter, in den Rinnsalen zu Haufen getürmt, auf dem schwarzen Asphalt verstreut, gelb wie Gold. Die fünf waren nicht mehr zu sehen, vielleicht hatten sie die Verfolgung aufgegeben. Marcello glaubte sich ganz allein in der breiten, menschenleeren Allee. Ohne Eile trat er nun mitten hinein in die Herbstblätter, schritt darin vorwärts und freute sich, daß seine Beine bis zu den Knien in der raschelnden Laubmasse versanken. Als er sich bückte, um eine Handvoll Blätter aufzuheben und in die Luft zu werfen, hörte er von neuem die spöttischen Stimmen: »Marcellina … Marcellina … zeig deine Höschen …!«
Da überkam ihn der beinahe wollüstige Wunsch, sich zu prügeln. Hochaufgerichtet ging er mit Entschiedenheit seinen Verfolgern entgegen und sagte: »Wollt ihr jetzt abhauen – ja oder nein?« Statt einer Antwort warfen sich alle fünf auf ihn. Marcello hatte irgendwie gehofft, so kämpfen zu können wie die Horatier und die Kuriatier in der Legende. Hin und her laufend wollte er bald den einen, bald den anderen mit einem kräftigen Schlag erledigen und sie so alle zusammen dahin bringen, von ihm abzulassen. Das aber war, wie er sofort merkte, unausführbar. Die fünf hatten sich in weiser Voraussicht gleichzeitig auf ihn gestürzt, einer hielt ihn an den Armen, ein anderer an den Beinen fest, zwei hingen um seine Leibesmitte. Der fünfte jedoch, wie Marcello sah, öffnete hastig ein Paket. Dem entnahm er ein Kinderröckchen aus blauem Kattun.
Alle lachten jetzt, während sie ihn eisern festhielten. Der mit dem Röckchen in der Hand sagte: »Komm, Marcellina, wehr dich nicht. Wir ziehen dir nur das Röckchen an und lassen dich dann zu Mutti laufen.«
Das war genau der Scherz, den Marcello befürchtet hatte. Mit purpurrotem Kopf schlug er wütend um sich, aber die fünf zusammen waren natürlich stärker als er. Zwar gelang es ihm, einem das Gesicht zu zerkratzen, einem anderen einen Fausthieb in den Magen zu versetzen; aber er spürte doch, wie seine Bewegungsfreiheit immer weiter eingeengt wurde. »Laßt mich … ihr Idioten! Laßt … mich …!« stöhnte er. Daraufhin stießen seine Peiniger ein Triumphgeschrei aus, denn das Röckchen glitt über Marcellos Kopf. Seine Proteste verloren sich wie in einer Art Sack. Er strampelte ohne Erfolg. Geschickt schoben die Jungen den Rock immer weiter herunter, bis er auf den Hüften saß. Dann spürte Marcello, wie sie in seinem Rücken die Bänder knoteten.
Auf einmal hörte er eine ruhige Männerstimme, die mehr neugierig als vorwurfsvoll fragte: »Darf man wissen, was ihr da treibt?« Sogleich ließen die fünf von Marcello ab und liefen davon. Er fand sich plötzlich allein – noch keuchend und blutrot im Gesicht, den Rock fest um die Hüften gebunden. Er hob den Blick und sah vor sich den Mann stehen, der die Kameraden vertrieben hatte. Der Unbekannte trug eine dunkelgraue Uniform mit hochgeschlossenem Kragen, war bleich und hager, hatte tiefliegende Augen, eine große traurige Nase, einen verächtlichen Ausdruck um den Mund und Haare im Bürstenschnitt. Auf den ersten Blick wirkte er beinahe übertrieben streng, dann aber entdeckte Marcello einige Züge an diesem Fremden, die alles andere als streng waren: etwas Weiches, Verlebtes in den Mundwinkeln, eine Unsicherheit der ganzen Haltung.
Jetzt bückte sich der Unbekannte, hob die Bücher auf, die Marcello während des Kampfes hatte zu Boden fallen lassen, reichte sie ihm und fragte:
»Was wollten sie dir denn antun?«
Seine Stimme schien zwar genauso streng zu sein wie sein Gesicht, doch hörte Marcello aus dem Ton des Fremden eine mühsam zurückgedrängte Weichheit heraus. Gereizt antwortete er: »Sie treiben immer ihren Unfug mit mir, diese Idioten!« Zugleich bemühte er sich, den Knoten des Röckchens auf seinem Rücken zu lösen.
»Warte«, sagte der Mann, bückte sich und knöpfte den Knoten auf. Der Rock fiel zu Boden, Marcello stieg heraus und beförderte ihn mit einem Fußtritt auf den nächsten Blätterhaufen.
Irgendwie schüchtern erkundigte sich der Mann: »Du wolltest wohl gerade nach Hause gehen?« Marcello sah zu ihm auf und antwortete: »Ja.«
»Schön«, sagte der Mann, »ich bring dich heim. Im Auto.« Er deutete nach einem großen Wagen, der in einiger Entfernung am Rand des Gehsteigs geparkt war. Marcello besah sich den Wagen. Es war eine Marke, die er nicht kannte, vielleicht eine ausländische. Das Auto war lang, schwarz und sah altmodisch aus. Marcello überlegte, ob der Mann nicht vor der Annäherung mit Absicht den Wagen dort drüben geparkt habe. Der Knabe zögerte mit der Antwort. »Komm«, drängte der Mann, »los! Ich mache mit dir eine schöne Spazierfahrt. Und dann bring ich dich heim. Ist dir das recht?«
Marcello wollte ablehnen, denn er spürte, daß er eigentlich ablehnen müsse. Doch er kam nicht mehr dazu, den Mund aufzumachen. Der Mann nahm ihm das Bücherpaket einfach aus der Hand und sagte: »Das trag ich dir.« Darauf ging er auf das Auto zu. Marcello folgte ihm, etwas betroffen von der eigenen Fügsamkeit, doch nicht lustlos. Der Mann öffnete den Schlag, warf die Bücher auf den Rücksitz, setzte sich ans Lenkrad, bedeutete Marcello, neben ihm Platz zu nehmen. Dann schloß er den Schlag, streifte Handschuhe über und ließ den Motor an.
Majestätisch, ohne Hast, glitt der Wagen leise surrend die baumbestandene Allee entlang. Es ist wirklich ein Wagen alten Typs, dachte Marcello, doch vorzüglich gehalten, mit Liebe blank geputzt. Die Metallteile blitzten. Der Mann hielt das Lenkrad mit der einen Hand und griff mit der anderen nach einer Schirmmütze, die er aufsetzte. Die Mütze verstärkte sein strenges Aussehen noch, gab ihm nahezu einen militärischen Anstrich.
Verlegen fragte Marcello: »Gehört der Wagen Ihnen?«
»Kannst ruhig ›du‹ zu mir sagen«, erwiderte der Mann, ohne Marcello anzublicken. Er hupte, und das Signal klang ebenso ernst und altmodisch, wie der Wagen aussah. »Nein, der gehört nicht mir. Er gehört meinem Brotgeber. Ich bin der Chauffeur.«
Marcello antwortete nicht. Der Mann, dessen Gesicht nur im Profil zu sehen war, lenkte den Wagen mit gelöster, eleganter Präzision und fragte: »Bist du enttäuscht, daß ich nicht der Besitzer bin? Schämst du dich?«
Marcello protestierte lebhaft: »Aber nein. Warum sollte ich?«
Der Mann lächelte befriedigt und beschleunigte das Tempo. »Jetzt fahren wir ein wenig auf den Berg«, sagte er. »Auf den Monte Mario. Ist’s recht?«
»Dort bin ich noch nie gewesen«, erwiderte Marcello.
Der Mann sagte: »Dort ist es schön. Man hat einen Blick über die ganze Stadt.« Nach einem Augenblick des Schweigens fragte er sanft: »Wie heißt du?«
»Marcello.«
»Ja«, sagte der Mann zu sich selbst. »Stimmt. Deine Kameraden riefen dich Marcellina. Ich heiße Pasquale.«
Als Marcello gerade dachte, daß Pasquale ein lächerlicher Name sei, sagte er Mann: »Das ist aber ein lächerlicher Name. Nenne mich Lino.« Es schien, als habe der andere seine Gedanken erraten.
Jetzt durchquerte das Auto die breiten schmutzigen Straßen eines Vorstadtviertels mit häßlichen Mietskasernen. Gruppen von Gassenjungen, die mitten auf der Fahrbahn spielten, stoben zur Seite. Vom Gehsteig aus schauten zerraufte Frauen und Männer in zerfetzter Kleidung dem ungewohnten Wagen nach. Beschämt durch das Verhalten dieser Menschen schlug Marcello die Augen nieder. »Das ist der Testaccio«, sagte der Mann. »Aber gleich kommen wir auf den Monte Mario.« Der Wagen verließ das armselige Viertel und fuhr nun auf einer breiten Straße hinter einer Straßenbahn her. Die Häuserreihen zu beiden Seiten stiegen, wie die Straße mit ihren dauernden Kurven, empor.
»Um wieviel Uhr mußt du daheim sein?«
»Ich habe Zeit«, antwortete Marcello, »Vor zwei Uhr essen wir nie.«
»Wer erwartet dich daheim? Vater und Mutter?«
»Ja.«
»Hast du auch Geschwister?«
»Nein.«
»Und was tut dein Papa?«
»Er tut nichts«, erwiderte Marcello ein wenig unsicher.
In einer Kurve überholte der Wagen die Straßenbahn. Um die Kurve möglichst eng zu nehmen, griff der Mann mit beiden Armen ins Lenkrad, ohne dabei den Oberkörper zu bewegen, was eine elegante Geschicklichkeit verriet. Dann fuhr der Wagen, noch immer in der Steigung, an hohen grasbewachsenen Mauern, an Holundersträuchern und Villentoren vorbei. Da und dort verriet ein mit venezianischen Lämpchen verzierter Eingang oder ein Bogen mit ochsenblutroter Aufschrift das Vorhandensein eines Restaurants oder einer ländlichen Osteria.
Lino fragte plötzlich: »Machen dir dein Papa und deine Mama manchmal Geschenke?«
»Ja, manchmal …« erwiderte Marcello etwas unbestimmt.
»Viele oder wenige?«
Marcello wollte nicht eingestehen, daß er zu Haus mit Geschenken nur spärlich bedacht wurde. Bisweilen liefen sogar die Feiertage ganz ohne Geschenke ab.
Also beschränkte er sich darauf zu antworten: »Na ja, es geht …«
»Macht es dir Freude, Geschenke zu bekommen?« fragte Lino, öffnete eine Klappe am Armaturenbrett, zog einen gelben Lappen hervor und putzte damit die Windschutzscheibe.
Marcello sah ihn an. Der Mann hatte ihm noch immer das Profil zugewandt, saß aufrecht da, den Mützenschirm fast über die Augen gezogen.
»Ja«, sagte Marcello obenhin. »Es macht mir Freude …«
»Und was für ein Geschenk hättest du jetzt gern – zum Beispiel …?«
Diesmal war der Sinn der Frage eindeutig: Marcello begriff, daß dieser geheimnisvolle Lino ihm aus irgendwelchen Gründen ein Geschenk machen wollte. Mit einemmal fiel ihm die Anziehung ein, die alle Waffen auf ihn ausübten. Gleichzeitig wurde ihm blitzartig klar, daß der Besitz einer wirklichen Waffe ihm die Achtung seiner Mitschüler sichern würde. In dem Gefühl, mehr zu verlangen als billig war, antwortete er also: »Zum Beispiel einen Revolver …«
»Einen Revolver …« wiederholte der Mann ohne jedes Anzeichen von Verwunderung. »Was für einen Revolver? Einen mit Platzpatronen oder eine Luftpistole?«
»Nein«, sagte Marcello kühn, »ich meine einen echten Revolver.«
»Und was willst du mit einem echten Revolver anfangen?«
Marcello zog es vor, den wahren Grund nicht zu sagen. »Scheibenschießen«, erwiderte er, »bis ich eine unfehlbare Sicherheit bekomme.«
Marcello hatte den Eindruck, daß der Mann seine Fragen nicht so sehr aus wirklicher Neugier stellte, sondern mehr, um ihn zum Sprechen zu bringen.
»Warum ist es dir denn so wichtig, eine unfehlbare Sicherheit im Schießen zu bekommen?« wollte er jetzt wissen.
»Man kann sich damit gegen alles verteidigen«, erwiderte Marcello ernsthaft.
Der Mann schwieg einen Augenblick. Dann sagte er: »Greif in diese Tasche dort, da neben dir am Wagenschlag.« Neugierig folgte Marcello der Aufforderung. Seine Finger ertasteten die Kälte eines metallischen Gegenstandes. »Nimm ihn heraus«, befahl der Mann.
Er riß den Wagen zur Seite, um einem Hund auszuweichen, der gerade über die Straße lief.
Marcello brachte den metallischen Gegenstand zum Vorschein. Es war tatsächlich eine automatische Pistole, schwarz, flach und schwer von Zerstörung und Tod. Der Lauf reckte sich vorwärts, als werde er gleich Kugeln ausspeien. Ohne es zu wollen, umklammerte Marcello den kühlen Schaft der Waffe mit vor Vergnügen bebenden Fingern.
»Meinst du so was?« fragte Lino.
»Ja«, sagte Marcello.
»Na schön. Wenn du wirklich eine solche Pistole haben willst, schenke ich dir eine. Aber nicht diese. Die gehört zum Wagen. Eine andere. Das gleiche Modell.«
Marcello gab keine Antwort. Er kam sich vor wie in einer verwandelten Welt: in einer Märchenwelt, in der fremde Chauffeure fremde Knaben einluden, in einen Wagen zu steigen und ihnen dann Pistolen versprachen. Alles schien ungeheuer einfach geworden zu sein. Aber diese appetitanregende Einfachheit, so schien ihm, hatte doch irgendwie einen unangenehmen Beigeschmack – als sei sie, wer weiß warum, mit einer noch versteckten, aber sehr bald ans Tageslicht kommenden Schwierigkeit verbunden. Wahrscheinlich, überlegte er kühn, hatten sowohl der Chauffeur als er zwei ganz verschiedene Absichten. Er, für sein Teil, wollte jetzt in den Besitz der Pistole kommen. Linos Absicht wahr es wahrscheinlich, im Tausch für diese Pistole etwas zunächst noch Geheimnisvolles und vielleicht auch Unmögliches zu verlangen. Jetzt fragte es sich, wer von beiden aus diesem Tauschhandel den größeren Gewinn ziehen würde.
»Wohin fahren wir denn nun?« fragte Marcello.
»Zu dem Haus, wo ich wohne«, erwiderte Lino. »Die Pistole holen.«
»Und wo ist dieses Haus?«
»Wir sind schon da«, antwortete der Mann, nahm Marcello die Pistole weg und steckte sie in die Tasche.
Marcello blickte sich um: Der Wagen hielt auf einer gewöhnlichen Landstraße – Bäume, Holunderhecken, dahinter Felder und Himmel. Aber in einiger Entfernung sah man ein Gartentor mit Torbogen, zwei Säulen und einem grüngestrichenen Gitter. »Warte hier«, sagte Lino, stieg aus und ging zum Tor. Er öffnete die Torflügel und kam zurück. Marcello betrachtete ihn. Er war nicht so groß, wie er im Sitzen ausgesehen hatte. Im Verhältnis zum Oberkörper und zu den breiten Hüften waren seine Beine kurz. Lino stieg wieder in den Wagen und fuhr durch das Tor. Sie gelangten auf einen kiesbestreuten Weg, der zwischen zwei Reihen zerzauster, vom Wind geschüttelter Zypressen hindurchführte. Am Ende des Weges glitzerte etwas in einem vereinzelten Sonnenstrahl und hob sich grell gegen den Gewitterhimmel ab. Es war eine Glasveranda im Erdgeschoß eines zweistöckigen Gebäudes.
»Das ist die Villa«, sagte Lino. »Aber jetzt ist niemand da.«
»Wer ist der Besitzer?« fragte Marcello.
»Du meinst die Besitzerin«, verbesserte Lino. »Eine amerikanische Dame. Sie ist momentan in Florenz.«
Der Wagen hielt. Die lange niedrige Villa aus weißen rechteckigen Zementflächen, roten Ziegelstreifen und blitzenden Glasfenstern hatte einen Vorbau, der auf vierkantigen Pfeilern aus Naturstein ruhte.
Lino öffnete den Wagenschlag, sprang heraus und sagte: »Komm, steig aus!«
Marcello wußte nicht, was Lino von ihm wollte, und es gelang ihm auch nicht, dies zu erraten. Immer stärker aber wurde in ihm ein Mißtrauen wach und die Angst, irgendwie betrogen zu werden. »Und die Pistole?« fragte er, ohne sich zu rühren.
»Die ist dort drin«, erwiderte Lino ein wenig ungeduldig und deutete nach den Fenstern der Villa. »Jetzt gehen wir sie holen.«
»Gibst du sie mir auch wirklich?«
»Freilich! Eine schöne, neue Pistole …«
Wortlos stieg nun Marcello aus. Sogleich fiel ihn der trunkene, nach Tod riechende, staubig-warme Herbstwind an. Bei diesen Windstößen überkam ihn ein nicht zu definierendes Gefühl. Er folgte Lino, wandte sich aber einmal um und betrachtete den kiesbestreuten Vorplatz, der von Buschwerk und spärlichen Oleanderbäumen umgeben war.
Dann musterte er den vor ihm hergehenden Lino und bemerkte, daß etwas die Seitentasche seines Kittels schwellte. Natürlich, die Pistole, die ihm Lino kurz zuvor aus der Hand genommen hatte! Unvermittelt war er sicher, daß Lino nur diese eine Pistole besaß, und er fragte sich, warum sein neuer Freund ihn eigentlich belogen hatte und ihn jetzt in diese Villa lockte. Sein Mißtrauen wuchs, zugleich aber auch seine Entschlossenheit, die Augen weit offenzuhalten und sich nicht hereinlegen zu lassen. Unterdessen hatten sie ein großes Wohnzimmer betreten, in dem Sessel und Ruhebetten umherstanden. An der Rückwand befand sich ein Kamin mit roter Ziegelhaube. Lino ging noch immer voran, durchquerte den Raum und schritt auf eine blaugestrichene Tür zu.
Unruhig fragte Marcello: »Wohin gehen wir denn?«
»In mein Zimmer«, erwiderte Lino leichthin, ohne sich umzuwenden.
Marcello beschloß, jetzt zum ersten Mal Widerstand zu leisten und damit Lino zu verstehen zu geben, daß er dessen Spiel durchschaut habe. Als Lino die blaue Tür öffnete, hielt er sich entfernt und sagte: »Gib mir sofort die Pistole, sonst geh ich weg!«
»Die Pistole hab ich doch nicht bei mir«, antwortete Lino und wandte sich halb um. »Sie liegt in meinem Zimmer.«
»Natürlich hast du sie bei dir«, gab Marcello zurück. »Sie ist in deiner Jackentasche.«
»Das ist doch die aus dem Wagen!«
»Eine andere hast du gar nicht!«
Lino schien ungeduldig zu werden, unterdrückte dies aber sogleich. Wieder fiel Marcello der Gegensatz auf, den in Linos Gesicht der weichliche Mund unter den schmerzlich-flehenden Augen zu dem trockenen und strengen Gesicht bildete. »Schön, ich gebe dir diese hier«, sagte er. »Aber komm mit mir. Was macht dir denn das schon aus? Hier kann uns ja jeder von draußen sehen …«
Und wenn man uns sieht? hätte Marcello beinahe gefragt. Er schwieg aber, denn er fühlte, daß hinter Linos Worten etwas Böses stand, das er nicht begriff.
»Gut!« sagte er knabenhaft. »Aber nachher gibst du sie mir?«
»Da kannst du ganz sicher sein.«
Sie betraten einen schmalen weißen Korridor, an dessen Ende es wieder eine blaue Tür gab. Diesmal ging Lino nicht voran, sondern hielt sich an Marcellos Seite. Er schlang leicht den Arm um dessen Hüfte und fragte:
»Ist dir denn die Pistole gar so wichtig?«
»Ja«, sagte Marcello, beinahe unfähig zu sprechen, weil ihm Linos Arm so unbehaglich war.
Lino zog seinen Arm weg, öffnete die Tür und ließ Marcello eintreten. Sie befanden sich jetzt in einem langen, schmalen, weißen Raum. Ganz hinten war ein Fenster. Die Einrichtung bestand aus einem Bett, einem Tisch, einem Schrank und aus ein paar Stühlen. Alle diese Möbel waren mit hellgrüner Farbe angestrichen. Marcello bemerkte an der Wand ein bronzenes Kruzifix von der üblichen Art. Auf dem Schrank lag ein dickes, schwarzgebundenes Buch mit rotem Schnitt. Wahrscheinlich ein Gebetbuch, dachte Marcello. Sonst enthielt der Raum nichts und machte einen ungemein sauberen Eindruck. Ein starker Geruch nach einer Kölnischwasser-Seife hing in der Luft. Wo war ihm dieser Geruch schon begegnet? Möglicherweise daheim im Badezimmer, wenn seine Mutter ihre Toilette beendet hatte.
Lino sagte obenhin: »Setz dich aufs Bett. Willst du? Das ist bequemer.«
Marcello gehorchte schweigend. Lino ging jetzt im Zimmer hin und her. Er nahm die Mütze ab und legte sie aufs Fensterbrett. Dann knöpfte er den Kragen auf und wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß vom Hals. Schließlich öffnete er den Schrank und nahm eine große Flasche Kölnischwasser heraus. Er schüttete etwas davon ins Taschentuch und rieb sich dann Gesicht und Stirn ab – offenkundig erleichtert.
»Willst du auch etwas?« fragte er Marcello.
Marcello hätte am liebsten abgelehnt, denn die Flasche und das Taschentuch flößten ihm irgendwie Ekel ein. Trotzdem duldete er, daß Lino ihm mit kühler Handfläche über die Wangen strich. Darauf stellte der Mann das Kölnischwasser in den Schrank zurück und setzte sich aufs Bett neben Marcello.
Sie sahen einander an. Linos trockenes, strenges Gesicht hatte jetzt einen neuen Ausdruck: gequält, zärtlich, flehend. Er schwieg. Schließlich fragte Marcello ungeduldig, schon um dieser peinlichen Betrachtung ein Ende zu machen:
»Und die Pistole?«
Lino seufzte und zog widerwillig die Waffe aus der Tasche. Marcello streckte die Hand danach aus. Linos Gesicht verhärtete sich plötzlich, er zog die Pistole zurück und sagte hastig:
»Ich geb sie dir … Aber erst mußt du sie dir verdienen …«
Bei diesen Worten empfand Marcello beinahe etwas wie Erleichterung: Es war also doch so, wie er gedacht hatte, Lino wollte im Tausch gegen die Pistole etwas haben. In falsch-unschuldigem Ton, als ginge es darum, unter Schulkameraden Federn gegen Glaskugeln einzutauschen, meinte er: »Sag du, was du dafür willst. Und dann werden wir uns einigen.«
Lino schlug den Blick nieder und zögerte, ehe er langsam fragte: »Was würdest du tun, um diese Pistole zu bekommen?«
Marcello bemerkte, daß Lino seiner Frage ausgewichen war. Offenbar handelte es sich also nicht um einen Gegenstand, der gegen die Pistole einzutauschen war, sondern darum, irgend etwas zu tun. Er hatte keine Ahnung, was Lino vom ihm verlangen könne. Immer noch in demselben gemacht harmlosen Ton sagte er: »Ich weiß nicht … Sag du mir’s …«
Ein Augenblick des Schweigens folgte. »Würdest du alles tun? Was auch immer?« fragte plötzlich Lino laut und packte ihn bei der Hand.
Der Ton und die Geste alarmierten Marcello. Er überlegte sekundenlang, ob Lino nicht etwa ein Einbrecher sei, der ihn zum Spießgesellen machen wollte. Nach kurzer Überlegung glaubte er allerdings, diese Möglichkeit ausschließen zu können. Immerhin antwortete er vorsichtig: »Aber was willst du denn, daß ich tue? Warum sagst du’s nicht klipp und klar?«
Lino spielte jetzt mit Marcellos Hand, wandte sie hin und her, besah sie, drückte sie fest, ließ dann wieder locker. Auf einmal stieß er sie mit beinahe grober Geste weg und sagte langsam, indem er Marcello ansah: »Ich bin sicher, daß du gewisse Dinge nicht tätest.«
»So rede doch endlich schon!« beharrte Marcello betreten, aber nicht ganz ohne Bereitwilligkeit.
»Nein, nein!« rief Lino. Marcello bemerkte, daß auf den bleichen Backenknochen des Chauffeurs sonderbare, unregelmäßige rote Flecken erschienen waren. Offensichtlich wollte Lino zwar gern sprechen, jedoch nicht ohne vorher sicherzugehen, daß Marcello dann auch mit seinem Vorschlag einverstanden sein würde.
Da vollführte Marcello eine Geste, bewußter, wenngleich unschuldiger Koketterie, er beugte sich vor und ergriff die Hand Linos. »Sag doch, was du willst«, ließ er sich vernehmen. »Warum sagst du’s denn nicht?«
Ein langes Schweigen folgte. Lino sah abwechselnd Marcellos Hand und dessen Gesicht an, schien zu zögern. Schließlich stieß er die Hand des Jungen ein zweites Mal zurück, jedoch sanft, erhob sich und machte ein paar Schritte durchs Zimmer. Dann setzte er sich von neuem, ergriff wieder Marcellos Hand – zärtlich, wie ein Vater oder eine Mutter die Hand des Sohnes ergreift. »Marcello«, fragte er, »weißt du, wer ich bin?«
»Nein.«
»Ich bin ein aus der Kutte gesprungener Priester«, sagte Lino, und in seiner Stimme lag ein Ton tiefen Schmerzes. »Vielmehr ein Priester, der mit Schimpf und Schande als unwürdig aus dem Kolleg verjagt worden ist, an dem er lehrte … Und du, in deiner Unschuld, hast keine Ahnung, was ich von dir verlange im Tausch für diese Pistole, die du so gern haben möchtest. Ich bin in Versuchung, deine Unwissenheit, deine kindliche Habgier zu mißbrauchen … Jetzt weißt du, wer ich bin, Marcello.« Er hatte im Ton völliger Aufrichtigkeit gesprochen. Nun wandte er sich unerwartet dem Kopfende des Bettes zu und sprach zu dem Kruzifix, ohne die Stimme zu erheben, klagend: »Ich habe so zu dir gebetet …. Aber du hast mich verlassen! Und immer, immer falle ich von neuem! Warum hast du mich verlassen?« Linos weitere Worte verloren sich in einer Art Gemurmel, als spräche er zu sich selbst. Dann erhob er sich vom Bett und sagte zu Marcello: »Vorwärts …! Komm! Ich bringe dich heim!«
Marcello schwieg. Er war wie betäubt und einstweilen außerstande, über all dies nachzudenken. Er folgte Lino auf den Korridor und dann in das große Wohnzimmer. Draußen, auf dem Vorplatz, wehte noch immer der Wind unter dem bewölkten, sonnenlosen Himmel.
Lino bestieg das Auto, Marcello setzte sich neben ihn. Der Wagen fuhr an, glitt über die Zufahrt und durch das Tor auf die Straße hinaus. Eine ganze Weile wechselten die beiden kein Wort miteinander. Lino saß wie früher am Lenkrad: den Oberkörper steif aufgerichtet, das Mützenschild tief über den Augen, die behandschuhten Hände am Volant. Nach einer ganzen Weile fragte Lino schließlich, ohne sich umzuwenden:
»Tut es dir leid um die Pistole?«
Bei diesen Worten wachte in Marcello wieder die Hoffnung auf, diese so sehr begehrte Pistole doch zu erhalten. Schließlich und endlich, dachte er, ist vielleicht noch nicht alles verloren … Also antwortete er ehrlich: »Freilich tut es mir leid!«
»Demnach«, fragte Lino, »würdest du kommen, wenn ich mich für morgen mit dir verabredete – um die gleiche Stunde wie heute?«
»Morgen ist Sonntag«, erwiderte Marcello. »Aber übermorgen. Wir könnten uns wieder in der Allee treffen, an derselben Stelle …«
Der andere schwieg einen Augenblick. Dann rief er plötzlich laut und mit klagender Stimme: »Sprich nicht mehr mit mir! Schau mich nicht mehr an! Und wenn du mich Montag mittag in der Allee siehst – hör nicht auf mich! Grüß mich nicht einmal! Verstanden?«
Was hat er denn? fragte sich Marcello etwas ärgerlich. Und er antwortete: »Ich lege keinen Wert darauf, dich zu sehen. Du selbst hast mich heute zu dir gebracht!«
»Ja, aber das darf nicht wieder geschehen! Nie mehr!« erklärte Lino mit Entschiedenheit. »Ich kenne mich und weiß, daß ich nun die ganze kommende Nacht an dich denken werde und daß ich Montag in der Allee auf dich warten werde. Auch wenn ich heute beschließe, es nicht zu tun. Ich kenne mich. Aber du darfst dich nicht um mich kümmern.«
Marcello sagte nichts. Lino aber redete mit der gleichen Heftigkeit. »Ich werde die ganze Nacht an dich denken, Marcello. Montag werde ich in der Allee sein – mit der Pistole, aber du darfst mich nicht beachten.« Immer von neuem wiederholte er diesen Satz. Marcello begriff mit seiner kalten, unschuldigen Hellsichtigkeit, daß Lino zwar mit ihm eine Verabredung traf, ihn zugleich aber vor dieser Verabredung warnte.
Nach einem Augenblick des Schweigens fragte Lino von neuem: »Hast du gehört?«
»Ja.«
»Was hab ich gesagt?«
»Daß du mich Montag in der Allee erwarten wirst.«
»Ich hab dir nicht nur das gesagt …« meinte Lino.
»Und daß ich mich nicht um dich kümmern soll«, schloß Marcello.
»Ja«, bestätigte Lino, »auf gar keinen Fall! Ich werde dich rufen, dich anflehen, dir mit dem Wagen nachfahren … Ich werde dir alles versprechen, was du nur willst. Aber du mußt geradeaus weitergehen und darfst nicht auf mich hören.«
Marcello verlor die Geduld und sagte: »Schon gut! Ich hab’s verstanden.«
»Aber du bist ein Kind«, sagte Lino und wechselte von der bisherigen Heftigkeit zu plötzlicher Weichheit hinüber. »Und du wirst nicht imstande sein, mir zu widerstehen. Du wirst zweifellos mit mir kommen … Du bist ein Kind, Marcello.«
Marcello war beleidigt. »Ich bin kein Kind mehr! Ich bin ein Junge! Du kennst mich noch nicht.«
Lino hielt den Wagen plötzlich an. Sie befanden sich noch auf der Hügelstraße zu Füßen einer hohen Mauer, nicht weit entfernt von der mit Lampions geschmückten Einfahrt zu einem Restaurant. Lino wandte sich Marcello zu. »Wirklich?« fragte er mit einer Art schmerzlicher Sorge. »Würdest du dich wirklich weigern, mit mir zu kommen?«
»Du bist es doch«, erwiderte Marcello, der sich jetzt seines Spiels bewußt war, »der das von mir verlangt.«
»Ja.« Verzweifelt fuhr Lino fort: »Das ist wahr.« Er setzte den Wagen wieder in Bewegung. »Du hast recht, ich bin der Verrückte, der das von dir verlangt. Gerade ich!«
Nach diesem Ausruf verstummte er und verfiel in ein längeres Schweigen. Der Wagen fuhr noch ein Stück auf der Straße weiter und durchquerte dann wieder die schmutzige Vorstadt. Dann kamen sie zu der breiten Allee mit den kahlen Platanen, den Haufen abgefallener Blätter längs der verlassenen Gehsteige, den Villen mit ihren vielen Fenstern. Nun hatten sie das Viertel erreicht, in dem sich das Haus von Marcellos Eltern befand.
Ohne sich umzuwenden, fragte Lino: »Wo ist euer Haus?«
»Halt lieber hier an«, sagte Marcello und war sich bewußt, wie wohltuend dieser Verschwörerton auf Lino wirkte. »Man könnte sonst sehen, daß ich aus deinem Wagen steige.«
Das Auto hielt. Marcello stieg aus. Lino reichte ihm durch das Wagenfenster das Bücherpaket und sagte mit Entschiedenheit:
»Also auf Montag! In der Allee. An derselben Stelle wie heute.«
»Aber ich«, sagte Marcello und ergriff die Bücher, »muß so tun, als sähe ich dich nicht, wie?«
Lino zögerte mit der Antwort. Marcello empfand eine beinahe grausame Genugtuung. Linos tiefeingesunkene Augen hatten einen flehenden, gequälten Blick. Dann sagte er: »Tu, was du für gut hältst. Mach mit mir, was du willst.« Seine Stimme versagte in einer Art halbgesungener Klage.
»Ich werde dich überhaupt nicht ansehen!« verkündete Marcello zum letztenmal.
Lino vollführte eine unverständliche Handbewegung, die vielleicht verzweifelte Zustimmung ausdrücken sollte.
Dann fuhr das Auto an und entfernte sich langsam in der Richtung auf die Allee zu.