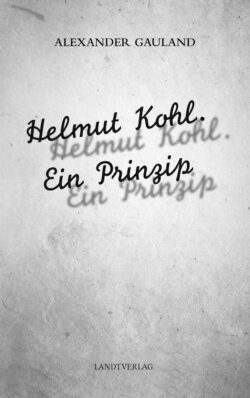Читать книгу Helmut Kohl. Ein Prinzip - Alexander Gauland - Страница 6
Die Karriere
ОглавлениеDas Leben Helmut Kohls beginnt am 3. April 1930 in Ludwigshafen. Das umgebende Milieu ist kleinbürgerlich, bäuerlich. Kohls Vater war Finanzbeamter, katholisch und nationalliberal. Das Elternhaus blieb gegenüber den Ideen des Nationalsozialismus resistent. Der Vater hatte schon den Beginn des Krieges als einen Einschnitt erlebt und als provisorischer Stadtkommandant einer eroberten polnischen Stadt Dinge gesehen, die ihn den Tag fürchten ließen, an dem das deutsche Volk dafür würde bezahlen müssen. Kohls Bruder fiel Ende 1944 in einer der letzten großen Abwehrschlachten im Westen – er selbst barg Bombentote in Ludwigshafens Straßen und erlebte das Kriegsende in einem Wehrertüchtigungslager in Berchtesgaden.
Da das Elternhaus eher unpolitisch war, bleibt Kohls frühes politisches Engagement verblüffend, denn bereits mit 18 Jahren galt der Abiturient in Ludwigshafen als eine politische Lokalgröße. Eine einleuchtende idealistische Erklärung für den politischen Aufstiegswillen Helmut Kohls findet sich nicht, Schule und Studium prägten ihn nicht über das normale Maß hinaus. Bereits das Studium war mehr Mittel zum Zweck des Aufstiegs als Drang nach Welterkenntnis. Bedenkt man die Zeit, den Neuanfang und die Namen in Frankfurt und Heidelberg, wo Kohl Öffentliches Recht, Politische Wissenschaften und Geschichte studierte, so hätte er viel einschneidendere Eindrücke davontragen können. Franz Böhm, Carlo Schmid, die Frankfurter Schule, Karl Jaspers, Alfred Weber, Alexander Rüstow, Dolf Sternberger und Gustav Radbruch repräsentierten das Beste deutscher Geistigkeit. Daß Helmut Kohl trotz dieser Möglichkeiten am Ende das Dissertationsthema »Die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererstehen der Parteien nach 1945« wählte, ist ihm vorgehalten worden. Doch der Vorwurf verkennt Kohls Ziel. Er brauchte die Promotion für den Aufstieg, und dafür war das Thema ideal und der Erfolg sicher. Auch heute ist diese Arbeit noch immer eine interessante Studie zu einem Stück politischer Heimatgeschichte, nichts Aufregendes, aber auch nichts, wofür sich ein amtierender Bundeskanzler zu schämen hätte. Helmut Kohls Doktorarbeit ist aber noch aus einem anderen Grunde von höchstem biographischen Interesse. Sie enthält ein Selbstporträt, verpackt in eine Charakteristik der Pfälzer. Dieses Selbstporträt ist klug und voller Einsichten und demonstriert, was ihm manche absprechen wollen – Selbsterkenntnis. Es sei deshalb hier ausführlich wiedergegeben: »Die Pfalz beheimatet – soweit sich solche allgemeinen Feststellungen treffen lassen – einen fröhlichen und weltoffenen Menschenschlag, der viel Sinn für gesellschaftliches Zusammenleben und die Freuden der Zeit hat und dem dogmatischen Denken abgeneigt ist. Das rheinfränkische Erbe und die sich aus der Grenzlage ergebenden französischen Einflüsse mögen hierbei Zusammenwirken. Neben einem ausgeprägten Sinn für Toleranz besteht jedoch häufig ein allzu starkes und unangenehmes Selbstgefühl. In diesem »lautstarken« Auftreten hat auch der »Pfälzer Krischer« seinen Ursprung. Bei aller Aufgeschlossenheit und praktischen Intelligenz haben die Pfälzer keine ausgeprägte musische Veranlagung. Der Historiker Karl Hampe faßt seine Meinung über die Bewohner dieser Landschaft in dem Satz zusammen: »Der Pfälzer ist zu allen Zeiten, soweit wir seinen Charakter zurückverfolgen können, diesseitsfreudig und zugreifend, auf das Praktische gerichtet; die bedeutenden Männer, die die Pfalz hervorgebracht hat, sind zu allen Zeiten nahezu ausschließlich dem praktischen Leben zugewandt gewesene Auch Wilhelm Heinrich Riehl, der Verfasser des ersten volkskundlichen Buches über die Pfalz, beklagt das geringe Interesse des pfälzischen Volkes am geistigen Streben vor allem auf dem Gebiet der Kunst.«8 Nach dieser Selbsteinschätzung bleibt unerfindlich, weshalb die »offizielle« Biographie von Werner Maser den Bundeskanzler als Leser und Kenner von James Joyce, Charles Péguy, Georges Bernanos, Werner Bergengruen und Franz Kafka in Anspruch nimmt. Helmut Kohls an Heinrich Böll gerichtete Frage, warum er nicht wie Zuckmayer schreiben könne, dementiert diese Behauptung. Daß er sich vor einem Besuch bei Ernst Jünger über Léon Bloy ins Bild setzen läßt, weist ihn nur als höflichen Menschen aus.
Die ersten Stufen der Karriereleiter nimmt Helmut Kohl schnell: 1946 Eintritt in die CDU in Ludwigshafen, 1947 Mitbegründer der Jungen Union daselbst, 1953 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der CDU der Pfalz, 1954 bis 1961 stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union Rheinland-Pfalz, 1955 bis 1966 Mitglied des Landesvorstandes der CDU Rheinland-Pfalz, 1959 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Ludwigshafen. Am 19. 4. 1959 Einzug in den Mainzer Landtag, 1960 bis 1969 Vorsitzender der CDUStadtratfraktion in Ludwigshafen, am 25. 10. 1961 Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz.
Helmut Kohl pflegt einen robusten Stil der politischen Auseinandersetzung. Die Prügelei mit einer sozialdemokratischen Klebekolonne im ersten Bundestagswahlkampf ist dabei eine eher komische Begebenheit am Rande. Anders die allein machtpolitisch zu verstehenden Auseinandersetzungen mit dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister Dr. Hans Klüber von Ludwigshafen. Hier bleiben tiefe Verletzungen zurück, allerdings wächst auch die Einsicht des jungen Politikers, daß Aggressivität von den Bürgern in der Wahlkabine nicht honoriert wird.
Da Helmut Kohl von Anfang an zu politischem wie beruflichem Aufstieg in der CDU entschlossen war, spielt ein bürgerlicher Beruf in seinen Überlegungen kaum eine Rolle. Nachdem er sich sein Studium zum Teil als Steinschleifer bei BASF verdient hat, tritt er 1958 als Direktionsassistent in die Eisengießerei Mock ein, wechselt aber schon zum 1. 4. 1959 in den Landesverband Chemische Industrie Rheinland-Pfalz. Hier ist er als Referent für Wirtschafts- und Steuerpolitik tätig, doch vertauscht er die Rolle des Lobbyisten schon bald mit der des politischen Funktionärs. Die Partei ist praktisch von Anfang an Berufung, Beruf und Heimat. Helmut Kohl ist der erste klassische Berufspolitiker ohne Wurzeln in einem anderen gesellschaftlichen Milieu. Vieles, was ihm Erfolg gebracht hat, aber auch seine Begrenzungen haben hier ihren Urgrund. Niemand, der Helmut Kohls emotionale Bindung an seine Partei nicht zu teilen vermag, wird ihn jemals ganz verstehen – auch der Autor nicht.
Vor dem weiteren Aufstieg Helmut Kohls lag jetzt eine Barriere aus den Anfangsjahren der zweiten deutschen Republik. Peter Altmeier, der erste Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, hatte sich um die Identitätsfindung des Landes große Verdienste erworben. Aber er war zugleich ein typischer Vertreter jener Generation, deren Mangel an Einsicht schließlich den Ausbruch von 1968 auslöste, ein Mann, der die Zeit nicht mehr verstand und dem deshalb die Macht entglitt, was sich auch in den Wahlergebnissen ausdrückte. Helmut Kohl schaffte sich zielgerichtet personelle Stützpunkte in Landesverband und Fraktion, drängte in beiden die katholisch-konservativen Altmeier-Freunde zurück, wurde 1963 Fraktionsvorsitzender, 1964 Vorsitzender des Bezirksverbandes Pfalz und 1966 Landesvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz. Als die CDU 1967 in den Landtagswahlen mit 46,7 Prozent ein achtbares Ergebnis erzielte, wurde Altmeier noch einmal Regierungschef, allerdings auf Zeit. Die Politik bestimmte bereits sein präsumtiver Nachfolger, der ihm mit Bernhard Vogel und Heiner Geißler auch zwei neue Minister verordnete. Als Altmeier 1969 die Staatskanzlei verließ, verabschiedete er sich öffentlich von allen, die ihn begleitet hatten, einschließlich seines Fahrers – allein Helmut Kohl blieb unbedankt.
Die rheinland-pfälzischen Jahre Helmut Kohls waren gute Jahre für ihn wie für das Land. Eine zweite Landesuniversität, 13 000 neue Arbeitsplätze in der Eifel, die Abschaffung der Konfessionsschule, eine Verwaltungsreform und das erste Kindergartengesetz zeigen eine effiziente und erfolgreiche Regierung. Neue Namen wie Hanna-Renate Laurien, Wilhelm Gaddum, Franz Klein, Richard von Weizsäcker und Norbert Blüm tauchen in der Umgebung Helmut Kohls auf. Die Wähler honorieren diesen »Modernitätsschub« bei den Landtagswahlen mit einer absoluten Mehrheit 1971 und 53,9 Prozent im Jahre 1975. Angesichts solcher Erfolge ist es akademisch zu fragen, ob Helmut Kohl die Macht erstrebte, um ein Programm durchzusetzen, oder ob er sich ein Programm erfand, mit dem er die Macht behalten konnte. Zwar deutet manches auf das letztere – in einem moralischen Sinne problematisch wäre dies jedoch nur dann, wenn das Programm zum Machterhalt gesellschaftlich schädlich ausgefallen wäre. Doch das haben nicht einmal seine politischen Gegner behauptet. Helmut Kohls Ehrgeiz blieb nicht auf das Land der Rüben und Reben beschränkt. Als Landesvorsitzender war er kraft Amtes Mitglied des Bundesvorstandes, 1967 wurde er auch in dieses Gremium gewählt, 1969 zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden bestellt.
Dies geschah genau zu jener Zeit, da das erste christlich-demokratische Zeitalter in der Republik zu Ende ging und mit Kurt Georg Kiesinger der letzte große Staatsschauspieler der Gründergeneration die Bühne verließ. Doch da die Niederlage bei den Bundestagswahlen 1969 knapp ausgefallen war und die CDU deshalb die neue sozialliberale Koalition als etwas Unnatürliches, der Republik Wesensfremdes betrachtete, vermochte sie die Oppositionsrolle innerlich nicht anzunehmen. Die Macht, die Kiesinger in einem Moment der Unaufmerksamkeit entglitten war, sollte Rainer Barzel, der geschmeidige Fraktionsvorsitzende, in den Jahren der Großen Koalition zurückgewinnen. Die Ansprüche des Provinzpolitikers aus Mainz auf die Führung der Partei wurden deshalb zu Beginn eher belächelt denn als ernsthafte Bewerbung akzeptiert. Außerdem unterlief Helmut Kohl ein schwerer Fehler, der selbst seine Anhänger im linken Spektrum der CDU verunsicherte. Auf dem Mitbestimmungsparteitag der CDU in Düsseldorf 1971 stimmte er gegen eine von ihm mitformulierte, den Sozialausschüssen entgegenkommende Mitbestimmungsvorlage und verhalf so dem von Alfred Dregger vorgelegten Gegenentwurf des hessischen Landesverbandes zum Sieg. War es Rücksichtnahme auf die CSU, wie Kohl damals in das entsetzte Schweigen seiner Anhänger hinein verkündete, oder ein schlichter »Blackout», wie er später behauptet hat? Beides war keine Empfehlung für einen zukünftigen Bundesvorsitzenden, und so hatte Barzel leichtes Spiel. Doch Barzels Fundament war brüchig. Er war zu glatt, um den knorrigen Fundamentalisten der »Hallstein-Doktrin« Halt zu geben, und zu weich, um eine neue Politik zu formulieren. Als das konstruktive Mißtrauensvotum gegen Brandt mißlang, war Barzel schon ein geschlagener Mann. Die Bundestagswahlen von 1972, in denen die SPD 45,8 Prozent der Stimmen errang, bestätigten nur, was alle im Lande fühlten: Eine neue Zeit war angebrochen. Jetzt galt auch für die CDU der Satz Tancredis aus Lampedusas Leopard: »Wenn wir wollen, daß alles so bleibt, wie es ist, dann ist es notwendig, daß alles sich ändert.« Am 12. 6. 1973 wurde Helmut Kohl auf dem 21. Bundesparteitag der CDU in Bonn mit 520 von 600 gültigen Stimmen zum neuen Parteivorsitzenden gewählt.
Der Neuanfang war schwierig. Die Partei war das Gewand des jeweiligen Dogen, doch nun gab es keinen Dogen mehr, und zurück blieb ein Häufchen Samt. Der neue Generalsekretär Kurt Biedenkopf, wie auch sein Nachfolger Heiner Geißler, machten aus dem Kanzlerwahlverein eine Partei. Neue Themen, eine neue soziale Sensibilität und die Hinwendung zu Frauen und jungen Menschen sollten die Partei wieder in die Mitte der Gesellschaft stellen, doch diese Mitte definierte sich in Niedersachsen anders als in Bayern. Auch die »Verlierer« von 68 wollten von Veränderungen nichts hören und versuchten mit kräftigen Schlägen gegen den Zeitgeist zu rudern. Helmut Kohl rückte aus dem linken Spektrum in die Mitte der Partei. Er sollte führen und mußte doch auch integrieren.
Mit der »Mannheimer Erklärung« von 1975 war der Erneuerungsprozeß abgeschlossen. Doch obwohl die Brandtschen Visionen einer Versöhnung von Geist und Macht, von Demokratie und Sozialismus, von aufrührerischer Jugend und parlamentarischen Institutionen sehr bald zu Bruch gingen und dem nüchternen Pragmatismus Helmut Schmidts Platz machen mußten, tat sich die Union schwer. Sie hatte das Kreuz von Franz Josef Strauß zu tragen. Wie Helmut Kohl immer unterschätzt wurde, so ist Franz Josef Strauß überschätzt worden. Denn außer in den Regierungsjahren der Großen Koalition hat Franz Josef Strauß in der deutschen Politik nur eine destruktive Rolle gespielt. Nie konnte er es den Liberalen verzeihen, daß sie ihn über die »Spiegel-Affäre« gestürzt hatten, und nie hat er es verwunden, daß er nördlich der Main-Linie nicht mehrheitsfähig war. Da er nicht Kanzler werden konnte, wünschte er auch keinen anderen CDU-Kanzler, am wenigsten aber Helmut Kohl. »Es gibt Strauß-Vertraute, die meinen, er habe Kohl gehaßt», hat Peter Boenisch geschrieben9, und in der Tat läßt der berüchtigte Ausbruch in der Wienerwald-Zentrale aus dem November 1976 keine andere Deutung zu: »Herr Kohl, den ich trotz meines Wissens um seine Unzulänglichkeit, um des Friedens willen als Kanzlerkandidat unterstützt habe, wird nie Kanzler werden. Er ist total unfähig, ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und die politischen Voraussetzungen. Ihm fehlt alles dafür… Und glauben Sie mir eins, der Helmut Kohl wird nie Kanzler werden, der wird mit 90 Jahren die Memoiren schreiben: ›Ich war 40 Jahre Kanzlerkandidat, Lehren und Erfahrungen aus einer bitteren Epoche‹ Vielleicht ist das letzte Kapitel in Sibirien geschrieben.«10 Daß viele, auch linke Intellektuelle, diesen Mann für einen brillanten politischen Analytiker gehalten haben und trotz ihrer zur Schau getragenen Aversionen heimlich von Strauß fasziniert waren11, gehört zu den Merkwürdigkeiten der Bonner Republik. Seine Erinnerungen sprechen eine andere Sprache. Franz Josef Strauß war weder scharfnoch hellsichtig. Seine Analysen lagen meistens neben der Sache, wobei ihm abwechselnd Eitelkeit und Wut den Blick trübten. Die von ihm zustimmend zitierte Bemerkung seiner Frau über Erich Honecker, daß dieser ein beeindruckendes Mannsbild sei, zeigt die Grenzen seines Urteilsvermögens.12 Strauß war gebildeter und erfahrener als Helmut Kohl, aber während Kohl immer auf der Suche nach dem Konsens war, war Franz Josef Strauß auf der Suche nach dem Konflikt. Doch die Bundesrepublik war im Gegensatz zur Weimarer Republik eine Konsensdemokratie, die fast instinktiv die großen Polarisierer verwarf, nachdem die Grundlagen einmal gelegt und die Richtung entschieden war. Dies hat der Altphilologe und Hobbyhistoriker Strauß nie begriffen, und daran ist er auch gescheitert.
Nach komplizierten Verhandlungen mit der CSU wurde Helmut Kohl als Kanzlerkandidat der Unionsparteien in die Bundestagswahlen 1976 geschickt. Doch die gemeinsame Erklärung verhieß nichts Gutes für die Zukunft: »Die CSU hält an ihrer Bewertung fest, daß ihr Vorsitzender der geeignete Kandidat ist. Die CSU wird im Interesse der gemeinsamen Sache ebenso wie die CDU Helmut Kohl als Kanzlerkandidaten unterstützen.«13 Daß die Union mit 48,6 Prozent der Stimmen nur knapp die absolute Mehrheit verfehlte, war eine beachtliche Leistung Kohls. Doch die FDP sprang nicht, und Helmut Schmidt blieb Bundeskanzler. Helmut Kohl verspielte seinen Erfolg noch am gleichen Abend. Sein trotziges »Ich will Bundeskanzler werden – ich habe die Wahl gewonnen« wäre in Mainz passend gewesen, in Bonn klang es provinziell. In Mainz mochte es richtig sein, daß der stärksten Partei die Initiative zur Regierungsbildung zusteht, in Bonn ging es um die Macht, und da hatten ein paar tausend Stimmen gegen die »Machtübernahme« von Helmut Kohl entschieden.
Die nun folgenden Jahre wurden die schwierigsten überhaupt. Wenige Wochen nach der Bundestagswahl kündigte Franz Josef Strauß die Fraktionsgemeinschaft im Bundestag auf. Es war ein Akt purer Irrationalität, denn ein »Bruderkampf« zwischen CDU und CSU hätte beide Parteien jene Stimmen gekostet, die sich Strauß durch ein eigenes Stück auf der Bonner Bühne holen wollte. Es war letztlich irrelevant, ob es eine »bürgerliche Mehrheit« gab, denn es gab auf jeden Fall eine gegen Franz Josef Strauß. Kohls Entschlossenheit rettete die Einheit. Als die CSU-Abgeordneten um ihre Mehrheiten in Bayern zu fürchten begannen, kehrte Strauß in die »babylonische Gefangenschaft« zurück.
Doch die Unterschiede in der Beurteilung blieben, und dieser Riß verlief mitten durch die CDU. Kohl wußte, daß eine Regierung Wahlen verliert und nicht die Opposition sie gewinnt. Er hielt nichts von oppositioneller Hektik. Er mußte warten, bis Helmut Schmidt und seine Partei sich soweit auseinandergelebt hatten, daß die FDP keinen Partner mehr hatte, erst dann hatte er eine Chance. Strauß und seine innerparteilichen Kritiker sahen die FDP dagegen auf unabsehbare Zeit »historisch« an die SPD gekettet und rüttelten an den Gitterstäben. »Freundliche« Worte über Kohls Führungseigenschaften machten die Runde. Der Abgeordnete Todenhöfer schrieb, im Schlafwagen käme die Union nicht an die Macht, und der Verlierer Barzel bemängelte, daß noch nie ein Kanzler so gemütlich regiert habe wie der jetzige. Zu keiner Zeit hatte Helmut Kohl weniger Freunde als an der Jahreswende 1978 / 79. Man braucht nur die Überschriften damals erschienener Artikel zu lesen und glaubt sich in ein Geisterhaus versetzt: »Kohls Talfahrt – guter Mann ohne Glück« (Welt vom 17. 5. 1979); »Die Ära Kohl geht zu Ende« (Quick vom 7. 6. 1979); »In der CDU wächst die Unzufriedenheit mit Kohl« (FAZ vom 10. 1. 1979); »Zum Verlieren bestellt« (Rudolf Augstein im Spiegel, 3/1979). Der Bonner Korrespondent der Frankfurter Rundschau registrierte damals, daß die Kohl-Postkarten aus der Buchhandlung am Bundeshaus verschwunden waren. Auf seine Nachfrage bekam er die Antwort: »Wir haben ihn aussortiert, denn wir sind immer unserer Zeit voraus.«14 Hinzu kam, daß sich der Oppositionsführer mit dem Kanzler schwertat. Helmut Schmidt war ein begnadeter Schauspieler, der gut ausgeleuchtet die geringen Erfolge einer zerstrittenen Koalition wie Preziosen darbot. Arrogant bis zur Unverschämtheit, wurde der »Weltökonom« doch von den Wählern bewundert, die ihm ihre Interessenvertretung eher zutrauten als dem provinziellen Pfälzer. Zwar war die Republik rheinisch und süddeutsch geprägt, doch Idiom, Habitus und Anspruch des sozialdemokratischen Bundeskanzlers ließen vage Reminiszenzen an Friedrich, Bismarck und Stresemann wach werden. Dieser Mischung war Kohl anfangs nicht gewachsen, in rhetorischen Auseinandersetzungen zog er regelmäßig den kürzeren. Bei Helmut Schmidt war es mehr Schein als Sein, bei seinem Gegenspieler schien, besser gesagt: schimmerte nichts.
Zur Jahreswende versandte Biedenkopf ein Memorandum, in dem er die Trennung von Partei und Fraktionsvorsitz verlangte und letzteren natürlich für sich beanspruchte. Das Papier fand Kohl in der Post, als er aus dem Winterurlaub zurückkehrte, den Inhalt hatte er zuvor schon den Zeitungen entnehmen dürfen. Auf dieses Ereignis anspielend, hat Kohl einmal auf die Frage, warum er nicht längst schon seine Memoiren in Angriff genommen habe, entgegnet: »Lieber nicht, ich müßte zu viel menschlich Unanständiges enthüllen.«15 Die Intrige scheiterte. Wie so oft vorher und nachher hatte Biedenkopf keine Mehrheit in den entscheidenden Gremien und stimmte am Ende selbst gegen den eigenen Vorschlag. Doch die Krise hielt an. Im Frühjahr machte Kohl instinktiv oder wohlüberlegt das einzig Richtige – er zog seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur zurück und schlug den niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht vor. Die Fraktion entschied sich für Franz Josef Strauß, der nun beweisen konnte, was in ihm steckte. Kohl unterstützte den Kandidaten nach Kräften; 44,5 Prozent in der Bundestagswahl 1980 bestätigten allerdings den allgemeinen Befund – die Wähler wollten keinen Bundeskanzler Strauß. Grollend zog sich der Geschlagene nach Bayern zurück. Helmut Kohl hatte die Talsohle durchschritten. Die sozialliberale Koalition ging nur zwei Jahre später zu Ende, und Helmut Kohl wurde – so wie er es immer gewollt hatte – Bundeskanzler einer CDU/ FDP-Regierung. Den Wunsch von Strauß, sofort wählen zu lassen und so die FDP zu vernichten, ignorierte er. Helmut Kohl fürchtete eine absolute Mehrheit, die ihn den Unwägbarkeiten eines Außenministers Strauß ausgeliefert hätte. Auch wußte Kohl, daß spätestens die nächste Bundestagswahl eine absolute Mehrheit wieder relativiert hätte, ohne daß der Union dann ein sicherer Partner zur Verfügung stehen würde. Die Koalitionsverhandlungen gestalteten sich problemlos. Das Bündnis mit der FDP erforderte außenpolitische Kontinuität in der Ost- und Deutschlandpolitik, innenpolitisch wurde das Lambsdorff-Papier, die Scheidungsurkunde der sozialliberalen Koalition, zum Ehevertrag des neuen Bündnisses. Haushaltskonsolidierung, Verringerung der Staatsquote und Begrenzung der Sozialausgaben bestimmten den Neuanfang. Gefahren drohten von der Verratslegende der SPD, die Alfred Dregger die hessischen Landtagswahlen kostete und die geschickt zu einem für Helmut Kohl abträglichen Vergleich mit Helmut Schmidt benutzt wurde. »Jetzt hätten wir endlich einmal einen Bundeskanzler gehabt und nun haben wir Aussicht auf keinen», formulierte Martin Walser für die Intellektuellen, und die Stimmung der »classe politique« der westlichen Demokratien brachte die Sunday Times auf die Formel: »Nach dem großen Bundeskanzler folgt jetzt ein langer.«16 Das Ergebnis der Bundestagswahl vom 6. 3. 1983, bei der die Union 48,8 Prozent der Stimmen erhielt und die FDP erhalten blieb, demonstrierte, daß die Intellektuellen nicht das Volk sind und daß die Wähler den Grund für den Wechsel der FDP begriffen und gebilligt hatten.
Die neue Legislaturperiode sah einen Bundeskanzler ohne Fortune. Ausgerechnet ein eher konservativer Politiker hatte Schwierigkeiten mit dem Apparat und den Institutionen. Unregelmäßige Kabinettssitzungen und die Unfähigkeit einiger Mitarbeiter des Kanzlers, seine Arbeit sinnvoll mit Hilfe des Apparates zu ordnen, belebten das Wort von der Führungsschwäche neu. Der neue Bundeskanzler war zudem kein Freund der Medien und diese ihm selten gewogen. Skandale und Affären begannen den Horizont zu verdüstern. Die Wörner-Kießling-Affäre war nicht nur ein Beispiel für die Unfähigkeit eines Ministers und die Ungeschicklichkeit des Kanzleramtes, sie offenbarte auch Defizite der »politischen Kultur« des Kanzlers. Daß diese Affäre nach Umfrageergebnissen und nicht nach moralischen Maßstäben entschieden wurde, entfremdete dem Kanzler auch Meinungsführer aus dem konservativen publizistischen Spektrum. Dies setzte sich mit dem Entwurf eines Amnestiegesetzes für unrechtmäßig vereinnahmte Parteispenden fort. Zwar handelte es sich bei der Flick-Affäre um ein Erbe aus sozialliberaler Zeit und eine Verfehlung aller politischen Kräfte gegenüber der Wirtschaft, der man die rechtswidrige Spendenpraxis nahegelegt hatte, die Art des Vorgehens jedoch wurde allein Kohl zur Last gelegt, während die FDP trotz Anklage und Verurteilung ihres Wirtschaftsministers den Eindruck moralischer Läuterung erwecken konnte. Helmut Kohl hatte zu Beginn seiner Kanzlerschaft eine »geistig-moralische Wende« versprochen, nun holte ihn das Echo dieser letztlich substanzlosen Ankündigung ein. Auch mußte er sich in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode mit den Angriffen von Strauß auf seinen Außenminister Genscher herumschlagen, der Kontinuität verkörperte, wo Strauß die Wende einforderte. Reagans nicht ganz freiwilliger Besuch in Bitburg spaltete die öffentliche Meinung in Deutschland und rief erhebliche Irritationen im Ausland hervor. Daß die Bundestagswahlen 1987 keinen Wechsel brachten, hatte die Regierung neben dem anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg vor allem der SPD zu verdanken, die noch immer am Schmidt-Syndrom litt und ihren Kanzlerkandidaten Johannes Rau nicht geschlossen unterstützte. Bei dieser Ausgangslage waren 44,3 Prozent für die CDU/CSU mager und lösten sofort einen neuen Streit um Wahlkampfstrategie und Lagerdenken zwischen CDU und CSU aus. Allein die Nachrüstung, die Helmut Schmidt in einen unlösbaren Konflikt mit Fraktion und Partei gestürzt hatte, wurde von der Koalition geschlossen getragen und trotz der größten Massendemonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik auch durchgesetzt. Das Verdienst hieran gebührt in erster Linie Helmut Kohl.
In der zweiten Legislaturperiode verpatzte die Koalition ihre Steuerreform. Richtige Ansätze versanken im Morast einer kleinkarierten Auseinandersetzung um Spitzensteuersatz, Steuerbefreiung für Flugbenzin und die Besteuerung der Nachtzuschläge von Schichtarbeitern. Obwohl die Toren dieser Auseinandersetzung Blüm und Strauß waren, konnte Kohl das Steuertheater nicht beenden, was er mit dem als verhüllte Rücktrittsdrohung mißverstandenen Satz eingestand: »Ich habe es satt, mich zum Affen machen zu lassen, ich lasse mich nicht wie ein Tanzbär an der Leine herumführen.«17 Als er dann noch vor dem Mainzer Untersuchungsausschuß zur Parteispendenaffäre eine objektiv falsche Aussage machte, die von Geißler prompt als »Blackout« interpretiert wurde, und in einem Newsweek-Interview Gorbatschow mit Goebbels verglich, schienen seine Tage als Kanzler und Parteivorsitzender gezählt. Rüdiger Altmann begründete in der Zeit, »weshalb Kohl einem Nachfolger Platz machen sollte».18 Die Unzufriedenheit fand ihren Hebel in der Personalfrage des Generalsekretärs. Kohl und Geißler hatten sich innerlich entfremdet. Geißler verstand sich als geschäftsführender Parteivorsitzender und Hüter der Identität der Partei. Kohl sah seine Stellung als unumschränkter Chef der CDU bedroht. Als Geißler einen Wechsel ins Innenministerium ablehnte, trennte er sich von seinem Generalsekretär. Was sich dann abspielte, verdient die Bezeichnung »Putsch« nicht. Geißler hielt sich für unangreifbar, doch seine Verbündeten wollten Kohl zwar loswerden, aber niemand wollte den ersten Stein werfen. Am Ende kandidierten weder Ernst Albrecht noch Rita Süssmuth, noch Lothar Späth gegen Kohl. Neuer Generalsekretär wurde der Hamburger Volker Rühe. Das Ergebnis dieser mißglückten Schilderhebung war eine fast historisch zu nennende Verklammerung der Partei mit ihrem Vorsitzenden. »Ein Kanzler wie ein Eichenschrank», schrieb Rolf Zundel am 6. 1. 89 in der Zeit, »viele stoßen sich an ihm, doch keiner kann ihn verrücken.« Helmut Kohl war nun die CDU und die »moderne Volkspartei« wieder zum Kanzlerwahlverein mutiert. Im September 1989 glaubte niemand, daß Helmut Kohl noch einmal Wahlen gewinnen könnte, wenige Wochen später bot ihm der Zusammenbruch des Kommunismus die historische Chance, als Kanzler der deutschen Wiedervereinigung in die Geschichte einzugehen, eine Chance, die Kohl klug nutzte, wodurch er erst die Volkskammerwahlen und anschließend die ersten gesamtdeutschen Wahlen für sich entschied.
Helmut Kohl hatte an die deutsche Wiedervereinigung sowenig geglaubt wie alle westdeutschen Politiker, doch er begriff schneller als die meisten, mit der Ausnahme von Brandt, daß die Geschichte diese Richtung einschlug, und es gelang ihm im Dreischritt Währungsunion – Westbindung – Wiedervereinigung die gefährliche Falle eines Wahlzwangs zwischen NATO-Mitgliedschaft und Wiedervereinigung zu vermeiden und das neue Deutschland mehr oder minder im Einklang mit allen seinen Nachbarn zu etablieren, wenngleich die lange hinausgezögerte Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze bei den Polen Irritationen hervorrief. Was außenpolitisch glückte, mißriet allerdings im Inneren. Falsche Analysen, Halbheiten und nicht eingelöste Versprechungen belasten den Einigungsprozeß bis zum heutigen Tage. Stille Freude ist längst lauter Depression gewichen, und die Bundesregierung hat noch immer kein Konzept zur Vollendung der inneren Einheit gefunden. Die Auswahl des falschen Kandidaten, Steffen Heitmann, für das Amt des Bundespräsidenten war auch einer der zahllosen Versuche, die trotz hoher Transferleistungen unzufriedenen Ostdeutschen mit dem Zustand der Dinge zu versöhnen.
Zu Beginn des Jahres 1994 sieht es nicht so aus, als ob Helmut Kohl noch einmal eine regierungsfähige Mehrheit erringen kann, doch zeigt der kurze Abriß seiner Karriere, daß schon oft Nachrufe auf ihn geschrieben wurden, die verfrüht waren – auch diesmal ist ein Comeback nicht ausgeschlossen. Helmut Kohl ist durch eigenes Verdienst und glückliche Umstände zu einer historischen Figur geworden. Er ist wie kein anderer lebender Politiker ein Repräsentant der alten Bundesrepublik an der Schwelle zur neuen. Sein Abgang wäre ein Zeichen dafür, daß eine Epoche unwiderruflich zu Ende ist.