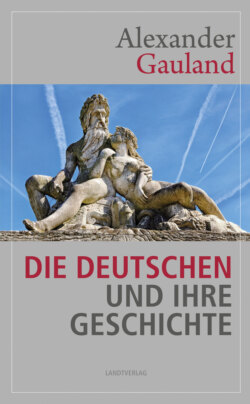Читать книгу Die Deutschen und ihre Geschichte - Alexander Gauland - Страница 7
Der antirömische Protest 1 – Luther gegen Karl V.
ОглавлениеAls die Kurfürsten nach dem Interregnum 1273 einstimmig den schwächsten der Vasallen Friedrichs, den Grafen von Habsburg, zum deutschen König wählen, ist das wie ein Atemholen. Das Reichsgut ist verschleudert, Italien und Burgund sind verloren und die Mitte des Kontinents ist inzwischen wirtschaftlich und kulturell hinter dem Westen, also England, Frankreich, Kastilien und Portugal, zurückgeblieben. Das Fehlen einer Hauptstadt und archaische Verwaltungsstrukturen behindern die weitere Entwicklung. Grundlage des Wohlstandes ist noch immer das Land, auch wenn die Bauern nur wenig davon besitzen. Drei Stände machen die Gesellschaft aus, Pfaffen, Ritter und Bauern, oder wie es in einem bischöflichen Mahnschreiben heißt: »Dreigeteilt ist das Haus Gottes, das man als Einheit glaubt: Die einen beten, die anderen kämpfen und andere arbeiten. Diese drei sind vereint und leiden keine Spaltung.« Das Schwert soll den Landmann schützen, doch es beginnt, ihn zu knechten. Die alte Ordnung reicht nicht mehr hin. Handel und städtisches Bürgertum beanspruchen ihren Platz, und die Hanse, ein Städte- und Kaufmannsbündnis, füllt das Machtvakuum, das der Untergang der Staufer hinterlassen hat. Ihr Schwerpunkt liegt im Norden und Osten, eben da, wo die kaiserliche Gewalt am schwächsten ist. Ihre Macht zehrt am Reich.
Rudolf I. wendet Aufmerksamkeit und Kraft notgedrungen vom italienischen Süden ab und dem Südosten des Reiches zu. So gewinnt er in der Auseinandersetzung mit König Ottokar von Böhmen Österreich und die Steiermark, und seine Nachfolger erringen auch das böhmische Kernland. Italien entrückt dem Reich noch mehr, nachdem mit der Schweizer Eidgenossenschaft ein neuer Riegel zwischen den Reichsteilen entsteht. Noch ist die Krone nicht bei den Habsburgern quasi erblich, und so wechseln in den nächsten zweihundert Jahren die Dynastien. Den Habsburger Kaisern folgen Luxemburger Kaiser, unterbrochen von einem Nassauer und einem Bayern, der das letzte Mal den Versuch unternimmt, mit Romzug und eiserner Langobardenkrone das staufische Erbe anzutreten und die Ghibellinen, die Parteigänger des Kaisers, in den oberitalienischen Städten zu stärken.
Doch das bleibt Romantik, ohne realpolitische Substanz. Die Zukunft des Reiches liegt diesseits der Alpen, im Südosten und im Osten, wo die noch von den Staufern privilegierten Deutschordensritter das spätere Preußen gründen. Und auch im Westen gelingt den Habsburgern und Luxemburgern die Ausbreitung ihrer Territorialmacht am Oberlauf von Rhein, Neckar und Donau. Das erste Mal entsteht auch so etwas wie eine Hauptstadt in Prag, wo Karl IV. 1348 die erste deutsche Universität gründet.
Aber schon wetterleuchtet am Horizont eine neue Spaltung der abendländischen Christenheit. In den Hussitenkriegen, die nach der Verbrennung des Ketzers Jan Huß ausbrechen, beginnen die späteren Schrecken des Dreißigjährigen Krieges schon Gestalt anzunehmen. Es ist in erster Linie ein Religionskrieg, aber auch eine nationale Auseinandersetzung zwischen Tschechen und Deutschen. Der letzte in Rom vom Papst gekrönte Kaiser, Friedrich III., legt durch seine Heiratspolitik schließlich die Grundlagen der neuen spanischdeutschen Weltmonarchie. In seiner langen, von 1440 bis 1493 dauernden Regierungszeit handelte er nach dem später zum geflügelten Wort werdenden Motto: Andere führen Kriege, du aber, glückliches Österreich, heiratest.
Auch die Verfassung des von nun an »Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation« gewinnt in diesen Jahren feste Gestalt. Die 1356 als Reichsgrundgesetz erlassene Goldene Bulle regelt die Königswahl durch die drei geistlichen Kurfürsten (Mainz, Trier und Köln) und die vier weltlichen, den König von Böhmen, den Pfalzgrafen und die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen. Die Wahl soll künftig immer in Frankfurt, die Krönung in Aachen erfolgen. So ist das Reich ohne die Hausmacht seiner regierenden Kaiser zwar kaum noch Machtfaktor, aber immer noch Friedensordnung. Noch ist nicht entschieden, ob am Ende eine neue Staatlichkeit oder der Zerfall stehen werden. Diese Frage entschied erst die Reformation zugunsten des Zerfalls. Doch zuvor versuchte ausgerechnet ein mittelalterlicher Kaiser, der letzte Ritter, der Habsburger Maximilian, das Reich zu reformieren und ihm neue innere Festigkeit zu geben. Noch war es nicht zu einem rein metaphysischen Körper verkümmert, und die Einführung eines zentralen Reichsregiments als Exekutive der Reichsstände hätte sein Schicksal wenden können. Ein ewiger Landfriede, die Errichtung des Reichskammergerichts und die Einteilung in zehn Reichskreise zum Zwecke der Reichsverteidigung waren ein Anfang, um die monarchia universalis zu modernisieren, doch auch hier war die Kirchenspaltung mehr Abbruch als Aufbruch.
Das Heilige Römische Reich umfasste an der Schwelle zur Neuzeit, also etwa um 1400, die Mitte des europäischen Kontinents. Seine eher vage Grenze erstreckte sich laut Hagen Schulze »Von Holstein die Ostseeküste entlang bis etwa zum hinterpommerschen Stolp – hier begann das Herrschaftsgebiet des souveränen und reichsunabhängigen Deutschen Ordens – zog sich dann fast genau auf derselben Linie, die nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland und Polen trennen sollte, gen Süden, umfasste Böhmen und Mähren sowie das Herzogtum Österreich und erreichte bei Istrien das Adriatische Meer. Die Reichsgrenze sparte Venedig und sein Hinterland aus, zog sich, die Toskana umfassend, nordwestlich des Kirchenstaates quer durch Norditalien und erreichte nördlich von Civitavecchia das Tyrrhenische Meer, dem sie bei Nizza wieder nordwärts entstieg. Sie dehnte sich westlich Savoyens, der Freigrafschaft Burgund, Lothringens, Luxemburgs und der Grafschaft Hennegau und erreichte an der westlichen Schelde, zwischen Gent und Antwerpen, die Nordsee. Manche Gebiete, etwa Norditalien, Savoyen, die Freigrafschaft Burgund und die aufrührerische Schweizer Eidgenossenschaft gehörten nur noch nominell dem Reich an, andere gehörten entschieden nicht zu jenen Kerngebieten, die damals als ›teutsche Lande‹ bezeichnet wurden: In Brabant und Teilen der Herzogtümer Lothringen und Luxemburg sprach man Französisch und in den Ländern der Wenzelskrone, also in Böhmen, Mähren und Schlesien, war deutsch im wesentlichen die Sprache der Städte – das Landvolk, aber auch Teile der Stadtbevölkerung sprachen tschechisch, in Schlesien auch polnisch.«
Und in dieses explosive Völkergemisch, das weit davon entfernt war, Nationalstaat zu sein, das keine Staatsnation hatte und kein Staat war, fiel jetzt der Funke der Glaubensspaltung. Ihr Beginn sieht die Konfrontation zweier Männer, die verschiedener nicht sein konnten: des Habsburgers Karl V., seit 1519 mit dem Geld der Fugger erwählter römischdeutscher Kaiser, und des Augustiner-Mönches Martin Luther. Wenn Friedrich von Hohenstaufen der erste moderne Mensch auf dem Thron war, so Karl V. der letzte mittelalterliche Kaiser. Doch anders als bei Friedrich II., dessen wenige steinerne Porträts meist apokryph sind, besitzen wir von Karl die Bilder Tizians, die uns einen meist in schwarz gekleideten, entrückten, einsam in der Eiseskälte seiner hohen Berufung verharrenden Menschen zeigen, unbeweglich wie ein Idol, wie sein Großvater Maximilian erschreckt ausgerufen haben soll. Der Kulturhistoriker Egon Friedell, der die Habsburger nicht mochte, hat in den Bildern Tizians den Fluch dieses Geschlechts entdecken wollen, kein Herz besitzen zu dürfen. Doch es war wohl eher der Schmerz über die verlorene Einheit der Christenheit und die am Ende in seiner Abdankung gipfelnde Einsicht, dass alles umsonst war, »verlorene Siege«, wie die Erinnerungen eines deutschen Heerführers aus dem Zweiten Weltkrieg überschrieben sind.
Karl war von seiner Persönlichkeit wie von seiner Stellung her der klassische Konservative, ein verantwortungsethischer Traditionalist, unfähig zu begreifen, was in Luther vorging und was er wollte. Er hat bis zuletzt gezögert, die Reformation und den Protestantismus gewaltsam zu unterdrücken, und er hat das zugesagte freie Geleit für Luther zum und vom Reichstag in Worms gehalten, denn er wollte – wie er sagte – nicht auch schamrot werden wie sein Vorgänger Sigismund, der Jan Huß unter Bruch dieses Versprechens festnehmen und verbrennen ließ. Als bei Pavia 1524 die französische Armee vernichtet und der französische König Franz I. gefangen genommen wurde, verbot der Kaiser alle Jubelfeste, da der Sieg gegen Christen erfochten sei, und ordnete Prozessionen und Bittgottesdienste an. In vierzig Druckzeilen hat Karl V. den deutschen Ständen auf dem Reichstag in Worms sein Credo verkündet: Verteidigung des katholischen Glaubens, der geheiligten Zeremonien und heiligen Bräuche, wie es seine Vorgänger gehalten haben, »vivre et mourir à leur exemple«. Reformen ja, aber nur im wörtlichen Sinn als Rückführung auf die geheiligten Bräuche.
Auf der anderen Seite dieser welthistorischen Auseinandersetzung finden wir einen mittelalterlichen Mönch, keinen gebildeten Humanisten wie Erasmus, keinen geschmeidigen Diplomaten wie den päpstlichen Legaten Cajetan, sondern einen frommen Bauern, den nur eine Frage umtreibt: Wie gewinne ich einen gnädigen Gott, wie finde ich Erlösung und Seelenheil? und der es wörtlich meint mit dem biblischen »Was hülfe es mir, wenn ich die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an meiner Seele?« Das Reich, die Türkengefahr, die Franzosen, Habsburg, die Wirkung seiner Lehre auf den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft – all das ist Luther gleichgültig, denn Politik interessiert ihn nicht, und Geschichte ist ihm unwichtig. Als die Bauern unter Hinweis auf ihn und seine Lehre politische und soziale Forderungen stellen, also die urchristliche Botschaft beim Wort nehmen, antwortet er mit seiner Schrift »Wider die räuberischen und mörderischen Bauern« und fordert, »dass sie erwürgt werden, wie tolle Hunde« – ein erstaunlicher Mangel an Empathie wie an geschichtlichem Verständnis.
Im Jahre 1511 reist Luther über Oberitalien nach Rom, doch er findet kein einziges Lobeswort für die Schönheit der Kunstwerke oder die Ehrwürdigkeit der antiken Bauten. Am Kölner Dom und am Ulmer Münster interessiert ihn ausschließlich die schlechte Akustik und am Rom der Päpste das darin verbaute Geld aus Deutschland. In der Persönlichkeit Luthers manifestiert sich schon, was später den Protestantismus ausmacht – das Wort und die Musik. Es fehlen der Sinn für Schönheit und Anmut, was Nietzsche zu dem Verdikt veranlasste: »Die Deutschen haben Europa um die letzte große Kulturernte gebracht, die es für Europa heimzubringen gab – die Renaissance«, und Gottfried Benn ähnlich hart urteilen ließ: »Die Reformation, das heißt das Niederziehen des 15. Jahrhunderts, dieses riesigen Ansatzes von Genialität in Malerei und Plastik zugunsten düsterer Tölpelvisionen – ein niedersächsisches Kränzchen von Luther bis Löns! Protestant, – aber Protest immer nur gegen die hohen Dinge.«
Das lutherische Aufbegehren ist reinste Gesinnungsethik, die Folgen für die Welt und das Reich interessieren ihn nicht: »Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde – denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es am Tag ist, dass sie des öfteren geirrt und sich selbst widersprochen haben –, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!«
Luther, so sieht es Egon Friedell, »war in seiner seelischen Grundstruktur noch eine durchaus mittelalterliche Erscheinung. Seine ganze Gestalt hat etwas imposant einheitliches, hieratisches, steinernes, gebundenes, sie erinnert in ihrer scharfen und starren Profilierung an eine gotische Bildsäule. Sein Wollen war von einer genialen dogmatischen Einseitigkeit, schematisch und gradlinig, sein Denken triebhaft, affektbetont, im Gefühl verankert: Er dachte gewissermaßen in fixen Ideen. Er blieb verschont von dem Fluch und der Begnadung des modernen Menschen, die Dinge von allen Seiten, sozusagen mit Facettenaugen betrachten zu müssen«.
Er ähnelte dem Kaiser mehr, als er wusste: Auch er wollte zurück zur mittelalterlichen Frömmigkeit und der Entartung und Verweltlichung ein Ende bereiten, auch er bezweifelte den seichten Optimismus der Humanisten und sah in den irdischen Dingen den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, nur war sein Wirken revolutionär, wo das des Kaisers konservativ war. Und noch etwas trennte ihn vom Kaiser: »Die menschlichen Dinge bedeuten ihm mehr als die göttlichen« hat er über Erasmus gesagt, was als Tadel gemeint war; über den Kaiser gesprochen, ist es ein Lob. Denn Luthers Unbedingtheit, sein »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« vererbte sich weiter in der deutschen Geschichte und hatte Folgen, die ein kluger Beobachter der deutschen Dinge in den Satz kleidete: »Das deutsche Volk nimmt die ideellen Dinge nicht als Fahne wie andere Völker, sondern um einige Grade wörtlicher als sie und die realen um ebensoviel zu leichtsinnig«; oder wie Goethe es in Dichtung und Wahrheit formulierte: »Uns war es darum zu tun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gerne gewähren«.
Dazu passt, dass Luther mit der Bibelübersetzung im Idealen aufgebaut, was er mit der Reichszerstörung im Realen eingerissen hat. Denn nach dem Ende der Religionskriege gab es zwar kein funktionsfähiges politisches Deutschland mehr, aber eine Sprachnation als Grundstein für ein neues deutsches Haus, sozusagen ein »inneres Reich« aus idealistischer Philosophie und der späteren Weimarer Klassik. Luther hat aus der sächsischen Kanzleisprache und dem Idiom seiner Nachbarn eine neue kraftvolle und ausdrucksstarke Hochsprache geformt, die noch gesprochen werden wird, wenn die evangelischen Landeskirchen längst Geschichte sein werden.
1517 hatte Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg geschlagen, 1521 waren päpstlicher Bann und Wormser Edikt, also die Reichsacht, gegen ihn und seine Schriften verhängt worden, 1526 hatte der Kaiser, der Krieg gegen Frankreich führte und dem der Bauernkrieg noch in den Knochen steckte, auf dem Speyerer Reichstag die Religion den Fürsten überlassen. Als er das 1529 beim zweiten Speyerer Reichstag rückgängig machen wollte, kam es zur Protestation der nun schon evangelischen Reichsstände. 1530 wird die neue Kirche ohne Papst, Hierarchie und die objektive Verwandlung von Wein und Brot, dafür mit Laienkelch, Priesterehe und der Messe in der Volkssprache reichsrechtlich als Augsburger Konfession anerkannt. Noch einmal versucht der Kaiser danach, das Rad zurückzudrehen. Doch der Sieg bei Mühlberg 1547 über den protestantischen Schmalkaldischen Bund kommt zu spät. Das erste Mal verbündet sich mit dem Kurfürsten Moritz von Sachsen ein Reichsfürst mit dem französischen König gegen das Reich, ein trüber Ausblick auf die Zeit nach 1648.
1555 kommt es schließlich in Augsburg zum Religions- und Landfrieden, der bis 1618 halten wird und Deutschland konfessionell teilt. Nicht die Untertanen, der Landesherr bestimmt über die Religion, cuius regio eius religio sollte man das nennen, auch wenn der Satz nirgendwo geschrieben steht. Wer damit nicht leben will, hat das Recht zur Auswanderung. Nicht der Kaiser ist länger der Schutzschild der Kirche, sondern die Reichsstände sind die Garanten einer eingeschränkten Glaubensfreiheit. Doch diese Freiheit ist teuer erkauft mit der Verstaatlichung der Kirche und ihres Gutes durch evangelische wie katholische Fürsten. Staatskirchentum wird das später heißen. An die Stelle des wohlgeordneten Kosmos der mittelalterlichen Weltordnung mit dem kunstvollen Stufenbau weltlicher und geistlicher Sphären ist das Chaos rein säkularer Machtinteressen getreten. Das mittelalterliche Kaisertum ist zu Ende, und Karl V. verdämmert seine letzten Jahre in einem spanischen Kloster.
Wenn das Reich dennoch einen verhältnismäßig langen Zeitraum einen unsicheren Frieden genießt, dann verdankt es das der Schwäche seiner Nachbarn, besonders Frankreichs, das durch die Kämpfe zwischen den Hugenotten und der katholischen Liga gefesselt ist. Mit den Hugenotten tritt der linke, kämpferische Flügel des Protestantismus, der Calvinismus, in die europäische Geschichte. Von ihm geht auch neue Unordnung in Deutschland aus, da er in Augsburg nicht berücksichtigt wurde. Häufige Religionswechsel mit gewaltsamen Auseinandersetzungen auch zwischen Lutheranern und Calvinisten sind die Folge. Schließlich sammeln sich die Calvinisten in der protestantischen Union, der die Katholiken wie in Frankreich eine Liga entgegenstellen.
Der Dreißigjährige Krieg beginnt in Böhmen, im Herzland der Habsburger, das die Calvinisten und ihr Führer, der Pfalzgraf, nach dem Tod des kinderlosen Kaisers Matthias dem alten Glauben entreißen und damit die katholische Mehrheit im Kurfürstenkollegium brechen wollen. Es sind eigentlich mehrere Kriege, immer wieder unterbrochen von Perioden relativer Ruhe. Zu Beginn geht es um Böhmen, später um Deutschland, am Ende um Europa. Den von den protestantischen böhmischen Ständen erwählten Pfalzgrafen besiegt ein kaiserliches Heer in der Schlacht am Weißen Berge. Um die Überwältigung des Protestantismus zu verhindern, tritt Dänemark an die Spitze der deutschen calvinistischen Protestanten. Als seine Kraft zu erlahmen droht, rettet Schweden die sogenannte protestantische Sache auch gegen den Willen der protestantischen Brandenburger und Sachsen, und als auch dessen Kraft nachlässt, greift das wieder erstarkte Frankreich unter Richelieu an der Seite Schwedens in den Krieg ein, während auf der Seite Habsburgs die Spanier durch Deutschland ziehen.
Je länger der Krieg dauert, desto europäischer wird er und desto weniger geht es um Religion und Glaubensfreiheit. Mochte das für Gustav Adolf, den frommen Lutheraner, noch der Hauptantrieb sein, so zählt für Kardinal Richelieu nach dem Tode des Königs bei Lützen allein die französische Staatsraison, und die ist antihabsburgisch und deshalb an der evangelischen Freiheit nur insoweit interessiert, wie diese den Interessen der katholischen französischen Monarchie nützt. Der Krieg, der am Ende in eine allgemeine Schlächterei ausartet, der in Deutschland ein Drittel der Bevölkerung, in manchen Gebieten wie der Mark Brandenburg sogar mehr als die Hälfte zum Opfer fällt, hat nichts Heroisches, kennt keine großen Taten, nur Mordbrennerei, Raub und Plünderungen wie die Zerstörung Magdeburgs. Die Schweden allein sollen fast zweitausend Schlösser, achtzehnhundert Dörfer und über fünfzehnhundert Städte zerstört haben. Böhmen verlor fünf Sechstel seiner Dörfer und drei Viertel seiner Bevölkerung. Die Bevölkerung von Colmar sank auf die Hälfte, die von Wolfenbüttel auf ein Achtel, die von Magdeburg auf ein Zehntel, die von Hagenau auf ein Fünftel und die von Olmütz auf weniger als ein Fünfzehntel. Auch wenn manche Historiker die Exaktheit dieser Zahlen bezweifeln, der Aderlass war gewaltig. Die Bevölkerung Marburgs, das zwölf Mal besetzt war, schrumpfte auf die Hälfte zusammen, die städtischen Schulden vergrößerten sich auf das Siebenfache; zweihundert Jahre später zahlten die Bürger noch immer Zinsen für die während des Krieges aufgelegten Anleihen. Bis zu zweihundert Schiffe waren vor 1621 jährlich aus den Häfen Ostfrieslands über den Sund gesegelt; im letzten Jahrzehnt des Krieges war der Jahresdurchschnitt zehn.
Zwar bringt auch dieser Krieg einige große Gestalten hervor, so den von den Protestanten als Licht des Nordens verehrten Schwedenkönig oder den düster-melancholischen Glücksritter Wallenstein, dessen Palais in Prag noch heute von seinem erlesenen Geschmack zeugt und dessen undurchsichtiges, von Sterndeutern beeinflusstes Verhalten vor und nach seinem Tod Anlass bot für allerlei Spekulationen über einen dritten Weg zwischen Habsburg und französischem Geld, über ein deutsches Nationalkönigtum mit ihm als dem ersten einer neuen Dynastie. Doch für die leidenden Menschen ist der Krieg so grausam und sinnlos wie ihn Grimmelshausen in seinem Simplicissimus geschildert hat oder später mit neuen, aber ganz ähnlichen Erfahrungen Bertolt Brecht in seiner Mutter Courage. Zu guter letzt wird Frieden geschlossen, weil die Erschöpfung allgemein ist, weil nichts mehr da ist zu plündern, weil nicht bestellte Felder und verlassene Dörfer die Soldaten nicht ernähren können.
Am Ende dieses gnadenlosen Ringens steht ein Friede, der die Verfassung des Reiches zu einer von Frankreich und Schweden garantierten europäischen Angelegenheit macht. Im Inneren erhalten die Fürsten die volle Landeshoheit und können Bündnisse untereinander und mit ausländischen Mächten schließen. Die Reichsinstitutionen werden paritätisch von Katholiken und Protestanten besetzt, die getrennt über die Reichsangelegenheiten beraten und folglich nicht mehr majorisiert werden können. Das Reich – so hat es der schwedische Kanzler Oxenstierna, einer der Architekten der neuen Ordnung, ausgedrückt – ist künftig eine Anarchie, die durch die Hand des Herren erhalten wird. Es ist der weiche Kern des europäischen Staatensystems, dessen Glieder wie die Gewichte auf der Waage das Gleichgewicht zwischen den Flügelmächten England, Frankreich, Schweden, Russland und dem Osmanischen Reich ausbalancieren.
All diese Staaten konnten an einer starken Mitte, einer staufischen oder habsburgischen Wiedergeburt kein Interesse haben, weshalb der spätere französische Ministerpräsident Thiers noch 1866 formulierte, dass das oberste Prinzip europäischer Politik darin besteht, dass sich Deutschland aus unabhängigen Staaten zusammensetzt, die nur durch einen losen föderativen Faden verbunden sind. Es ist deshalb nur zu verständlich, wenn der britische Premier Disraeli am Ende des 19. Jahrhunderts die Bismarck’sche Reichsgründung, also die Überwindung der völkerrechtlichen Ordnung von 1648, als die größte Revolution im 19. Jahrhundert bezeichnet hat, größer als die französische. Aber das allergrößte Wunder ist die Tatsache, dass diese Ordnung bis zum Jahre 1806 hielt, von den Juristen ehrfürchtig als ein Monstrum bewacht. »Das liebe heilige Römische Reich, wie hält’s nur noch zusammen«, singen in Goethes Faust die Studenten in Auerbachs Keller. Es hielt, weil alle anderen wollten, dass es halte. Erst Napoleon beendete mit einem Federstrich das vertraute Gebilde. Er glaubte, es nicht mehr nötig zu haben, da er selbst die Rolle Karls des Großen, Friedrichs von Hohenstaufen und Karls V. zu Ende spielen wollte. Dass er damit die Grundlage für die deutsche Einheit unter Preußens Führung legte, hat ihm ein berühmter französischer Geschichtsschreiber – Jacques Bainville – im Jahre 1915 vorgehalten, als Frankreich gegen das neue Deutschland um sein Überleben kämpfte und sich nach der in Münster und Osnabrück begründeten Ordnung zurücksehnte.