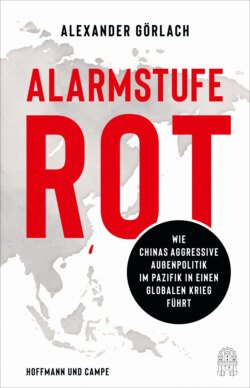Читать книгу Alarmstufe Rot - Alexander Görlach - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung Taiwan auf den ersten Blick
ОглавлениеTaiwan ist eine in vieler Hinsicht ungewöhnliche Insel. Das satte Grün ihrer tropischen Vegetation, das, vom Meer kommend, schon von weitem sichtbar ist und von den blauen Wogen des Westpazifiks reflektiert wird, hat schon die portugiesischen Seefahrenden fasziniert, die an diesem Eiland vorbeikamen und es kurzerhand, von seinem Aussehen überwältigt, »Formosa«, »die Schöne«, tauften. Noch heute dehnen sich atemberaubende Naturparks entlang der ganzen Ostflanke Taiwans aus. Auf dieser Seite der Insel wuchert die Vegetation über die Berge und Hügel, die steil abfallen und fast nahtlos ins Meer übergehen. Zwischen den Steilhängen und dem Strand bleibt an vielen Stellen nur noch Platz für die Eisenbahnlinie und die parallel dazu verlaufende Straße.
Diese Naturparks reichen bis zum geographischen Mittelpunkt der Insel, wo sich auch der höchste Berg Ostasiens, der Yu Shan, übersetzt Jadeberg, befindet. Sein ikonischer Gipfel liegt 3592 Meter über der Meeresoberfläche und ragt majestätisch aus dem Meer der ihn umgebenden Gebirgskette und ihren Wipfeln heraus. Wenn er im Winter karg und matt leuchtet, dann erinnert sein Farbspiel die Menschen an Jade. In der chinesischen Kultur gilt Jade als königlicher Stein, viele Skulpturen des Buddha sind deshalb aus diesem Material hergestellt. Das chinesische Schriftzeichen für König und Jade sind eng miteinander verwandt, 玉 für Jade und 王 für König. Taiwan ist eine Demokratie und hat somit keinen König, der als »Sohn des Himmels« über die Insel herrschen soll, wie einst die Kaiser des benachbarten China. Heute soll Jade daher jeder und jedem Glück und Segen bringen und das Leben derer bewahren, die ihn tragen.
Westlich des Yu Shan senken sich die Berge, und in dem dort beginnenden Tiefland liegen die großen Städte des Landes, in denen die Mehrheit der rund 23 Millionen Taiwanesen lebt. Die Hauptstadt Taipeh im Norden bevölkern allein rund 2,6 Millionen Menschen. Wer dort im Hauptbahnhof in einen Schnellzug, einen gāo tiě, steigt, der braucht viereinhalb Stunden bis zum Südzipfel der Insel, der 450 Kilometer entfernten Stadt Hengchun, die im Norden von einem weiteren Naturpark gesäumt wird. Dabei geht es im sauberen, klimatisierten, stets auf die Sekunde pünktlich verkehrenden Zug vorbei an Taichung, Tainan und Kaohsiung. Das sind Millionenstädte, von denen in Europa die wenigsten Menschen je gehört haben.
In Deutschland war Taiwan vor einigen Jahrzehnten ein Synonym für Textilindustrie. Es ist eine meiner Kindheitserinnerungen, die mir wieder in den Sinn kam, als ich den Umzug auf die Insel plante. »Mama, wo liegt Taiwan?«, fragte ich meine Mutter, nachdem ich einen Aufnäher »Made in Taiwan« in meinem neuen T-Shirt entdeckt hatte. Sie zog meinen Globus, der seinen Platz neben meinen Ausgaben der Was ist Was?-Kinderbuchreihe hatte, aus dem Regal, räumte mit einem Fuß die bei den Grundschülern meiner Generation beliebten Pelikan-Wachsstifte zur Seite, stellte ihn ab, drehte und hielt ihn dann mit ihrem Zeigefinger an: »Hier«, sagte sie, begleitet vom Tock-Tock eines tippenden Fingernagels, »liegt Taiwan, junger Mann.«
Anders als in meiner Kindheit, als meine Mutter mir die Insel auf dem Globus zeigte, ist Taiwan heute kein Niedriglohnland mehr, das sich durch günstige Textilproduktion einen Platz im Gefüge der Weltwirtschaft sicherte. Das Land ist zu einem der sogenannten asiatischen Tiger geworden. Gemeint sind damit Taiwan, Singapur, Südkorea und Japan, vier Länder, die nach dem Zweiten Weltkrieg, nach fundamentalen wirtschaftlichen Reformen, einen Aufschwung hingelegt haben, der weltweit seinesgleichen sucht. In Taiwan werden heute die Chips hergestellt, die überall auf der Welt in Smartphones, Tablets und Fotoapparaten landen. Entsprechend ist die Insel von großer Bedeutung für die Weltwirtschaft.
Als Andrew und ich uns auf den Umzug nach Taiwan vorbereiteten, wussten wir nicht mehr über die Insel als das, was gelegentlich in der Zeitung zu lesen war. Da der Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik in den vergangenen Jahren eskaliert ist, kann man mittlerweile mehr über die Inselrepublik in den Medien finden als noch vor wenigen Jahren.
Der offizielle Name des Landes lautet im Übrigen nicht Taiwan, sondern »Republik China«. Damit unterscheidet er sich nur durch das Präfix »Volks-« von dem des riesigen Nachbarn, dessen Ufer rund 160 Kilometer vor seiner Westküste liegt. Die »Volksrepublik China« und die »Republik China« sind nicht einfach nur Nachbarn, sondern verfeindete Kriegsparteien eines blutigen und langen Bürgerkriegs, der vor fast einem Jahrhundert, im Jahr 1927, begann und 22 Jahre später, im Jahr 1949, endete. Für die Taiwanesen, die in Taichung, Tainan und Kaohsiung über das Meer hinüber in Richtung China blicken, bildet die Wasserstraße zwischen ihrer Insel und dem Festland eine natürliche Grenze. Viele Menschen auf der anderen Seite, in der Volksrepublik, jedoch betrachten Taiwan als Territorium ihres Landes und das Meer zwischen ihnen als einen Teil des chinesischen Staatsgebietes. Diese Wasserstraße war deshalb in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Schauplatz militärischer Konfrontation zwischen China auf der einen und Taiwan und den USA, dem wichtigsten Verbündeten Taiwans, auf der anderen Seite.
Vor unserer Ankunft im Sommer 2017 war dieser Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Bürgerkriegsparteien wieder einmal eskaliert. Im Januar 2016 wurde mit Tsai Ing-wen zum ersten Mal eine Politikerin der DFP-Partei zur Präsidentin Taiwans gewählt. Die »Demokratische Fortschrittspartei« steht für einen neuen Kurs gegenüber Peking, was der Nomenklatura der Kommunistischen Partei in der Volksrepublik überhaupt nicht schmeckt. Als Strafe für das Wahlergebnis verbot Peking deshalb kurzerhand den Tourismus auf die wunderschöne Insel, die sich auch in China großer Beliebtheit erfreut. Das war nur der Anfang. Mittlerweile hat sich der Konflikt verbal weiter hochgeschaukelt bis hin zur offenen Kriegs- und Annexionsankündigung. Die Angst geht um vor einem Angriffskrieg, mit dem das totalitäre China seinen demokratischen Nachbarn unterjochen könnte. Immer wieder dringen chinesische Kampfjets in den taiwanesischen Luftraum ein, seit dem Frühjahr 2021 in einer bis dahin unbekannten Zahl und Häufigkeit. Es soll die Menschen auf Taiwan einschüchtern.
Die Taiwanesinnen und Taiwanesen lassen sich allerdings nicht beirren. Sie haben das Schicksal des benachbarten Hongkong vor Augen, das durch ein sogenanntes Sicherheitsgesetz, das die chinesische Führung während der Coronapandemie durchgesetzt hat, seiner Freiheit und Autonomie beraubt wurde. Die Androhung Xi Jinpings, Taiwan militärisch erobern zu wollen, im Ohr, haben die Menschen Tsai Ing-wen im Januar 2020 mit einem Ergebnis von 57,13 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt. Das entspricht rund 7,8 Millionen der wahlberechtigten Einwohner der Insel. Im Wahlkampf erklärte sich Tsai mit den Menschen in Hongkong solidarisch und schwor, die Demokratie auf der Insel gegen Chinas Aggression zu verteidigen. Dieses entschiedene Auftreten gegen China und für die Demokratie brachte ihr den Wahlsieg ein.
Wenn es auf Taiwan nicht um Politik geht, dreht sich das tägliche Leben auf der Insel vor allem ums Kochen und Essen, Aktivitäten, denen sehr viel Zeit geschenkt wird. Es ist eingeübte Praxis während des Mittagessens bereits über die Speisen des nächsten Tages zu sinnieren und sie vor dem geistigen Auge vorzubereiten (die Einkäufe für das Abendessen sind da bereits abgeschlossen). Taiwan hat an Herd und Grill viel zu bieten. Am Ende des Bürgerkriegs kamen mit den besiegten Streitkräften der untergehenden Republik aus allen Landesteilen Chinas Menschen nach Taiwan, die vor Mao und seinen Truppen flohen. Und sie brachten ihre regionalen Küchen mit in das neue Leben auf der Insel. Auch heute noch strömen die Menschen Abend für Abend zu Tausenden auf die Nachtmärkte, um durch enge Gässchen, vorbei an den unzähligen Ständen mit ausgestellten Leckereien, zu flanieren, deren kochende Eigentümer ehrfürchtig entweder als laoban, Chef, oder als laobaniang, Chefin, angesprochen werden. Gegrilltes Hähnchen oder Tintenfisch am Spieß, Schweinebauch im Teigmantel, Süßkartoffelknödel, taiwanesische Würste, Frühlingszwiebel-Pfannkuchen, frittiertes Hühnchen und Austern. Für den gestählten Magen gibt es stinky tofu, fermentiertes Tofu, das, wie der Name schon sagt, einen charakteristischen, für das westliche Geschmacksempfinden eher gewöhnungsbedürftigen Geruch verströmt. Im Buhlen um die Kundschaft versuchen sich die Chefinnen und Chefs lautstark zu übertreffen, der Geräuschpegel auf den Märkten ist entsprechend.
Den Besten unter den Besten kann dabei schon einmal eine große Ehre zuteilwerden: Einer Großmutter in Taipeh wurde für ihre Rindernudelsuppe ein renommierter Michelin-Stern für »Street Food« verliehen. Die Urkunde hängt, mit den kläglichen Resten einer Farbpatrone ausgedruckt und von der Sonne verblasst, hinter einer vom Fett speckig gewordenen Klarsichtfolie an der Wand ihrer Küche, vor der sich täglich die Menschen in gesitteten Schlangen aufreihen, um eine Portion zu erstehen.
Der Michelin-Stern der alten Frau dürfte der einzige geduldete Stern auf rotem Grund in der Hauptstadt der demokratischen Inselrepublik sein. Denn die Taiwanesen sind stolz auf ihre Demokratie und die Weltoffenheit, die sich von dem Leben im autoritären China nebenan grundlegend unterscheidet. In Umfragen gibt die überwältigende Mehrheit der Taiwanesen an, dass ihr Land und die Volksrepublik zwei verschiedene Länder seien. Vor allem die junge Generation ist dieser Meinung. Sie ist die erste, die im freien und demokratischen Taiwan aufgewachsen und nun bereit ist, diese Freiheit auch zu verteidigen. Bis zum Ende der achtziger Jahre war die »Republik China« wie die Volksrepublik ein totalitärer Staat. In der Stadt Kaohsiung, in der wir hinter dem Konzerthaus und neben der Kaohsiung Normal University eine Wohnung bezogen, erinnert ein Museum an die lange bleierne Zeit, in der die Insel unter der Bevormundung der nach Taiwan geflüchteten Kuomintang litt, jener im Chinesischen Bürgerkrieg unterlegenen Partei, die heute der Mitbewerber der Demokratischen Fortschrittspartei ist. Das Museum dokumentiert den Aufstand, der am 28. Februar 1947 begann und der aufgrund des Datums abgekürzt »228« genannt wird. Damals erhoben sich die Menschen, die auf Taiwan lebten, gegen die Zuzügler. Es sollen rund zwei Millionen Menschen gewesen sein, die vom Festland geflohen waren und die das Leben auf der Insel für immer verändern sollten. Der Aufstand, der nicht nur in Kaohsiung, sondern überall auf der Insel stattfand, brachte dem Land 40 Jahre Kriegsrecht, mit Tausenden Toten und politischen Gefangenen, ein (mehr dazu in Kapitel 3).
Mein Partner, der die Volksrepublik nach der Emigration in die USA regelmäßig besucht hat, kannte das Narrativ, das in der Volksrepublik bezüglich Taiwan vorherrscht, nur zu gut. Demnach ist Taiwan eine Provinz der Volksrepublik, die taiwanesische Regierung eine Scheinregierung und die Wiedervereinigung der abtrünnigen Insel mit dem »Da Lu«, dem »Mainland« oder »Festland«, heilige Pflicht. Wie groß können sich die Menschen hier und da, auf beiden Seiten der Wasserstraße, schon unterscheiden, mag Andrew sich gefragt haben, bevor wir in die »abtrünnige Provinz« zogen. Schließlich teilen beide dasselbe politische, kulturelle, philosophische Erbe. Beide sprechen dieselbe Sprache. Aber das eine Land ist heute eine Demokratie, das andere eine Diktatur. An der Gegenüberstellung der beiden Länder wird ein zentraler Aspekt jeder Identitätsfindung sichtbar. Die Betonung der Vergangenheit, also von Herkunft und Religion, grenzt aus, immer. Die großen Narrative der Vergangenheit, die Harari so treffend freigelegt und definiert hat, unterteilen die Wirklichkeit in nationale, in ethnische, in religiöse Parzellen. Jene außerhalb dieser Parzellen werden nicht nur als die »anderen« definiert, ihr Anderssein wird im selben Atemzug mit nicht gleichwertig gleichgesetzt.
Demokratien und Diktaturen arbeiten daher mit dem Bezug auf Religion und Herkunft in unterschiedlicher Weise: Für eine Demokratie ist die Vergangenheit zwar nicht überflüssig oder unnötig, aber nicht entscheidend. Die Debatte in Europa sieht in vielen Ländern ähnlich aus, die Frage, auf die eine Antwort gesucht wird, lautet: Ist Europa ein christlicher Kontinent? Ist, beispielsweise, Deutschland ein christliches Land? In einer Demokratie trägt eine auf die Vergangenheit gerichtete Identitätsbildung nichts Konstruktives bei, denn in der Vergangenheit, die von Populisten als Goldenes Zeitalter verklärt wird, hat keiner von den Heutigen gelebt. Die Bezugnahme kann also nur machtpolitischen Charakter haben, um die Strukturen des Heute mit dem Bezug auf die Autorität des Vergangenen zu adeln. So spricht der indische Premierminister Narendra Modi davon, dass Indien ein hinduistischer Staat sei, weil er historisch hinduistisch gewesen sei. Damit diskriminiert er, in voller Absicht, die 200 Millionen Muslime im Land, ohne die Pluralität, die es schon immer auf dem Subkontinent gegeben hat, zu erwähnen. Wenn die rechtsgerichteten Regierungen in Warschau und Budapest davon schwärmen, wie katholisch ihre Länder aufgrund ihres Erbes seien, zielen sie damit auf die Nichtkatholiken (muslimische Einwanderer), die in den Ländern angeblich nichts zu suchen hätten. Auch im China der Gegenwart ist eine solche ausgrenzende nationalistische Politik zum Standard geworden. Wir werden später darauf zurückkommen.
In einer Demokratie spielt das historische Erbe für das Hier und Jetzt keine übergeordnete Rolle. Denn die Dinge, die für das Leben im freiheitlichen, demokratischen Verfassungsstaat maßgeblich sind, sind Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit, der letzten 70 Jahre. Ihre geistigen Wurzeln liegen in der Aufklärung, deren Vertreter ihre Gedanken oft gegen die herrschende politische und religiöse Ordnung verteidigen mussten und für ihre Ideen nicht selten mit dem Leben bezahlt haben. Das heißt, es ist heute egal, dass Deutschland einmal ein christliches Land war und Europa das christliche Abendland genannt wurde. Heute kann nur entscheidend sein, ob und (falls ja) welchen Beitrag der religiöse Glaube der Bürgerinnen und Bürger für den Aufbau des freiheitlichen Gemeinwesens haben kann.
Für den Blick auf den Brennpunkt des Taiwan-China-Konflikts bedeutet das nichts weniger, als dass im heutigen Taiwan der Bezug auf das Erbe, das die Insel mit dem Festland gemeinsam haben soll, als nicht sachgemäß und hilfreich empfunden wird. Die wenigen noch lebenden Alten, die sich an das Ende des Bürgerkriegs und die Etablierung Taiwans erinnern, mögen das aufgrund ihrer Lebensgeschichte anders einordnen und beurteilen. In der Realität belegt sich die These von der Verschiedenheit der beiden trotz des gemeinsamen Erbes ganz einfach mit Hilfe eines Gedankenexperiments. Was würde geschehen, wenn beide Seiten sich morgen wiedervereinigten? Könnte Taiwan so bleiben, wie es ist? Wenn beide von denselben Parametern grundlegend geprägt worden sind, sollte eine Fusion doch ohne weiteres möglich sein. Doch der Blick nach Hongkong zeigt, dass dem nicht so ist.
Für mich sind bei der Unterscheidung der beiden Länder die philosophischen und ethischen Voraussetzungen, die zu dem geführt haben, was wir heute eine Demokratie nennen, entscheidend: Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, bürgerliche und soziale Freiheiten. Eine Ordnung ist dann legitim, wenn sie sich dazu verpflichtet, diese Prinzipien zu schützen und kontinuierlich an ihrer Verwirklichung zu arbeiten. Eine gerechte, menschenwürdige Gesellschaft fällt nicht vom Himmel, sondern ist Ergebnis eines zähen Ringens, das jede Generation eines Landes vor neue Herausforderungen und Aufgaben stellt. Taiwan ist heute so ein Land. Mit dem Kriegsrecht endete die Einparteienherrschaft, und der Weg wurde frei für eine plurale, freiheitliche Demokratie.
Der Gegenspieler dieser freiheitlichen Ordnung ist das autoritäre, diktatorische Modell. Hier wird Pluralität gegen die Behauptung einer monolithischen Einheitskultur eingetauscht. Vielfalt wird als Entartung gebrandmarkt und die vermeintlich homogene Masse zum Maßstab der Politik erklärt. Die Fassade einer solch erzwungenen Einheitlichkeit, der in der Wirklichkeit nichts entspricht, kann nur durch massive Repressionen, die Unterdrückung anderer Auffassungen, ja, jeder Regung, die auch nur im Entferntesten von der ausgegebenen Marschrichtung abweicht, aufrechterhalten werden. Die Volksrepublik China ist so ein Land. Und mögen diese Volksrepublik und die Republik China, das heutige Taiwan, auch auf ein gemeinsames, fünftausend Jahre währendes Erbe zurückschauen (ein Erbe, über das auch heute, in Zeiten maximalen Konflikts, zumindest der Versuch zur Verständigung unternommen werden könnte) – so sind sie heute, wie gesagt, doch komplett verschiedene Nationen. Die gemeinsame Vergangenheit kann die Gegensätze der Gegenwart nicht mehr überbrücken.
In der demokratischen Welt ist eine solche Umprägung, wie sie in China vor sich ging und wie sie sich die strongmen wünschen, nicht so einfach möglich. Ihnen stellt sich die Verfassung in den Weg, die kritische Öffentlichkeit, die Presse. Deshalb betreiben autokratische Machthaber gezielt Demagogie, wenn sie von einer »illiberalen Demokratie« schwärmen. Dieser rhetorische Griff will durch den Zusatz der kleinen Silbe »il-« das autoritäre Modell als gleichberechtigt neben das der liberalen Demokratie stellen, als ob es zwei ebenbürtige Varianten der Demokratie gäbe. Das ist nicht der Fall. Die illiberale Behauptung, dass eine Demokratie die Interessen der Mehrheit zu spiegeln habe, ist grundlegend falsch. Es gibt in Demokratien per definitionem keine Lebensweise, der sich alle zu beugen hätten. Die Pluralität der Lebenswege ist durch die Verfassung garantiert. Die Demokratie hat einen langen Weg zurückgelegt, aus ihrer Vorzeit, in der in der griechischen Polis nur der Hausherr und Familienvater öffentliche Ämter bekleiden durfte. Das Frauenwahlrecht wurde erkämpft, ebenso das Wahlrecht für Menschen nichtweißer Hautfarbe. Es ist gerade die Errungenschaft der Demokratie heute, dass nach der Wahl vor der Wahl bedeutet, was eine Vorherrschaft einer Partei oder einer Koalition über die anderen Parteien und die Menschen, die sie gewählt haben, ausschließt. In einem demokratischen Gemeinwesen gibt es Grundüberzeugungen, die die Verfassung hervorhebt und die alle politischen Akteure teilen. Um die richtige Politik wird nicht auf der Grundlage von Ethnie und Religion gerungen, sondern auf Basis von Fakten, die zu deuten und zu diskutieren allen freisteht.
Im illiberalen Ungarn von Victor Orbán werden Minderheiten gegängelt, Jüdinnen und Juden verunglimpft, im illiberalen Polen, in dem die herzlose Partei »Recht und Gerechtigkeit« regiert, gibt es Städte und Dörfer, in denen Menschen, die nicht heterosexuell sind, um ihr Leben fürchten müssen. »LGBT-freie Zonen« nennen die Befürworter des illiberalen Modells ihre Wohnorte und wecken damit bewusst die Erinnerung an die Zeit der Nazi-Besatzung und der Konzentrationslager. Die Nationalsozialisten schwärmten von »judenfreien« oder »judenreinen« Orten. Entsetzlich, wie sich die Anhänger des illiberalen Irrwegs in dem Land, das das erste Opfer von Hitlers Tyrannei war, eine faschistische Sprache und Politik zu eigen machen. Ungarn und Polen werden von den Machthabenden umgestaltet: Sie missachten und unterlaufen die demokratische Verfassung, um die Bürgerinnen und Bürger auf diese Weise in Menschen erster und zweiter Klasse einteilen zu können. Die Menschen zweiter Klasse sind dabei schnell ausgemacht: Journalistinnen und Journalisten, Kunstschaffende und Lehrende, die politische Opposition. Die Jagd auf die, die den Abbau der Demokratie verhindern wollen, hat begonnen. Sie werden als »Feinde des Volkes« gebrandmarkt und ihrer Rechte beraubt.
Deshalb gilt: Eine Demokratie ist liberal, eine andere Form der Demokratie gibt es nicht. Der Zusatz »liberal« fügt der Bedeutung von Demokratie in diesem Sinne nichts hinzu. Die Vertreter des Illiberalen sind keine Demokraten, sondern Autokraten, die von Diktatoren lediglich trennt, dass sie die demokratischen Institutionen – Wahlen, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung – noch nicht völlig abgeschafft haben. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Protagonisten den totalen Umbau ihrer Gemeinwesen in Diktaturen lieber heute als morgen verwirklichen würden. Doch noch könnten Wahlen die Verhältnisse umkehren. Viel Zeit bleiben Opposition und kritischer Öffentlichkeit nicht mehr in Ländern wie Polen, Ungarn oder der Türkei – Demokratien, die von Autokraten durch Verfassungsänderungen, Machtrochaden und Eliminierung kritischer Presseorgane in Diktaturen umgewandelt werden sollen.
Chinas Machthaber Xi Jinping hingegen muss sich nicht mehr mit einer kritischen Öffentlichkeit und einer politischen Opposition herumschlagen. Im Nationalen Volkskongress sitzen Leute, die von der Kommunistischen Partei dafür ausgewählt wurden. Sie winken Gesetze, die von der Spitze des Apparats kommen, in einer Mammutsitzung durch, die einmal im Jahr im März stattfindet. Der nationalistische Kurs, den Xi dem Land verordnet hat, manifestiert sich in einer massiven Unterdrückung von ethnischen Minderheiten. So werden die Uiguren, die in der nordwestlichen Provinz Xinjiang leben, die Tibeter und die Mongolen massiv benachteiligt. Was in Xinjiang auf Geheiß von Präsident Xi und seiner Clique geschieht, kann in Deutschland nur die Erinnerung an das Dritte Reich hervorrufen. Über eine Million Uiguren sind in sogenannten Umerziehungslagern eingesperrt. Dort werden sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Sie sollen ihre Kultur und Religion ablegen. Die chinesische Führung hat die Existenz dieser Lager zunächst geleugnet. Satellitenbilder belegen allerdings ihre Existenz. Menschen, die dem Grauen entkommen und ins benachbarte Kasachstan geflohen sind, berichten den Medien, was sie erlebt haben.
Der Umgang mit Minderheiten in Taiwan ist selbstredend ein völlig anderer. Ich erinnere mich an eine Gastvorlesung, die ich an der Tamkang-Universität in Taiwan gehalten habe. Im Anschluss an die Lesung trat ein Student auf mich zu, und wir kamen ins Gespräch. Er erklärte mir, dass er sich politisch engagiere: »Wir sind für die Unabhängigkeit«, sagte er zu mir, worauf ich erwiderte, dass eine Unabhängigkeitserklärung der taiwanesischen Regierung zu unkalkulierbaren Reaktionen Pekings führen würde. »Nein, das meine ich nicht«, erwiderte er. »Wir vertreten die Ureinwohner Taiwans. Wir wollen unsere Insel zurück«, sagte er selbstbewusst und fügte an, dass er selbst auch zu der kleinen Gruppe der Ureinwohner gehöre. Die Umstehenden, die sich uns zuwandten, verfolgten interessiert unser Gespräch, niemand versuchte, den Kommilitonen am Reden zu hindern, niemand protestierte. Ich kann mir angesichts der Gräuel in Xinjiang nicht vorstellen, wie Angehörige einer der 55 ethnischen Minderheiten in der Volksrepublik eine solche Meinung artikulieren könnten, ohne dafür mit Repression und Gefängnis belegt zu werden.
Meine eigene Beobachtung ist, dass freie Rede, auch wenn sie noch so belanglose Themen zum Gegenstand hat, in der Volksrepublik nicht möglich ist. Diese Erfahrung habe ich bei Besuchen in Shanghai und Peking gemacht. Dort waren meine Gesprächspartner, wie man an ihrem Verhalten sehen konnte, immer besorgt, unsere Gespräche könnten vom Nebentisch aus oder von Umstehenden belauscht werden. Ob im Restaurant oder auf einer Rolltreppe, meine Gesprächspartner wandten sich stets um und schauten, wer sich in unserer Nähe aufhielt. Wir saßen deshalb stets abseits, so weit weg wie möglich von anderen Gästen. Ausländer haben in China einen schweren Stand. Die Rhetorik der Kommunistischen Partei möchte die Reihen nach innen schließen, was gleichzeitig bedeutet, dass alle und alles Auswärtige zu einer Gefahr stilisiert wird. Wenn wir doch einmal in Hörweite von anderen waren, fingen die Gesprächspartner ganz unvermittelt an zu betonen, welche Segnungen die Kommunistische Partei im Allgemeinen und Präsident Xi Jinping im Besonderen der Volksrepublik und ihren Bewohner gebracht habe. Es war in etwa so, als würde man in Deutschland während eines Gesprächs über die Bundesligaspiele des Wochenendes plötzlich beginnen, die Politik der Bundesregierung in höchsten Tönen zu loben.
Vollkommene Stille herrscht wiederum in den Fahrzeugen des Dienstleisters »Didi«, dem chinesischen Pendant von »Uber«, denn in den Wagen werden alle Gespräche aufgezeichnet. Was angeblich der Sicherheit der Fahrgäste dienen soll, ist meiner Meinung nach in Wirklichkeit der größte Flächenangriff auf die Privatsphäre und freie Meinungsäußerung der Gegenwart. Man stelle sich vor, jedes Wort, das in einem Taxi in Deutschland dahergesagt wird, könnte potenziell von der Bundesregierung gegen einen verwendet werden, zu staatlicher Repression und zu Gefängnis führen.
Für Ausländer tritt die Sorge darüber, abgehört zu werden, indes in den Hintergrund, denn die Bemühung, überhaupt ein Taxi zu bekommen, nimmt einen völlig in Beschlag. Taxifahrer fahren ohne mit der Wimper zu zucken an einem vorbei, auch wenn man mit einer Chinesin oder einem Chinesen, die häufig als Übersetzer fungieren, ein Fahrzeug herbeiwinken möchte. Lieber macht man kein Geschäft als ein Geschäft mit einem Ausländer. Die nationalistische Politik der KP schlägt hier voll durch. Doch damit nicht genug: Während meines Besuchs in Peking war die Anzahl der Ausländer, die in einer Bar oder einer Gaststätte »zulässig« waren, per Aushang an der Tür geregelt, eine Tatsache, die in der freien Welt zu einem Aufschrei und zum Boykott der jeweiligen Betriebe führen würde. Es versteht sich, dass nicht alle Menschen in China so ticken. Mir haben wirklich nette Menschen geholfen, in der U-Bahn den richtigen Anschluss zu finden oder den Weg zu zeigen. Sie trauen sich, sich einen Spielraum zwischen verordneter Wirklichkeit und menschlichem Miteinander zu erkämpfen.
In der Volksrepublik herrscht oft eine sonderbare Stille der selbst verordneten Zensur. Taiwans Demokratie hingegen ist laut und jung und manchmal mühsam. Es gibt mehrere Parteien, die um die Stimmen der Wähler kämpfen. Zu den größten gehört zum einen die »Nationale Volkspartei Chinas«, Kuomintang (KMT). Das ist jene Partei, die ab 1927 die Republik China auf dem Festland führte, 1949 nach Taiwan emigrierte und dort über Jahrzehnte das Kriegsrecht aufrechterhielt. Diese Partei stand bis dato auch für eine Annäherung an die Volksrepublik, für die eine »Wiedervereinigung« mit der Insel zu den vordersten politischen Zielen gehört. Auch Präsident Xi Jinping hat seit Beginn seiner Amtszeit dieses Ziel artikuliert und nicht aus den Augen verloren.
In den neunziger Jahren kam die DFP dazu, die Demokratische Fortschrittspartei, der Präsidentin Tsai Ing-wen angehört. Kleinere Parteien wie die »New Power Party«, die aus einer studentischen Bewegung im Jahr 2014 entstand, bereichern die politische Szene. Es gibt verschiedene Medien im Land. Es gibt öffentlich geführte Diskussionen und bisweilen auch Streit – so, wie es für plurale, demokratische und freiheitliche Gemeinwesen selbstverständlich ist. Taiwan ist das erste asiatische Land, das die »Ehe für alle« eingeführt hat und damit den Anspruch seiner Verfassung unterstreicht, alle Menschen im Land gleich zu behandeln.
Wann immer mein Flugzeug vom Boden der Volksrepublik abhob, war ich froh. Trotz der netten Begegnungen und guten Gespräche, trotz des guten Essens. Mit der abhebenden Maschine ließ ich nicht nur die Volksrepublik hinter mir, sondern mit ihr auch das Gefühl, stets beobachtet und nicht wirklich sicher zu sein. Gerade wegen dieses Gefühls wird die Lust darauf, aufs Festland zurückzukehren, von Mal zu Mal kleiner.
Anders verhält es sich mit Taiwan. Jedes Mal, wenn ich die Insel verlassen musste, zählte ich zerknirscht die Tage, bis ich endlich wieder würde zurückkehren können auf dieses entspannte, freie Eiland, dessen Natur so wunderbar, dessen Nachtmärkte so leb- und schmackhaft und dessen Bewohner so herzlich sind. Eine Rindernudelsuppe schmeckt besser in Freiheit.