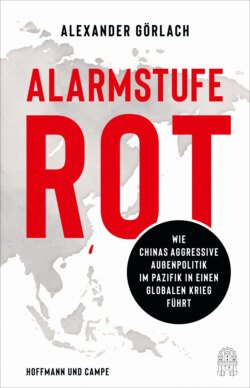Читать книгу Alarmstufe Rot - Alexander Görlach - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Der Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik China
ОглавлениеDer einzige tägliche Konflikt, den die Menschen auf der Insel austragen, der nichts mit der nebenan gelegenen Volksrepublik zu tun hat, scheint der mit dem Wetter zu sein. Bei unserer Ankunft Anfang August herrschten Temperaturen weit jenseits der 30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent. Taiwan ist eine tropische Insel. Die typische Schwüle an einem solchen Ort fühlt man auf Postkarten nicht. Wer kann, bleibt zu Hause. Wem diese Möglichkeit nicht gegeben ist, der hangelt sich von Klimaanlage zu Klimaanlage. Wir landeten auf dem Internationalen Flughafen von Kaohsiung, einer Handelsstadt am Südzipfel Taiwans. Das einstige Fischerdorf, von dessen früherer Gestalt sich nur noch in den Hafenvierteln ein flüchtiges Bild erahnen lässt, ist zu einer Metropole geworden. Kaohsiung ist heute mit seinen rund 2,7 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt auf der Insel. Das Stadtbild wird von Shopping Malls geprägt, die in Asien allgemein, nicht nur in Taiwan, wahrscheinlich aufgrund des Wetters, mehr sind als reine Einkaufsgelegenheiten. Häufig sind das Kellergeschoss oder höher gelegene Stockwerke für Restaurants, Bistros und Schnellimbiss-Ketten reserviert. Menschen halten sich also tatsächlich in ihrer Freizeit in den herrlich heruntergekühlten Kommerztempeln auf.
Der einzige Ort, an dem es mit voller Absicht keine erholsame Kühlung gibt, sind die Schulen. Andrew erlebte an seinem ersten Unterrichtstag sein schwitziges Wunder. Öffentliche Gebäude auf Taiwan sind häufig mit überdachten Wandelgängen in den Höfen versehen. Es gibt offene Treppenhäuser und luftige Korridore auf jedem Stockwerk, die zwischen drinnen und draußen vermitteln. Das ist architektonisch reizvoll, ist aber angesichts des Klimas wenig funktional. Die schwül-heiße Phase setzt sich bis in den Oktober fort, erst dann wird das Wetter erträglich. Bis in den April hinein herrschen am Tag menschenfreundliche Temperaturen bis maximal 24 Grad, zumindest im Süden der Insel. Die Sonne wird dann nicht mehr als permanente Kriegserklärung an Haut und Gemüt des Menschen betrachtet, die Luftfeuchtigkeit ist erträglich. Im Norden kann es im Winter, für taiwanesische Verhältnisse, richtig kalt werden: 10 Grad, maximal 11, und jede Menge Regen. Die Kälte kriecht unter die Haut und setzt sich in den Knochen fest. Taifun-Warnungen gibt es zudem im Norden ständig. Manchmal ziehen die Stürme an der Insel vorbei, bei anderer Gelegenheit schlagen sie zu und sorgen für Stromausfälle und am nächsten Tag für Rücktritte im Energieministerium.
Die Insel wird von heftigem Smog geplagt, der im Winter besonders schlimm ist. Von Kaohsiung bis Taipeh machen sie dafür Fabriken in der Volksrepublik verantwortlich, deren Abgase über die Taiwanstraße, die an der engsten Stelle nur 130 Kilometer breit ist, herüberzögen. Aber die vielen tausend Scooter, die täglich durch Taiwans Städte knattern, leisten wirklich keinen Beitrag für das Klima. Im Straßenverkehr war daher eine Maske schon lange vor der Coronapandemie angezeigt. Es mag ein Kennzeichen einer vom Konfuzianismus geprägten Gesellschaft sein, in der den Älteren besonderer Respekt entgegengebracht wird: In Kaohsiung rollen ältere Verkehrsteilnehmende ihrem Ziel entgegen, ohne den Verkehrsschildern Beachtung zu schenken. Offensichtlich erlangt man mit dem Alter auch das Vorfahrtsrecht.
Das Thema Abgase ist eines von vielen, die das angespannte Verhältnis zwischen Taiwan und der Volksrepublik nebenan spiegeln. Für Taiwan ist die Volksrepublik die Gefahr vor der eigenen Haustür, der böse Nachbar, der, dem Schiller-Wort gemäß, die Frömmsten auf Taiwan nicht in Frieden leben lässt, weil es ihm nicht gefällt. Der Kampf mutet an wie der biblische Zweikampf zwischen David und Goliath: das kleine Taiwan, das sich gegen den Riesen verteidigen muss. Auf die heutige Situation bezogen ist das korrekt. Das Kräfteverhältnis war aber nicht immer so.
Nach dem Chinesischen Bürgerkrieg, aus dem die Maoisten siegreich hervorgingen, versank die neu gegründete Volksrepublik zuerst einmal für zweieinhalb Jahrzehnte im Chaos. In dieser Zeit wurde Taiwan der stärkere der beiden Kontrahenten, dessen Anführer schworen, das Land der Vorfahren zurückzuerobern. Mao Zedongs ideologische Irrfahrt kostete unzählige Menschen das Leben: 30 Millionen sollen dem »Großen Sprung nach vorn«, der in den Jahren 1958 bis 1962 die Republik China in eine kommunistische Gesellschaft verwandeln sollte, durch Hunger zum Opfer gefallen sein. Die daran anschließende »Kulturrevolution« (1966–1976) kostete abermals Unzählige das Leben. Schätzungen sprechen von 20 Millionen Menschen.
Während die Volksrepublik ums Überleben kämpfte, entwickelte sich Taiwan zu einem der asiatischen Kraftzentren, in denen die Wirtschaftsleistung explodierte und sich zuvor nicht gekannter Wohlstand einstellte. Die Hafenmetropole Kaohsiung, unsere Wahlheimat, wurde in dieser Zeit zu einer der großen Produktionsstätten der Insel. Joe Studwell hat in seinem Buch How Asia Works (2013) beschrieben, wie die seit den achtziger Jahren gern als »Tigerstaaten« bezeichneten Länder Südkorea, Japan und Taiwan über die Zeit zu ihrem beispiellosen Erfolg gelangt sind. Studwell beschreibt diesen Prozess als dreistufig. Eine umfassende Landreform bildete dabei die erste Stufe, die den Bauern durch die Zuteilung von mehr Land erlaubte, mehr von dem zu tun, worin sie gut waren. Zudem erhielt jeder einen kleinen Besitz, mit dem er wirtschaften konnte. Auf diese Weise hatten alle Zugang zu einer marktgetriebenen Ökonomie. Der Erfolg auf dieser Mikroebene führte zu einer mäßigen Verbesserung des Lebensstandards. Diese zweite Stufe ermöglichte schließlich der Bevölkerung den Zugang zu Bildung, der dritten Stufe, die sie für den weiteren Ausbau der Wirtschaft qualifizierte.
Die Auffassung, dass Bildung zentral für den Aufstieg ist, spiegelt sich bis heute in den Gesellschaften Ostasiens wider. Die Schülerinnen und Schüler, die mein Partner tagsüber unterrichtete, gingen am Nachmittag, nach acht oder neun Schulstunden, einmal über die Straße, in die nächste Schule, die »Gramm School«, in der sie Hausaufgaben machten und Nachhilfe in den Fächern erhielten, in denen sie nicht glänzten. Der Druck, der auf den Jugendlichen lastet, ist enorm. Die Leistung, mit der in wenigen Jahrzehnten aus der armen Insel Taiwan ein hochmoderner, digitaler Staat mit exzellenter Gesundheitsversorgung und guten Schulen gemacht wurde, ist allerdings nicht minder enorm. Grundlage für diese Weichenstellung war, wie gesagt, jene Landreform, die gepaart mit staatlichen Investitionen in die Infrastruktur und in für die Landwirtschaft zentrale Komponenten wie Düngemittel, die Grundlage für diesen Erfolg legte. Gleichzeitig, so Studwell, wurden Kredite nur innerhalb des Landes vergeben, Kapital durfte nicht ins Ausland abfließen. Investitionen aus dem Ausland wurden verunmöglicht. Die Renditeerwartung der Investoren hätte das Wachstum auf der Insel ausgebremst. All dies bereitete die Landbevölkerung auf den nächsten Schritt der ökonomischen Reform vor: Es begann die Zeit der Textilverarbeitung, also jene Phase, in der ich das Schildchen »Made in Taiwan« in meinem T-Shirt entdeckte. Taiwan positionierte sich so bereits in den frühen Jahren der Globalisierung als ein ernst zu nehmender Player im Welthandel.
Taiwan verdankt seinen rasanten Aufstieg nicht zuletzt der Unterstützung seines Verbündeten, der Vereinigten Staaten von Amerika. Es waren die USA, die in den siebziger Jahren den Plan unterstützten, aus Taiwan einen führenden Chip-Hersteller zu machen. Die Republik China in Taiwan trat so in den siebziger Jahren in ein neues goldenes Wohlstandszeitalter ein, während die Menschen in der Volksrepublik hungerten und politischen Säuberungsaktionen zum Opfer fielen. In dieser Situation war Taiwan die stärkere der beiden ehemaligen Bürgerkriegsparteien – eine Konstellation, die heute, nach Jahrzehnten des Aufstiegs Chinas, kaum mehr vorstellbar ist.
Dieser Umstand ist auch dafür verantwortlich, dass in jenen Jahren, als die USA und Taiwan näher zusammenrückten, Fragen des Handels im Vordergrund standen und nicht die der Verteidigung der Insel gegenüber der Volksrepublik, wie es heute der Fall ist. Gleichwohl bestanden und bestehen Verteidigungsverabredungen zwischen Taiwan und den USA, die den Inselstaat im Falle eines Angriffs der Volksrepublik schützen könnten. Noch vor gut zwanzig Jahren genügte es, wenn die USA einen ihrer großen Flugzeugträger in die Taiwanstraße schickten, um der Volksrepublik klarzumachen, dass ihren Ambitionen, den Inselstaat einzuschüchtern, kein Erfolg beschieden sein würde.
Zu einer solchen militärischen Intervention kam es etwa 1996, nachdem China Taiwan mit Raketen beschossen hatte. Die Raketen schlugen auf den Schifffahrtslinien vor Kaohsiung im Süden und der Stadt Keelung im Norden ein. Auslöser für diese Militärschläge war eine geplante Reise von Taiwans damaligem Präsidenten Lee Teng-hui in die USA. Da Peking Taiwan als eine seiner Provinzen betrachtet, versucht die Kommunistische Partei Ländern zu verbieten, taiwanesische Regierungsvertreter einzuladen zu etwas, das wie offizielle Konsultationen aussehen könnten. Lee sollte an der Universität Cornell, an der er selbst studiert hatte, einen Vortrag über den Erfolg des Demokratisierungsprozesses Taiwans halten. Die Volksrepublik sah dies als Affront an und als einen Beleg dafür, dass Taiwan die Unabhängigkeit von China plane. Aus diesem Grund eskalierte Peking die Situation in der Taiwanstraße. Heute, ein Vierteljahrhundert später, kann (wie wir in diesem Buch noch sehen werden) die Frage, wer eine militärische Konfrontation über Taiwan eher gewinnen würde, die USA oder die Volksrepublik, nicht mehr so einfach beantwortet werden wie im Jahr 1996.
Der Grundzug des Konflikts zwischen den beiden Staaten ist indes nach wie vor derselbe: Die Volksrepublik will die Wiedervereinigung mit Taiwan, um damit endgültig den Bürgerkrieg für sich zu entscheiden. Peking muss es als Zumutung empfinden, dass 23 Millionen Menschen auf Taiwan eine demokratische, freiheitliche Gesellschaft aufbauen, während Chinas Präsident Xi die Welt bereist und dabei nicht müde wird zu betonen, dass die Demokratie eine griechisch-abendländische Erfindung für die Menschen im Westen sei, die für die Menschen im Osten nun einmal nicht tauge.
Besonders die Freiheitsrechte, die den Menschen in Demokratien gewährt werden, sind Präsident Xi ein Dorn im Auge. Die Menschenrechte, die, wie wir sie verstehen, aus der Würde des Menschen resultieren, werden von zwei Aspekten geprägt: von bürgerlichen und von sozialen Freiheiten. Zu den bürgerlichen Freiheiten, wie ich sie im Anschluss an den liberalen Soziologen Ralf Dahrendorf verstehe, gehören: freie Rede, Gewissens- und Glaubensfreiheit, Wahlrecht, Gleichheit vor dem Gesetz. Die Ermächtigung des Einzelnen als ein freies Individuum in einer Gesellschaft kann aber nur dann gelingen, wenn der Einzelne dazu in die Lage versetzt wird. Die wichtigsten Komponenten der sozialen Teilhabe sind der Zugang zu kostenfreier Bildung und erschwinglicher Krankenkasse. Eine Demokratie kann nur dann jede und jeden gleich wertschätzen, wenn alle die gleichen Ausgangschancen erhalten. Der Zusammenhang ist wissenschaftlich erwiesen: Wenn man hungern muss, hat das einen negativen Einfluss auf die Entwicklung von Körper und Geist. Deswegen greifen diese beiden Aspekte, die man auch politisch und ökonomisch nennen könnte, ineinander.
In Demokratien wird dieser Zusammenhang noch einmal in einem größeren Kontext deutlich: Nur dort, wo freie Rede erlaubt ist, Sprache nicht zensiert, den Menschen keine politische Ideologie aufgezwungen wird, können sie letztlich auch frei wirtschaften und innovativ sein. In diesem Sinne sind Demokratien Motoren der gesellschaftlichen Entwicklung, wohingegen in Autokratien, in Diktaturen sowieso, in denen die bürgerlichen Freiheiten nicht gewährt werden, diese Entwicklung stagnieren muss, weil sie mit den sozialen eng verknüpft sind. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1776 wird den Menschen ein aus ihrer natürlichen Würde entspringendes Recht auf »Leben, Freiheit und Streben nach Glück« zugesprochen. Die Würde kommt dem Menschen grundsätzlich per Geburt zu (»Leben«), und aus ihr resultieren bürgerliche Rechte (»Freiheit) und soziale (»Streben nach Glück«). Das eine kann es ohne das andere nicht geben.
Genau diesen Zusammenhang will Chinas Machthaber auflösen. Für ihn erschöpfen sich die Menschenrechte in der sozialen Komponente. Die Kommunistische Partei, so wird argumentiert, habe Abermillionen Chinesinnen und Chinesen aus der Armut befreit und ihnen somit ihre sozialen Rechte gegeben. Als Dank dafür erwartet die Kommunistische Partei Gehorsam und den Glauben daran, dass allen ihren politischen Kampagnen der gleiche Erfolg beschieden sein wird. Diese Sicht auf die Menschenrechte versucht Xi Jinping auch in den Vereinten Nationen einzubringen und durchzusetzen. Es wäre das Ende des Menschenrechtsbegriffs, den Humanismus und Aufklärung gerade gegen solche zynischen Machthaber wie Xi artikuliert haben.
Im Blick auf das heutige China wird das deutlich: Je mehr Xi Jinping die Gesellschaft gleichschaltet, umso mehr gerät auch die Wirtschaft unter Druck. Wir sprachen bereits von dem ideologischen Angriff gegen Alibaba, Didi und den privaten Bildungssektor unter Xi. Bis zu den Schlägen gegen diese erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen behauptete die KP, dass es ökonomischen Erfolg auch ohne politische Freiheit geben könne. Nun zeigt sich, erneut, dass eine Diktatur keine ökonomische Freiheit gewähren kann, weil sie sich früher oder später von den Erfolgen der Wirtschaft angegriffen und hinterfragt fühlen wird. In der Konsequenz bedeutet das, dass Xi Jinping die Marktreformen von Deng Xiaoping aufgehoben und die Volksrepublik wieder auf den Weg zurück in die Planwirtschaft gebracht hat.
Seinen Einsatz gegen die Menschenrechte verbrämt Xi gern als Kampf gegen eine neue Form des Kolonialismus. Indem »der Westen« China dränge, die Menschenwürde zu achten und beispielsweise fordere, keine Internierungslager für Minderheiten zu errichten, spiele er sich wieder als Kolonialherr gegenüber China auf. Nunmehr aber sei die Volksrepublik wieder so stark wie das imperiale China und müsse sich das nicht mehr gefallen lassen. Die Art und Weise wie Xi Jinping dieses Argument vorträgt, erinnert an andere Diktatoren. So verweist auch Wladimir Putin darauf, dass die Russen (alle, ohne Ausnahme) nun einmal eine andere Vorstellung von Mensch und Politik hätten und jeder »westliche« Versuch, die Menschenrechte zu implementieren, Neo-Kolonialismus sei.
Die Behauptung Xis und Putins ist dabei selbstverständlich nicht korrekt. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte haben alle Nationen unterzeichnet, die heute in den Vereinten Nationen vertreten sind. Die Anerkennung der Menschenwürde und die daraus resultierenden Rechte werden daher formal in allen Winkeln der Welt anerkannt, gleich, welche Religionen in den jeweiligen Ländern verbreitet sind, welche Sprachen dort gesprochen werden, welches politische System vorherrscht. Die Vereinten Nationen, zu deren Gründungsmitgliedern die Republik China gehört, haben es geschafft, zum ersten Mal die juristische Kodifizierung der Menschenrechte international zu verdichten und zur Norm zu machen. Es ist traurige Realität, dass autoritäre Machthaber wie Xi Jinping auf Menschenwürde und Menschenrechte nichts geben. Umso wichtiger zu betonen, dass die Republik China in Taiwan heute ein Vorreiter in Sachen Menschenrechte ist.
Die Rede vom »Neo-Kolonialismus« spielt auch eine Rolle, wenn es um Pekings Machtpolitik gegenüber Hongkong und Taiwan geht. Die KP nutzt dieses Schlagwort, um den Furor, mit dem sie gegen das semiautonome Hongkong vorgegangen ist, zu rechtfertigen. Die Tatsache, dass der Flecken Erde, auf dem Hongkong steht, an Großbritannien abgetreten werden musste und damit Teil der Verwaltung des Vereinigten Königreichs wurde, steht im kollektiven Gedächtnis Chinas für ein »Jahrhundert der Schande«. Die aus dem Kolonialismus erwachsene Autonomie der Finanzmetropole jedoch wussten und wissen viele Hongkonger zu schätzen. Bei einer Demonstration gegen den Versuch Chinas, Hongkongs Freiheit zu unterminieren, besetzten Demonstranten die gesetzgebende Kammer der Stadt und hissten darin die alte Kolonialfahne. Die Botschaft ist klar: Unter der Ägide Großbritanniens ging es den Menschen besser als in der zu erwartenden Knechtschaft durch Peking. In den Jahren vor der Rückgabe Hongkongs führte die britische Regierung demokratische Reformen durch, die nach 1997 vom ersten Statthalter des kommunistischen China sofort wieder abgeschafft wurden. Seither ist die Stadt nicht mehr zur Ruhe gekommen, und nur die Coronapandemie hat es vermocht, die zahlreichen Demonstrationen vorläufig zum Erliegen zu bringen.
Die Führung der Volksrepublik zeigt sich von den Protesten der Menschen unbeeindruckt und »kolonialisiert« ihrerseits nach dem Vorbild der verhassten Besatzungsmächte von einst. So sollen die Uiguren »sinisiert« werden, was heißt, dass sie so denken und leben sollen wie »Han-Chinesen«, wie sich die größte Ethnie der Welt seit der antiken Han-Dynastie nennt. Da sie diesen Zustand des Han-Seins aber nie erreichen können, bleiben sie für alle Zeit Bürger zweiter Klasse. Pekings Kolonialismus ist damit in der Tat der Wiedergänger des europäischen, der, mit der Behauptung auf den Lippen, den armen Völkern das Christentum und medizinischen Fortschritt zu bringen, ganze Kontinente unterjocht, Menschen versklavt und umgebracht hat. Mit dem, was die Kommunistische Partei Chinas den Menschen in Xinjiang, in Tibet, in der Inneren Mongolei und Hongkong antut, hat sich die Volksrepublik aus dem Kreis der zivilisierten Nationen verabschiedet. Ein neues »Jahrhundert der Schande« ist angebrochen – eines, für das sich alle Menschen in China dermaleinst rechtfertigen müssen und vermutlich schämen werden.
Taiwan war bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine japanische Kolonie. Das von der Qing-Dynastie regierte China musste im Zuge des verlorenen Ersten Sino-Japanischen Krieges 1895 die Insel an Japan abtreten. Die folgenden 50 Jahre Kolonialherrschaft waren zunächst gekennzeichnet vom Widerstand der Bevölkerung gegen die Kolonialherren (in den ersten 25 Jahren) sowie von Integrationsbemühungen (in den zweiten 25 Jahren). Japans gewalttätige Expansion auf das chinesische Festland vereinigte kurzzeitig sogar die zerstrittenen Kriegsparteien des Chinesischen Bürgerkriegs. Gemeinsam kämpften die Truppen Maos mit denen der Republik China gegen die Invasoren. Der Bürgerkrieg pausierte während dieser Phase der gemeinsamen Landesverteidigung. Gleichzeitig versuchte die Kolonialmacht, Taiwan zu »japanisieren«. Dies ging einher mit der Errichtung einer am britischen Beispiel ausgerichteten Eisenbahn- und Straßeninfrastruktur. In Japan fahren bis heute die Autos links, genauso wie in der ehemaligen Kronkolonie Hongkong – und das, obwohl Japan vom britischen Kolonialismus unberührt und unbesetzt geblieben ist. In Taiwan herrscht heute Rechtsverkehr auf den Straßen.
Mit der Kapitulation des japanischen Kaiserreichs fiel die Insel zurück an die Republik China, zu der es bis zum Ende des Ersten Sino-Japanischen Krieges 1895 gehört hatte. Welche Konsequenz das hatte, ist zwischen den Bürgerkriegsparteien umstritten. Das legitime China war zu jener Zeit die Republik China. So gesehen ist die Insel Taiwan heute das letzte verbliebene Territorium dieser Republik. Die Volksrepublik auf dem Festland argumentiert, dass sie der legitime Nachfolger der Republik China sei und somit einen Anspruch auf die Insel habe. Eine dritte Lesart betrachtet, wie bereits erwähnt, die Volksrepublik als illegitimen Besatzer des ursprünglichen Territoriums der Republik China, also des Festlands. Die taiwanesische Verfassung folgt dieser Auffassung und erklärt deshalb folgerichtig, dass eine Wiedervereinigung mit dem Rest Chinas das Ziel sei. Beide Seiten halten an ihrem Anspruch fest, haben aber über die Jahre Wege gefunden, diese auszutarieren und die Kriegshandlungen nicht wieder aufzunehmen. Heute stellt sich mehr denn je die Frage, wie lange dieser Frieden halten wird.
Die alte Anbindung an Japan führt regelmäßig zu Spannungen zwischen Tokio und Peking, da Japan sich Taiwan weiterhin verbunden fühlt – und umgekehrt: Nach einem schweren Erbeben in Japan im Jahr 2011, das in Europa vor allem wegen der Reaktorkatastrophe in Fukushima in Erinnerung geblieben ist, spendeten Taiwanesen rund 240 Millionen US-Dollar. Diese Summe war der höchste Spendenbetrag, den Japan nach dem Unglück erhielt, bei dem rund 16000 Menschen ihr Leben verloren. Als im Jahr 2018 ein Erdbeben Taiwan heimsuchte, unterstützte Japan den Inselstaat mit Ausrüstung und Spezialisten, was die Volksrepublik entrüstete und entschieden als Einmischung verurteilte. Zuvor hatte Taiwan abgelehnt, chinesische Helfer ins Land zu lassen.
Das Verhältnis der Volksrepublik zu Japan ist seit jeher angespannt, genauer: seit Japans Angriffskrieg und Besatzung der Mandschurei in den Jahren 1937 bis 1945. Zu grauenvoll war der japanische Kolonialismus. Es kam zu schlimmsten Verheerungen und Menschenrechtsverletzungen. Die Erinnerungen an die Gräueltaten sind noch lebendig, auch wenn die letzten Zeitzeugen nach und nach versterben. Die Volksrepublik wartet noch immer auf eine volle Entschuldigung und Wiedergutmachung.
Das herzliche Verhältnis, das Taiwan mit seiner einstigen Kolonialmacht unterhält, ist so gesehen eine Ausnahme. Der Vergleich mit Hongkongs Verhältnis zu Großbritannien liegt nahe. Im Vergleich zu dem, was man von China befürchtet, erscheint die japanische Kolonialzeit für viele im Rückblick fast wie eine »gute alte Zeit«.
Das ist eine unzulässige Verklärung, aber dennoch verständlich. Sowohl Hongkong als auch Taiwan haben schon früh – früher als das von Mao regierte chinesische Festland – demokratische und marktwirtschaftliche Strukturen kennengelernt. Erst die ökonomischen Reformen Deng Xiaopings sorgten nach seinem Tod 1976 dafür, dass auch das kommunistische China durch kapitalistische Marktreformen den Weg der Modernisierung beschritt und sich ökonomisch in gleicher Weise wie die »asiatischen Tiger« modernisierte. Taiwan trat da bereits in die nächste Phase seiner wirtschaftlichen Entwicklung ein: 1987 wurde die »Taiwan Semiconductor Manufacturing Company« gegründet. Die Halbleiterfirma ist heute die weltweit größte ihrer Art, die allein die Hälfte aller weltweit verwendeten Chips produziert. Die Volksrepublik China hat bis zum heutigen Tag diese Lücke, die sich zwischen den beiden Ländern in den siebziger Jahren aufgetan hat, nicht schließen können. Gemeinsam mit Südkorea dominiert Taiwan nach wie vor den globalen Chip-Markt.
Doch der Weg zu einer freiheitlichen Demokratie verlief für Taiwan nicht ohne Umwege. Die Kuomintang wurden bei ihrer Ankunft auf der Insel 1947 nicht mit offenen Armen empfangen, sondern trafen auf den Widerstand der einheimischen Bevölkerung. Bis zum Ende des Bürgerkriegs 1949 flüchteten insgesamt zwei Millionen Festland-Chinesen auf die Insel, die damals rund sechs Millionen Einwohner hatte. Bereits im Jahr 1947 war es deshalb zu dem Aufstand vom 28. Februar gekommen (»228«). Dieser gewaltsame Protest gegen die Kuomintang-Regierung wurde niedergeschlagen. Die Auseinandersetzungen gingen jedoch weiter, weswegen im Jahr 1949 das Kriegsrecht ausgerufen wurde, das bis 1987 bestand. In dieser Zeit wurden Schätzungen zufolge zwischen 3000 und 4000 Menschen als Regimegegner ermordet, rund 140000 wurden verhaftet und interniert. Noch heute kann man einige dieser zu Gedenkstätten umfunktionierten Lager auf Taiwan besichtigen. Mein Partner Andrew und ich besuchten eine Gedenkstätte auf Green Island. Dorthin wurden die Gefangenen, die der Paranoia der Kuomintang-Schergen zum Opfer fielen, verfrachtet, ganz gleich, ob sie wirklich an einem Umsturz arbeiteten oder nicht. Die taiwanesisch-amerikanische Autorin Shawna Yang Ryan hat in ihrem Roman Green Island diese fürchterliche Zeit anhand einer fiktiven Familiengeschichte nachgezeichnet. Das Trauma wirkt noch immer nach. Die jüngere Generation beschäftigt sich deshalb leidenschaftlich mit dem Thema, da die Kuomintang eine der bestimmenden politischen Parteien des Landes geblieben ist. Studierende fragten mich häufiger danach, wie wir in Deutschland mit dem Problem der »transitional justice«, oder »Übergangsjustiz«, umgingen. Damit beziehen sie sich auf Nachkriegsdeutschland und wie darin die Menschen mit den Nazi-Schergen von einst eine neue Ordnung aufbauen konnten. Meiner Ansicht nach ist der Vergleich nicht ganz glücklich. Viel eher passt der Umgang der Menschen im ehemaligen Osten des Landes mit den Stasi-Spitzeln, mit denen sie nach der Wende weiterhin Tür an Tür lebten. Die Partei Die Linke ist die Nachfolgepartei der SED, der sozialistischen Einheitspartei, die das Unrecht in der DDR zu verantworten hat. Ich berichtete den Studierenden von Initiativen im kirchlichen Rahmen, bei denen Opfer und Täter von einst zusammengebracht werden.
Wie viele Menschen nach »228« in den Lagern ums Leben kamen, ist ungewiss. Schätzungen zufolge zwischen einigen Tausend und 28000 Menschen. Der psychologische Schaden, die Traumata, die Jahrzehnte des Kriegsrechts und des Terrors mit sich brachten, können noch viel schwerer kalkuliert werden.
Der Demokratisierungsprozess setzte 1975 ein, nachdem Staatsgründer Chiang Kai-shek verstorben war und dessen Sohn, Chiang Ching-kuo, zum Partei- und Staatschef der Republik China wurde. In diese Zeit fällt eine gewisse gesellschaftliche Liberalisierung. Politische Aktivität außerhalb der KMT war in Maßen – unterhalb des Levels von Parteineugründungen – erlaubt. Die neuen politischen Kräfte forderten bereits in dieser Zeit, den Anspruch auf Wiedervereinigung fallen zu lassen und Taiwan als eine Demokratie nach westlichem Vorbild zu gestalten. 1986 konstituierte sich dann die DFP, die Demokratische Fortschrittspartei. Sie bündelte dieses Verlangen nach einer neuen Politik. Obwohl zu dem Zeitpunkt noch Kriegsrecht herrschte, wurde die neue Partei nicht verboten und ihre Funktionäre nicht verhaftet. Dieser Moment markiert das Ende der Alleinherrschaft der KMT und den Übergang Taiwans in eine Demokratie. Bei der Wahl im Jahr 1986 verteidigte die KMT ihren Platz als Regierungspartei, die DFP kam allerdings auf Anhieb auf 22 Prozent der Stimmen für den gesetzgebenden Yuan.