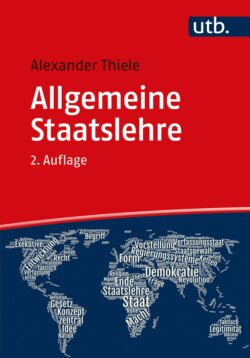Читать книгу Allgemeine Staatslehre - Alexander Thiele - Страница 15
I. Verliert die Allgemeine Staatslehre ihren Gegenstand?
ОглавлениеDer erste Einwand betrifft den Untersuchungsgegenstand: Den modernen Staat der Neuzeit. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung, Supranationalisierung[124] und Individualisierung im Zeitalter der |22|Postmoderne[125] handele es sich bei diesem um ein Auslaufmodell.[126] Zur Lösung globalisierungsbedingter Problemlagen – zu nennen wären beispielhaft Klimaschutz, Migration, aber auch Fragen der internationalen ökonomischen Ordnung[127] – sei der moderne Staat nicht mehr in der Lage, weil die erforderliche Kongruenzbedingung nicht mehr erfüllt sei: Der zu regelnde Handlungsraum gehe über den demokratisch regelbaren (politischen) Raum hinaus.[128] Der moderne Staat habe damit die ihn bisher prägende Souveränität[129] verloren,[130] auch weil die Organisationsmacht gesellschaftlicher Herrschaftsverbünde (nicht zuletzt multinationale Großunternehmen) diese nicht mehr zulasse,[131] kurz: Der moderne Staat befinde sich „in Auflösung“.[132] Zygmunt Bauman behauptete schon im Jahr 1992, dass sich analytische Modelle der Postmoderne und im Zeitalter der „Globalität“[133] nicht mehr am Staat ausrichten ließen.[134] Dieser sei als Analyserahmen nicht mehr ausreichend zur angemessenen Beschreibung der entscheidenden Faktoren des vielfältigen, interaktiven und dynamischen postmodernen sozialen Lebens.[135] Ähnlich hat unlängst Udo Di Fabio argumentiert, und dafür plädiert, „politische Herrschaft wieder staatsfrei zu denken“.[136] Erste Verfallserscheinungen |23|diagnostizierten zuvor bereits Carl Schmitt und Ernst Forsthoff (was allerdings vornehmlich mit ihrem Staatsverständnis zusammenhing). Wird man heute damit von einer „poststaatlichen“ Ära sprechen müssen? Wird der moderne Staat zu einem Akteur unter vielen? Und wird dem Projekt einer Allgemeinen Staatslehre dadurch die Legitimation entzogen, da deren Perspektive als zu eng angesehen werden muss?[137] Ist moderne Staatlichkeit, ist der Staat am Ende?
Die besseren Gründe sprechen dafür, diese Fragen zu verneinen.[138] Die beobachteten Auflösungserscheinungen dürften vielmehr (auch zeitbedingt)[139] in ihrer Bedeutung überzeichnet und mit einem tatsächlich nicht eingetretenen Souveränitätsverlust verwechselt worden sein. Mit anderen Worten: Der (souveräne) moderne Staat lebt und es gibt wenige Anzeichen dafür, dass sich das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ändern würde.[140] Eine stets auf die Gegenwart bezogene Allgemeine Staatslehre verliert deshalb nicht ihre Berechtigung.
Zur Zurückweisung der Auflösungsthese reicht es nicht aus, allein auf die entgegenstehende Alltagserfahrung[141] und die große Zahl an Staaten zu verweisen, die Mitglied der Vereinten Nationen sind – eine Zahl, die in den nächsten Jahren eher steigen denn fallen dürfte, wenn man vereinzelte Sezessionsbestrebungen (Katalonien, Baskenland, Schottland, Kurdenbewegung, Québec) berücksichtigt. Zwar wird man daraus auf eine fortbestehende Attraktivität des bisherigen Modells „Staat“ schließen können; das Ziel der Sezessionsbemühungen ist stets die Errichtung eines neuen Staates in Form eines modernen Staatswesens. Jedoch behauptete die Auflösungsthese nie ernsthaft, dass Staatlichkeit schon in naher Zukunft gänzlich aufhören würde. Es ging ihr nie um eine formelle, sondern stets um eine materielle Auf- beziehungsweise Ablösung des modernen Staates durch schleichenden Aufgaben- und Steuerungsverlust und zunehmende globalisierungsbedingte Komplexität: „Als heutige Symptome der schleichenden Krankheit des |24|Staates zum Tode werden die Globalisierung und Europäisierung (hier), die Regionalisierung oder Transnationalisierung (anderswo), im Innern die noch schwieriger zu fassenden Prozesse der Individualisierung, Pluralisierung und De-Institutionalisierung diagnostiziert.“[142]
Solche Verlusterscheinungen und damit einhergehende „Enthierarchisierungstendenzen“[143] wird man der Sache nach nicht leugnen können. Ein einfaches „Durchregieren“ des modernen Staates ist in vielen Bereichen, vor allem aber im Wettbewerb der internationalen Wirtschaftsordnung nur noch schwer möglich. Der Staat ist eingebettet in ein vielschichtiges, verzweigtes und im Detail auch undurchsichtiges Herrschaftsgefüge aus formellen und informellen Institutionen und Akteuren.[144] Entscheidungen, die in manch informellem Gremium getroffen werden, haben nicht selten größere Auswirkungen auf den Einzelnen als im parlamentarischen Raum in transparenter Form verabschiedete formelle Gesetze (man denke an die vielfältigen informellen Gremien der internationalen Wirtschaftsordnung wie den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht).[145] Gerade den modernen Staat, der seit jeher „Steuerstaat“ ist, stellt es zudem vor enorme Herausforderungen, wenn Unternehmen ihre Steuerlast durch Konzernverlagerungen ins Ausland oder durch komplexe Steuersparmodelle (mehr oder weniger legal) zu reduzieren vermögen.[146] Es zeigt sich, dass die seit dem Ende des Kalten Krieges weltweit propagierte Liberalisierung und Deregulierung[147] mit einem staatlichen Steuerungsverlust einhergeht – nicht zuletzt wenn es um sozialstaatlich motivierte Umverteilungen geht. Gleiches gilt dort, wo staatliche Aufgaben privatisiert oder über PPP-Projekte[148] auf die vermeintlich effizienteren Strukturen „der Märkte“ übertragen werden: Wenn dem Staat Aufgaben genommen werden, |25|verringert sich sein Einfluss auf das ökonomische, soziale und kulturelle Zusammenleben.
Dennoch ist es nicht überzeugend, von dieser Entwicklung auf das Ende des modernen und souveränen Staates schließen zu wollen. Schon der Blick in die Geschichte zeigt, dass es den vollständig souveränen Staat im Bodin’schen Sinne – also einen in jeder Hinsicht freien und von äußeren Einflüssen autarken „Leviathan“ – zu keinem Zeitpunkt gegeben hat.[149] Staatliche Souveränität (ohnehin ein nur schwer zu greifender und weiterhin umstrittener Begriff)[150] war schon immer eine Fiktion,[151] die der „reale“ moderne Staat nie umfassend erfüllte und die bei den einzelnen Staaten zudem unterschiedlich ausgeprägt war – ein Befund, der auch heute noch Geltung beanspruchen dürfte.[152] Auch Formen der Überstaatlichkeit lassen sich, wie zuletzt Ferdinand Weber gezeigt hat, schon für das frühe 19. Jahrhundert als der vermeintlichen Hochzeit des modernen Staates nachweisen.[153] Die modernen Staaten kennzeichnete mithin seit jeher eine variable oder schwankende Souveränität; sie waren mal stärker mal schwächer, mal dominanter mal abhängiger, aber stets: Staaten. Die vermeintlichen Souveränitätseinbußen erschienen womöglich gerade in den 90er Jahren mit dem Erstarken multinationaler Konzerne und den damit einhergehenden politischen („staatlichen“) Steuerungsverlusten gravierend – die Konsequenzen hat Colin Crouch in seiner unlängst aktualisierten „Postdemokratie“ prominent beschrieben.[154] Gleichwohl handelte es sich um kein prinzipiell neues Phänomen, keinen qualitativen, sondern allenfalls um einen quantitativen Sprung, der nicht automatisch mit dem Ende des modernen Staates gleichgesetzt werden sollte.[155]
Entscheidender sind aber zwei Einwände. So zeigt sich erstens die fortbestehende Bedeutung und Notwendigkeit staatlicher Strukturen dort, wo diese mehr oder weniger fehlen, wo der Staat also entweder im Zerfallen |26|begriffen oder sogar bereits zerfallen ist. In Staaten wie Somalia, dem Jemen, Simbabwe oder Libyen herrschen so prekäre und zum Teil kriegsähnliche Zustände, weil mit dem Untergang des Staates keine anderen Herrschaftsstrukturen an dessen Stelle getreten sind, die für die notwendige Ordnung hätten sorgen können.[156] Welche hätten das in diesen Fällen auch sein können? Das Völkerrecht hat solchen Entwicklungen nichts oder nur wenig entgegenzusetzen und kann aus sich heraus keine ordnende Struktur gestalten. Ähnliches gilt in Sierra Leone oder Afghanistan, wo nach dem Abzug der Alliierten Mitte 2021 die Taliban innerhalb weniger Wochen wieder die Macht an sich reißen konnten. Staatenlosigkeit bleibt damit „für jedermann auch weiterhin eine beängstigende Vorstellung“.[157] Die Auflösungserscheinungen staatlicher Souveränität sind nur bis zu einem gewissen Grade ertragbar und setzen voraus, dass der sich auflösende Staat in seinen Kernfunktionen (Friedenssicherung und Bereitstellung der fundamentalen Infrastruktur) funktionsfähig bleibt. Wo der Staat aufhört, hört auch die Freiheit auf. Die Auflösung des Staates findet damit im funktionsfähigen Staat Grundlage und Grenze. Paradoxerweise wird die Diskussion und wissenschaftliche Auseinandersetzung über das Ende des Staates und seine Auflösung auch ausschließlich in Staaten geführt, in denen die grundlegenden staatlichen Strukturen die erforderliche Funktionsfähigkeit zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Freiheit aufweisen. Überspitzt formuliert: Über die langsame Auflösung des Staates und sein Aufgehen in überstaatlichen Strukturen (nicht zuletzt die Europäische Union) nachzudenken, kann sich nur erlauben, wer in einem halbwegs funktionierenden Staatswesen lebt. Dieser Befund bestätigt zugleich, dass wir auf ein solches zumindest aktuell (noch) nicht verzichten können und nicht verzichten wollen. Das zeigten auch die Debatten, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise seit 2015 aufkamen. Wo staatliche Strukturen tatsächlich oder vermeintlich bedroht wurden, wurde versucht, entsprechende Bedrohungen umgehend abzuwehren und Staatlichkeit (und Staatsgrenzen) zu sichern.[158]
Mit dieser weiterhin ordnenden Funktion des Staates hängt der zweite Einwand zusammen. In den letzten Jahren zeigt sich, dass ein beachtlicher Teil der skizzierten Steuerungsverluste auf einem freiwilligen Rückzug des Staates beruhte:[159] Es war der Staat, der Zuständigkeiten und |27|Steuerungsmöglichkeiten abgab, nicht die Globalisierung, die sie sich nahm. Es handelte sich um keinen natürlichen, passiven und unumkehrbaren Erosionsprozess, sondern um eine vornehmlich auf neoliberalen Vorstellungen beruhende, bewusste, aktive politische Entscheidung – getroffen von im Grundsatz voll funktionsfähigen (souveränen) Staaten.[160] Es erscheint damit schon im Ansatz fraglich, ob es sich als sinnvoll erweist, von Souveränitätsverlusten zu sprechen, wo es häufig nur um die möglicherweise extern motivierte, aber formal gleichwohl freiwillige Abgabe von Hoheitsrechten geht und es an den Staaten selbst liegt, diese – sofern erwünscht – wieder rückgängig zu machen.[161] „Sie [die Globalisierung, A. T.] ist vor allem auch politisch gestaltbar, zähmbar“[162] und zwar, so wäre zu ergänzen, durch den stets vorhandenen Staat selbst.[163] „Deglobalisierung“ ist möglich, da der Staat im Hintergrund weiterhin latent vorhanden ist (was im Übrigen auch von den neoliberalen Akteuren nicht geleugnet wird, wenn sie „bei jedem auffälligen Marktversagen, wie eben den einstürzenden Finanzmärkten, nach staatlicher Unterstützung“[164] rufen). Dass eine solche Rückgängigmachung nicht nur eine theoretische Option, sondern auch praktisch durchführbar ist, zeigte sich seit 2016 gleich mehrfach: Die USA verkündeten nicht nur den Austritt aus dem Klimaabkommen, sondern kündigten zudem Freihandelsabkommen oder stellten diese in Frage und setzten mit Donald Trump vermehrt auf unilaterale Entscheidungen und weniger auf internationale Kooperation. Das Vorgehen Großbritanniens offenbarte, dass nicht einmal vermeintlich „auf Ewigkeit errichtete“ supranationale Organisationen vor dem (souveränen) Staat sicher |28|sind.[165] Es hat mit Ablauf des 31. Januar 2020 (gefolgt von einer zum 1.1.2021 abgelaufenen Übergangsphase)[166] die Europäische Union verlassen – einen im weltweiten Maßstab ohnehin rein regionalen Zusammenschluss:[167] „Taking back Control“, Wiedererlangung der abgegebenen Hoheitsrechte (nicht aber der im Hintergrund stets vorhandenen Souveränität), bildete in beiden Fällen das Leitmotiv. Die Vorgänge in anderen Staaten zeigen, dass diese Beispiele Nachahmer finden könnten, da die sozialen Auswirkungen der Globalisierung zunehmend skeptisch gesehen und bisweilen heftig kritisiert werden. Hier wird man einen wesentlichen Grund für das Erstarken rechtspopulistischer Strömungen in den meisten demokratischen Verfassungsstaaten finden können. Ohnehin dürfte es kein Zufall sein, dass entsprechende Renationalisierungstendenzen gerade zu einem Zeitpunkt auftreten, in denen das international globalisierte (wirtschaftliche) System dem Versprechen weltweiter Prosperität bei sozialer Gerechtigkeit nicht in ausreichender Form nachkommt.[168] Große Teile der Bevölkerung wenden sich dann wieder zum Staat, der in der unmittelbaren Nachkriegszeit – allerdings unter heute nicht mehr gültigen Rahmenbedingungen[169] – mit einer ausgewogenen Balance zwischen Markt und Sozialstaat schon einmal bewiesen hat, dass er diese Aufgabe zu bewerkstelligen vermag.[170] Diese bereits seit einigen Jahren zu konstatierende Rückkehr des Staates hängt insofern eng mit der defizitären (sozialen) Leistungsfähigkeit der sich seit den 90er Jahren entwickelnden internationalen Ordnung zusammen und hat damit (bei allem unseriösen, verstörenden und mittlerweile beendeten[171] „Getwittere“ eines Donald Trump) einen rationalen und nachvollziehbaren Ausgangspunkt. Die Legitimität jeder Herrschaftsordnung hängt unter anderem von (sozialen) Output-Elementen, von der Verwirklichung materieller Gerechtigkeit ab.[172] Es verwundert daher nicht, wenn der lange so vehement propagierte Rückzug des Staates auch „staatsintern“ |29|zunehmend kritisch gesehen wird, da der Rückgriff auf die „effizienten Märkte“ auch hier nicht zu den Ergebnissen geführt hat, die man sich in sozialer Sicht möglicherweise erhofft hat – die Stichworte „Rekommunalisierung“ und „sozialer Wohnungsbau“ sollen an dieser Stelle genügen. In den Jahren 2020/2021 war es schließlich die Coronapandemie, die verdeutlicht hat, welche Einflussmöglichkeiten der moderne Staat weiterhin hat:[173] Milliarden von Menschen wurden in den Lockdown geschickt, das kulturelle und soziale Leben kam mehr oder weniger zum Stillstand, Grenzen wurden geschlossen. Auch Steffen Mau hält daher zutreffend fest: „Der Staat ist kein Statist der Globalisierung, kein schwacher, ohnmächtiger Akteur, der den Phänomenen der Grenzüberschreitung nur unbehelligt zuschauen kann. Ganz im Gegenteil: Seine oft verborgene und zurückgenommene Macht trat in der Pandemie unübersehbar hervor.“[174] Von diesem pandemiebedingten staatlichen Zugriff blieb auch die internationale Wirtschaftsordnung nicht verschont – auch diese beruht nicht auf Naturgesetzlichkeiten, sondern auf politischen und damit umkehrbaren Entscheidungen.[175] Wer sie erhalten will, muss sich auf die politische Debatte einlassen; die Ausgestaltung der Handelsbeziehungen versteht sich nicht von selbst, die Staaten können frei entscheiden, inwieweit sie an ihnen partizipieren oder ihnen gar eine völlig andere Struktur geben wollen.
Man mag diese Wiederbelebung des (souveränen) Staates aufgrund der neuartigen und zweifellos sozial ungerecht ausgestalteten Abschottungstendenzen[176] ablehnen – der späte Zygmunt Baumann sprach kritisch von einem „Zeitalter der Nostalgie“[177] in das wir eingetreten sind – und daher für dessen Überwindung eintreten.[178] Allein gegenwärtig ist der Staat weiterhin auch im Innern der bedeutendste politische Akteur,[179] oder mit Erhard Eppler: „Das nächstbessere Modell hat noch niemand entworfen“.[180] Die Vorstellung, dass die Globalisierung mit der umfassenden Aufhebung nationaler Grenzen |30|einhergehen würde, war ohnehin zu pauschal und richtete den Blick zu einseitig-idealistisch auf wenige privilegierte Bevölkerungsgruppen des globalen Nordens.[181] Es geht aktuell damit also weniger um die Überwindung des modernen Staates als um die Einhegung eines destruktiven und autoritären Nationalismus,[182] der mit dem modernen Staat zwar zusammengehen kann, aber nicht zusammengehen muss[183] – das beweist der Blick in die Historie. Der Nationalismus ist wie der Nationalstaat eine Idee des 19. Jahrhunderts, einer Zeit, als der moderne Staat längst etabliert war.[184] Gerade dem demokratischen Verfassungsstaat ist es zuzutrauen, die Geißel des feindseligen Nationalismus, dessen zerstörerische Kraft sich in zwei Weltkriegen und zahlreichen weiteren Auseinandersetzungen auf so schreckliche Weise offenbart hat,[185] dauerhaft zu zähmen. Unlängst hat Yascha Mounk dazu die Etablierung eines „inklusiven Patriotismus“ vorgeschlagen.[186] An anderer Stelle habe ich das Konzept des denationalisierten demokratischen Verfassungsstaates entworfen, einen „Staat ohne Nation“, in dem Nation und Nationalismus als letzte sakrale Elemente von der staatlichen in die private Sphäre verbannt werden.[187] Die (wissenschaftliche und praktische) Überzeugungskraft dieser und anderer Konzepte wird sich zeigen. Erinnert sei aber daran, dass auch der säkulare demokratische Verfassungsstaat, der „Staat ohne Gott“,[188] über Jahrhunderte reifen musste. An dieser Stelle war allein darzulegen, dass die Überwindung des modernen Staates (wenn überhaupt) ein Zukunfts- und jedenfalls kein Gegenwartsthema ist, das gegen eine im Jetzt ruhende Allgemeine Staatslehre vorgebracht werden könnte. Der moderne Staat hat seine Bedeutung als weltweiter politischer Primärraum noch nicht verloren und |31|wird sie auf absehbare Zeit nicht verlieren. Wer sich schon Anfang der 90er Jahre auf dem Weg in eine friedvolle „post-hobbesianische“ politische Ordnung wähnte,[189] sieht sich getäuscht: „From the surge of populist discontent to the backlash against supranational courts and challenges to the multilateral architecture of the post-war international order, the demise of the state prophesied by earlier literature appears to have been, like the rumours about Mark Twain’s death, greatly exaggerated.“[190] So wie das vielzitierte „Ende der Geschichte“[191] ist auch das „Ende des modernen Staates“[192] zu früh ausgerufen worden[193] – dass beide Thesen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Ende des Kalten Krieges in einer Zeit der weitverbreiteten (aber mit Jan-Werner Müller keineswegs allgemein-umfassenden)[194] Hoffnung artikuliert und vertreten wurden, dürfte im Übrigen kein Zufall sein.
Eine moderne Allgemeine Staatslehre muss die geschilderten transformatorischen Veränderungen und den damit einhergehenden Wandel von Staatlichkeit,[195] den „Staat als Prozess“[196] selbstverständlich aufnehmen und verarbeiten.[197] Sie kommt nicht ohne Abschnitte zur Internationalisierung, zur Supranationalisierung[198] und zu gesellschaftlichen Machtverschiebungen aus[199] – in der Coronapandemie kam zuletzt verstärkt die Frage auf, welche Rolle ExpertInnen in einer Demokratie zukommen sollte (beziehungsweise |32|darf)[200] – und muss sich zudem zu (vermeintlichen) globalisierungsbedingten Steuerungsverlusten verhalten:[201] Bedarf es als Antwort möglicherweise mehr Supranationalisierung? Wie verhält sich die Abgabe von Befugnissen an entsprechende Organisationen zur Legitimität der staatlichen Ordnung? Wie können Verlierer der Globalisierung ansprechend entschädigt werden? Festzuhalten aber bleibt: Ihren Gegenstand als solchen hat die Allgemeine Staatslehre bisher nicht verloren,[202] die räumlich-fundierte Staatsgewalt hat ihre zentrale Bedeutung nicht eingebüßt.[203] Es geht mithin darum „den evidenten Wandel von Staatsaufgaben, des Staatsverständnisses, der Staatsfinanzierung und einzelner Staatsfunktionen usw. näher zu beschreiben und zu analysieren“[204] und, so wäre zu ergänzen, auch zu kritisieren. Welche Rolle kann ein gewandelter, „offener“ moderner Staat im Zeitalter der Globalisierung spielen und welche Rolle sollte er – auch und gerade für die Gestaltung der Wirtschaftsordnung[205] – spielen? Diese Aufgabe kann der Allgemeinen Staatslehre schon deshalb gut gelingen, weil ihr zu keinem Zeitpunkt ein einheitlicher, abgeschlossener und Veränderungen nicht zugänglicher Staatsbegriff zugrunde lag. Wie Andreas Voßkuhle festgestellt hat, hätten weder Hermann Heller (Staat als organisierte Entscheidungs- und Wirkungseinheit) noch Hans Kelsen (Staat als Rechtsordnung) größere Probleme damit gehabt, die geschilderten Entwicklungen in ihre Staatslehre zu integrieren.[206] Für Carl Schmitt oder auch Ernst Forsthoff gilt das freilich nicht.