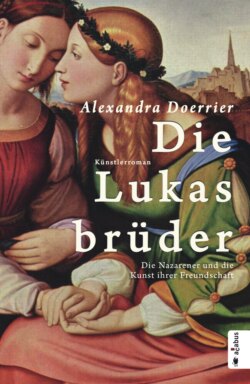Читать книгу Die Lukasbrüder. Die Nazarener und die Kunst ihrer Freundschaft - Alexandra Doerrier - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Die Schwestern des Lazarus
Drei Monate nach unserem Gelöbnis geschah etwas, das uns einen Schritt weiter nach Italien, das Land unserer Sehnsucht, bringen sollte.
Ich presste mich an der Kirchenmauer entlang, denn in Wien lief man ständig Gefahr, von einem Fiaker gerädert zu werden. Sechshundertfünfzig an der Zahl standen vom Morgen bis Mitternacht an jeder Ecke bereit. Sie sorgten auch dafür, dass man oft nicht atmen konnte, weil die Luft von dem beißenden Gestank der Pferdeäpfel verpestet war. Vor dem ‚Gasthaus zur Donau‘ stolperte ich über einen Betrunkenen. Die Beine hatte er bis auf den Fahrweg lang ausgestreckt, sein roter Kopf hing ihm schlaff auf der Brust.
Der Wirt kam heraus und kippte zwei Pferden einen Eimer Wischwasser vor die Hufe. Als er den Mann sah, trat er dem armen Tropf kräftig in die Hüfte. Der gab nur einen grunzenden Laut von sich und kippte zur Seite.
Eingebettet zwischen Kunstakademie und Wohnhäusern lag die Kirche Sankt Anna. Ein Schwall abgestandener Weihrauchluft kam mir entgegen, als ich die schwere Holztür öffnete. Ich wusste, dass ich Overbeck hier finden würde. Entweder steckte er seine Nase in die Bibel oder er saß in seinen langen Mantel gehüllt bei den Katholiken, obwohl er wie ich Protestant war. Ich hatte Angst, dass er eines Tages an der Kirchenbank festwachsen würde, deswegen musste ich ihn ab und zu an der Ferse kitzeln.
Der Kerzenschein hinter dem Milchglas des Beichtstuhls verriet die Umrisse eines gebückten Weibes mit Haube, dessen unverständliches Gemurmel der Priester mit tröstenden Worten wie »Vergebung« und »wir alle sündigen« beantwortete.
Overbeck hatte sich in einer kleinen Seitenkapelle versteckt. Er saß mit angelehntem Oberkörper auf der Bank und starrte auf eine Marienikone, die durch das Flackern des Lichts abwechselnd erleuchtet und wieder verdunkelt wurde.
»Overbeck.«
Er zuckte zusammen. »Guten Morgen, Hottinger, ist es schon soweit?«
»Nein«, log ich. Ich stellte meine Ledertasche auf die Bank und setzte mich neben ihn.
»Nur eine reine Seele kann eine solche Ikone schaffen«, flüsterte er.
Overbeck konnte sich gar nicht sattsehen an diesem Bild. Die Zeit hatte eine bräunliche Schicht auf dem Holz hinterlassen und das Gesicht der Gottesmutter verändert. Es war eine Kopie des Marienbildes, das der Evangelist Lukas selbst gemalt hatte.
»Ich will endlich das Original sehen«, sagte Overbeck.
»Dazu müssen wir nach Rom fahren.«
Er nickte. »Wir müssen frei werden.«
»Frei?« Ich sprach wohl etwas zu laut. Overbeck hielt sich den Finger vor den Mund und sprach gedämpft: »Ich meine, frei von allem. Von allem herkömmlichen Wissen.«
Ich überlegte. Viel Brauchbares hatten wir an der Akademie ohnehin nicht gelernt.
»Wir sollten alles Handeln lassen und einfach nur sein«, erklärte er.
»Oh ja«, schwärmte ich. »Faul in der Sonne liegen und die Beine im Tiber baumeln lassen. Eine schöne Römerin, die uns mit Öl salbt, eine andere, die uns mit Trauben füttert.«
»Hottinger!« Ich hörte die Ernsthaftigkeit seiner Zurechtweisung noch im Nachhallen des Echos. Overbeck senkte die Stimme wieder: »Träum nicht immer von irdischen Damen, schau dir lieber Maria an. Sie entführt dich in eine von aller Zerfahrenheit befreite, vollendete Welt.«
Eine einseitige Wirklichkeit, die mir viel zu eng ist, dachte ich. Die Ruhe, die Maria ausstrahlte, konnte ich aber nicht leugnen.
»Sie trägt Christus in sich«, säuselte Overbeck.
Ich zuckte mit den Achseln. »Sie ist seine Mutter.«
»Achte auf den Hintergrund!«, bat er.
Ich stand auf, nahm die Kerze vom Ständer und beleuchtete das Gemälde. Außer abgeblättertem Gold konnte ich nichts Auffälliges entdecken.
Overbeck erhob sich und blickte mich an, als hätte er auf dem tiefsten Meeresboden einen Schatz geborgen. »Ich habe geheimes Wissen erhalten.«
»Von wem?«
Er schüttelte den Kopf, als dürfte er mir das nicht sagen. Dann blickte er sich um, kam näher und hauchte mir ins Ohr: »Sie ist auf Goldgrund gemalt.«
Ich verstand nicht. Was sollte daran so besonders sein? Es war eine Ikone.
»Auch wir sind auf Goldgrund gemalt«, flüsterte er mit leuchtenden Augen. »Auf diesen Grund müssen wir wieder zurück.«
Ich wusste weder, ob ich da hinwollte oder was ich da sollte, noch wovon Overbeck überhaupt sprach.
»In Maria ist mir die Urschönheit entgegengestrahlt, die Vollkommenheit aller sinnlichen Erkenntnis. Sie ist eine Verkündigung der Hoffnung, die unseren Blick zum letzten Horizont erhebt.«
Overbeck sah sich wieder um, als ob er befürchtete, dass uns jemand belauschte.
»Vor ihr hatte ich meine Vision einer Kunst, die kein Auge je gesehen und kein Herz je ergriffen hat, da sie schöner als alles Gold und Silber, alle Blumen, Wiesen und Wälder, Himmel und Meere sein wird. Sie sprudelt aus der Urschönheit, die die Quelle aller anderen Schönheit ist.«
Ich stellte die Kerze auf den Ständer und nahm meine Ledermappe, während Overbeck weiter schwärmte: »Die Schönheit Marias bildet die Brücke zwischen dem Wahren und dem Guten. Ihre Schönheit ist vollkommen. Siehst du das?«
Ich zog meine Taschenuhr heraus. »Ich sehe, dass wir zu spät kommen.«
Overbeck warf Maria einen letzten Blick zu, wie ein Liebender, den im Moment des Abschieds schon die Sehnsucht packt.
Am Ärmel zog ich ihn hinaus.
Ich drückte gegen den Löwenkopf, der als Türklopfer am Portal der Kunstakademie angebracht war und betrat das Atrium. Jeden Morgen wurden wir hier von einer Kopie der Laokoongruppe begrüßt, die uns zeigte, dass die griechische Antike als Norm aller Schönheit zu gelten hatte.
Wir stiegen die mächtige Holztreppe mit geschnitztem Geländer hinauf. Dieser Weg fiel mir von Tag zu Tag schwerer. Immer dieselbe Leier. Morgens in den Antikensaal, dann Stiche kopieren, nachmittags Statuen des Altertums in Ton modellieren und die restliche Zeit im Hörsaal verbringen. Am Anschlag stand, dass heute Professor Füger, der in den Feuilletons als Wiener Kunstpapst gepriesen wurde, über die griechische Mythologie und deren Einfluss auf die Malerei referierte. Abends strömten wir mit bis zu fünfzig Kommilitonen in den Aktsaal, um den Körperbau durchtrainierter Militärs in Anwesenheit zweier Professoren und eines Korrektors zu studieren.
Wenn wir wenigstens mal ein weibliches Modell zeichnen dürften, dachte ich.
Auf dem Weg zum Unterricht kamen wir am Anatomiesaal vorbei. Die Tür stand offen. Professor Maurer war gerade dabei, einen namenlosen Landstreicher, den die Gendarmen tot aufgefunden und der Akademie zur Verfügung gestellt hatten, zu sezieren. Ein Pulk Studenten stand um den Tisch herum und sah gebannt zu, wie der am meisten gehasste Professor genüsslich das Skalpell an einem Arm des Toten ansetzte und die weiße Haut der Länge nach aufschnitt. Da er der Meinung war, dass man einen Menschen nur lebensecht nachbilden konnte, wenn man nicht nur den Knochenbau, sondern auch den Verlauf der Muskeln und Sehnen genauestens kannte, hatte er im Nebenraum des Anatomiesaals sein Kabinett des Grauens aufgebaut: eine Sammlung von Gläsern, in denen Arme, Beine, Hände, Füße und ganze Köpfe in Essigessenz schwammen.
Als wir den Antikensaal betraten, saßen unsere Freunde mit den anderen Studenten bereits im Kreis vor ihren Staffeleien und zeichneten eine Gipsstatue, die lebensgroß in der Mitte des Raums stand.
»Konrad Hottinger, Friedrich Overbeck, Sie kommen zu spät.«
Professor Caucig zog die Augenbrauen zusammen.
»Entschuldigen Sie, Herr Professor.«
Schnell setzten wir uns nebeneinander an die zwei freien Staffeleien und packten unsere Zeichenblätter aus. Ich spitzte meine abgebrochene Kohle mit dem Messer.
»Es wäre schön, wenn Sie diese Vorbereitungen zu Hause durchführten und Ihre Kommilitonen nicht unnötig störten.«
Widerwillig legte ich das Messer zur Seite.
»Dies ist der junge Horus, den wir Professoren in Gemeinschaftsarbeit aus dem Garten des Palais des Fürsten Wenzel von Paar hierher geschafft haben. Das Original ist aus Carraramarmor und befindet sich in unserer Bibliothek.«
Da stand ein nackter Knabe mit einer albernen Lotusblüte auf dem Kopf, den rechten Zeigefinger hatte er an seinen Mund geführt. Die linke Hand stützte er auf einen Dreifuß, um den sich spiralförmig eine Schlange wand.
»Zunächst müssen wir betrachten, wer Horus war. Wer weiß es?«
Niemand meldete sich. Jeder sah konzentriert auf sein Blatt und hoffte, nicht aufgerufen zu werden. Caucig schüttelte den Kopf und griff nach dem Zeigestock, der auf seinem Pult lag. »Schon Herodot berichtet im fünften Jahrhundert vor Christus über die Ägypter, die ihrem Gott Osiris zu Ehren ein Fest hielten, bei dem sie einen Stier schlachteten. Während die Haut des Tiers mit Opfergaben gefüllt verbrannt wurde, stimmten die Ägypter in einer Zeremonie Klagelieder an, denn Osiris war von Seth getötet worden.«
Ich gähnte demonstrativ laut. Vogel, der links neben mir saß, grinste. Caucig ging vor uns im Kreis herum und rieb den Zeigestock auf seiner Handinnenfläche. »Die Trauer über den Tod des Gottes schlug bald in Freude über seine Auferstehung um. Seiner Gemahlin Isis, der mächtigsten Gestalt im ägyptischen Pantheon und Herrscherin der Welt, war es nämlich gelungen, die über das Land verteilten Körperteile des Osiris wieder zusammenzusetzen und ihn zu neuem Leben zu erwecken. Daraufhin zeugten sie einen gemeinsamen Sohn – Horus.« Caucig blieb vor Isidor Hagen stehen und klopfte mit seinem Stock zwei Mal fest auf die Staffelei.
Hagen stand auf, ohne seine Kohle aus der Hand zu legen.
»Was bedeutet denn Ihr Taufname?«
Hagen zog die Schultern hoch. »Keine Ahnung, Herr Professor.«
»Warum wissen Sie das nicht? Isi-dor – Geschenk der Gottesmutter Isis. Setzen! Im griechisch-römischen Kult wurde Isis zur Überwinderin des Todes und zur Muttergottheit.«
Caucig ging an sein Pult und hielt einen Druck hoch, der aussah wie eine schlechte Kopie der Marienikone aus Sankt Anna.
»Horus ist weder ewig noch unvergänglich, sondern wird immer wieder neu geboren. Wie es uns vom Christentum her vertraut ist, wird das, was mit dem Tod und der Auferstehung des Osiris gemeint ist, zum Mysterium erklärt und die Osiris-Isis-Geschichte zu einem Geheimkult erhoben, über den eigentlich gar nicht gesprochen werden darf. Deswegen hält unser griechischer Horusknabe, Harpokrates genannt, einen Finger an den Mund, was als ein Hinweis auf die Pflicht des Initiierten gedeutet werden kann, Stillschweigen zu bewahren.«
Ich wünschte, Caucig würde seiner Aufforderung Folge leisten und uns in Ruhe zeichnen lassen. Alte Büsten, anatomische Präparate und Gliederpuppen abzeichnen – das sollte Kunst sein? Jeder Einzelne musste sich so weit zurücknehmen, dass am Ende fünfzehn Skizzen aus verschiedener Perspektive vor dem Professor lagen, die so aussahen, als seien sie von einem einzigen Maler gezeichnet. Caucig verlangte, dass wir abbildeten ohne hinzuzufügen. So hatte ich mir in den vergangenen Jahren jeden Schnörkel abgewöhnt.
Zucht zur geordneten Schönheit nannten es die Professoren. Sklavenplantage nannte ich es. Wir waren doch keine Druckerpressen! Dieses stetige Abzeichnen machte mich mürbe. Wo war der Künstler in mir geblieben? Er wurde schleichend abgetötet. Ich entfernte mich so weit von mir selbst, dass ich manchmal das Gefühl hatte, mich von außen zu beobachten. Ich sah die Marionette, die nur noch an Fäden hing und von den Professoren geführt wurde. Ein Puppenhaus war diese Akademie. Ein Tollhaus! Und wie sollte man die Kunst bewerten? Das war absurd. Ich war dem Geschmack der Professoren hilflos ausgeliefert. Ich konnte sie nicht einmal achten. Jede Idee, jedes Leben wurde in dieser Anstalt im Keim erstickt.
Aus mir war ein Gliedermann geworden, so verbogen, wie die Lehrer ihn haben wollten. Gehorsam, pflichtbewusst und meisterhaft im Abzeichnen, aber auch ohne jeden eigenen Esprit.
Widerwillig versuchte ich, die Konturen der Schlange mit der Kohle nachzuziehen, während Professor Caucig mir im Weg stand und mit seinem Zeigestock über Harpokrates’ Brust glitt.
»Nur im günstigen Klima kommt die Natur zur Entfaltung aller Schönheit. Unter blauen Himmeln, an warm besonnten Meeresstränden, von weichen Winden gekühlt, kann man die Spur zunehmender Schönheit verfolgen.«
Vielleicht legte Caucig so großen Wert auf antike Schönheit und den reinen Umriss der Figur, weil seine eigene Gestalt eher missraten war. Caucig war klein und gedrungen, sein Hohlkreuz schob seinen dicken Bauch nach vorn, sodass die Goldknöpfe seines Rocks jeden Moment abzuspringen drohten. Seine pludrige Hose, die bis über das Knie reichte, hatte er in weiße Strümpfe gestopft. Wenn man ihn nicht sah, konnte man seine Schnallenschuhe hören, die bei jedem seiner Schritte ein lautes Klacken verursachten. Und wenn man ihn nicht hörte, dann konnte man ihn wittern, denn Caucig hatte einen eigenen Geruch, der wohl von seiner ungewaschenen, silbergrauen Zopfperücke kam. Wenn er den Flur entlangging, zog er diesen Gestank beständig hinter sich her und selbst wenn wir die Fenster nach dem Unterricht schnell aufrissen, dauerte es eine ganze Weile, bis wir wieder atmen konnten.
»Die Spur der Schönheit reicht natürlich nicht bis nach Afrika, denn dieser Kontinent ist dem heißen Scirocco ausgesetzt, der durch seine brennenden Dünste jede Kreatur ermattet. Verständlich, dass die Wiege Homers nur da stehen konnte, wo unter dem ionischen Himmelsblau die höchste Schönheit gedieh. Griechenland war für den Scirocco, der die Luft verfinstert, unerreichbar.«
Ich will Menschen aus Fleisch und Blut zeichnen!, dachte ich. Kranke, Krüppel, Gefallene. Sünder, die sich in Sehnsucht nach dem Guten verzehrten, Gesichter, in denen Gott mit dem Teufel ringt. Ich will mir Schönheit erarbeiten und sie zwischen den Makeln entdecken.
Ich legte ein leeres Zeichenblatt über meinen Horus und zog mit der Kohle Caucigs Silhouette nach, während er weiter philosophierte.
Ich zeichnete seine verkürzten Arme und Beine, die leblos an seinem Körper hingen. Sein Bauch platzte wie eine Kanonenkugel aus dem zu engen Rock. Knöpfe flogen wie Geschosse durch die Luft. Mit seiner Nase, die steil in den Himmel zeigte, sah er auf einmal aus wie ein Schwein. Nur drei Borsten wuchsen ihm aus der Glatze. Caucigs Perücke lag mit abgeschnittenem Zopf am Boden.
Das ist wahre Schönheit!, schrieb ich darüber.
»Die Griechen verfolgten heldenhaft kämpfend die Macht des Guten.« Caucig deutete mit seinem Zeigefinger, der schon in natura wie eine Kochwurst aussah, auf die Statuen im Saal. »Die Götter waren im Kunstwerk zu Menschen geworden, um die Menschen zu den Göttern zu erheben. Mollard, hören Sie auf, mit dem Stuhl zu kippeln!
Achten Sie beim Harpokrates auf die plastische Gestaltung des Gesichts, das nicht nur unnahbare Majestät, sondern auch göttliche Weisheit zeigt.«
Göttliche Weisheit in einem Gipskopf!
Gesichter, die keine Geschichte erzählten, langweilten mich genauso wie die gestählten Adoniskörper, die mich in diesem Saal erdrückten. Der sterbende Sohn der Niobe, den Apollo erschossen hatte, wölbte seine Brust im Todeskampf theatralisch nach oben. Zwischen dem farnesischen Herakles und einer Büste Homers stand ein Hermaphrodit, daneben Nymphen und griechische Jünglinge, Sokrates, der für seine Weisheit starb, eine Furcht einflößende Medusa und Zeus, dessen Kopf ich schon zeichnen konnte, ohne hinzusehen. Wie ich die Antike mit ihrem langweiligen Schönheitsideal satt hatte!
Caucig verschränkte seine Hände auf dem Rücken und ging durch den Zeichensaal geradewegs auf Vogel zu, der sich hinter seiner Staffelei verkrochen hatte und dabei war, in ein Marzipanbrot zu beißen. Schnell steckte er es in seine Rocktasche.
»Was ist das denn für ein kleines Ohr?« Caucig zeigte auf Vogels Zeichnung. »Was wissen Sie über das Ohr?«
Vogel sprang auf, kaute nervös und schluckte. »Das Ohr liegt oberhalb des Halses in der Mitte des Gesichts, wenn es im Profil gesehen wird. Es ist so lang wie die Nase und reicht vom Nasenflügel bis zum oberen Rand des Augenlides. So groß wie das Ohr sind ebenfalls der Teil zwischen Kinn und Nase sowie der Teil zwischen Haaransatz und Augenbrauen und die Strecke zwischen dem Rand der Augenhöhle und dem Ohr. Sie alle machen ein Drittel des …«
»Ein Drittel!«, unterbrach ihn Caucig fast schreiend. »Ihr Ohr macht nicht einmal ein Viertel des Gesichts aus. Setzen!«
Als ihm Caucig den Rücken zugedreht hatte, zog Vogel sein Marzipan wieder aus der Tasche, steckte sich noch ein Stück in den Mund und zerdrückte den Rest auf seinem Zeichenblock. Vogels Vater, erster Zuckerbäcker von Zürich, hatte ihn überhaupt nur nach Wien geschickt, damit er erkundete, welch neumodisches Konfekt auf die Tische der vornehmen Gesellschaft gelangte. So fraß sich Vogel durch sämtliches Zuckerzeug, das in den Auslagefenstern der Konditoreien lag, um Rapport und Kostproben in die Schweiz zu schicken.
»Kommen wir zurück zu den Griechen und dem Begriff der Schönheit. Platon setzt Schönheit mit Harmonie oder Symmetrie gleich. Alles Tun ist für ihn Streben nach der Idee des Schönen.
Wintergerst, die Vertiefung unter der Lippe liegt in der Mitte zwischen Nase und Kinn. Muss ich bei Ihnen noch einmal ganz von vorn beginnen?«
Caucig ging zur Tafel und zeichnete mit der Kreide ein Gesicht.
»Alle legen die Kohle aus der Hand und sehen nach vorn! Das menschliche Gesicht ist ein Quadrat.«
Caucig zog gerade Linien über den Kopf.
»Von einem Ohr zum anderen ist der Abstand genauso groß wie von dem Punkt zwischen den Augenbrauen bis zum Kinn; Strecke AB entspricht der Strecke CD. Was oberhalb und unterhalb dieses Quadrats liegt, ist zusammengenommen ebenfalls ein Quadrat mit derselben Seitenlänge.
Der Abstand vom Kinn bis zur Nase, EF, ist so lang wie die Nase oder die Stirn. Von der Nasenspitze bis unter das Kinn, G bis H, ist es genauso weit, wie von der Nasenspitze bis zum Scheitel, nämlich die Hälfte der Gesamtlänge. Wobei die Strecke IK von den Augenbrauen zum Kinn zwei Drittel ausmacht.« Caucig erklärte und erklärte und malte so viele Buchstaben, dass nichts mehr von dem Gesicht zu erkennen war. Ich faltete das Blatt mit seiner Karikatur zusammen und steckte es in meine Ledertasche.
»Dem wievielten Teil des Kopfes entsprechen dann N, M, O, P, Q und R, Hottinger?«
Ich stand zögernd auf.
»Ich weiß es nicht. Und ich verstehe nicht, warum wir aus dem Gesicht eine mathematische Formel machen müssen.«
»Dann werde ich es Ihnen erklären.« Caucig legte betont langsam die Kreide auf den Tisch.
»Mathematik ist die Grundlage der Malerei und auch jedes anderen Geschäfts. Sie wollen doch nicht mal so enden wie Ihr Vater, Hottinger?«
Als wäre der Bankrott nicht genug Schande für unsere Familie gewesen. Ich nahm die Zigarrenschachtel, die mein Vater mir geschenkt hatte, in die Hand. Ich verspürte große Lust, sie Caucig mitsamt den Zeichenutensilien, die ich darin verstaut hatte, an den Kopf zu schmettern. Stattdessen sank ich auf meinen Stuhl.
Caucig zeichnete seinem Quadratkopf an der Tafel noch einen Hals und zog dicke, weiße Linien unter Kinn und Kehle. Overbeck streckte seinen Arm lang aus und reichte mir ein Blatt Papier. Es war die Skizze für ein neues Bild, von dem er mir erzählt hatte. Sie stellte die Erweckung des Lazarus dar.
Jesus stand im weißen Gewand in der Mitte der Szene, umringt von einer knienden, betenden und staunenden Menschenschar. Alle blickten auf Lazarus, der von Jesus zu neuem Leben erweckt worden war und als Mumie aus seiner Gruft stieg. Die Grabplatte lehnte an einem Felsen. Overbeck hatte sich zur Rechten Jesu als Johannes mit Heiligenschein dargestellt. Das passte. Unter die Zeichnung hatte er geschrieben:
‚Jesus schrie: Lazarus, komm heraus!‘
In verschnörkelter Schrift, die ich nicht lesen konnte, stand etwas ganz klein darunter. Ich deutete auf den Text und zog fragend die Schultern hoch.
Overbeck flüsterte: »Am Tag der Auferstehung wird eine neue Schöpfung geboren.«
»Was meinst du …«
»Hottinger!«, unterbrach mich Caucig.
Ich verschwand hinter meiner Staffelei und musste grinsen, als ich mein Gesicht in einem Jünger zur Linken Jesu erkannte. Overbeck hatte mich vorher um Erlaubnis gebeten, mein Porträt verwenden zu dürfen.
Am besten gefiel mir Pforr, der in das offene Grab starrte und von Maria und Magda, den schönen Schwestern des Lazarus, umgeben war. Leider hatte Overbeck die Damen nur von hinten gezeichnet.
Ich legte meinen Daumen auf den Text, der mir zu fromm war, und deckte mit meiner Hand die Christusfigur ab, die mir allzu statisch erschien. Ungewollt bildeten mein Zeigefinger und mein Daumen ein L – wie Lukasbrüder. Und eingeschlossen in dieses L blieb eine harmonische Dreieckskomposition. Pforr und die zwei Schwestern, die sich liebevoll umarmten.
»Prachtweiber«, sagte ich und zeigte Overbeck das L meiner Finger.
»Hottinger, lassen Sie die albernen Gebärden!«, zischte Professor Caucig mir zu.
Schnell versteckte ich mich wieder hinter meinen Blättern.
Vor meinem inneren Auge wurde Overbecks Zeichnung lebendig und schillerte schon in reinstem Purpur, Zinnoberrot und Ultramarin.
Ich erschrak, als Caucig plötzlich neben mir stand und mir das Papier wegriss.
»Was haben wir denn da? Weilt da etwa schon ein großer Künstler unter uns?«
Ich sah hilflos zu Overbeck, der aufsprang. »Es ist meine Zeichnung.«
»Sind Sie meines Unterrichts überdrüssig?«, wollte Caucig wissen und wehrte Overbeck ab, der mit den Armen nach der Skizze fuchtelte. Caucig wanderte einmal im Kreis, die Zeichnung hochhaltend, damit sie jeder sehen konnte.
»Seit vier Jahren zeichnen wir nichts anderes als Skelette und Gipsköpfe«, beschwerte sich Overbeck.
»Weil Sie die Bestandteile der menschlichen Figur erst einmal von innen heraus kennenlernen müssen«, erklärte Caucig. »Damit Sie sich nicht von den dunklen Träumen der Empfindung leiten lassen.«
»Dunkle Träume?« Overbeck verzog sein Gesicht. »Ich will nur endlich meine eigenen Werke schaffen.«
»Und dann zeichnen Sie einen Haufen Krüppel, die ein Gespenst betrachten?«
Einige Studenten lachten.
»Das ist Lazarus!«, protestierte Overbeck.
Caucig wies ihn an, wieder Platz zu nehmen.
»Nur wer die Fundamentalgesetze der Anatomie wirklich beherrscht, kann zur künstlerischen Vollendung finden.«
Overbeck setzte sich wieder auf seinen Stuhl.
»Was ist denn das für ein Kopf?«, fragte Caucig, als würde er mit einem kleinen Kind sprechen. Er nahm ein Stück Kohle und kritzelte an Lazarus herum.
»Er trägt ein Schweißtuch«, erklärte Overbeck.
»Und die Gewänder und Proportionen? Mir scheint, als würde kein rechter Meister aus Ihnen werden.« Caucig kürzte eines der Gewänder. Ich spürte, wie die Wut in mir hochstieg. Overbeck beherrschte die Perspektive und den Faltenwurf wie kein anderer.
»Ich habe Christus absichtlich etwas größer gezeichnet, um seine Wichtigkeit hervorzuheben«, sagte Overbeck ruhig und wickelte seinen Kohlestift in Papier.
Was hat er vor?, fragte ich mich.
»Der sieht schon selbst aus wie Jesus mit seinen langen Haaren«, hörte ich einen Kommilitonen tuscheln.
»Nazarener«, spottete ein anderer.
Overbeck musste es auch gehört haben.
»Woher kommen nur diese Träumereien?« Caucig schlug auf das Zeichenblatt. »Der aufgeklärte Mensch sollte sich an einem Ideal orientieren. Er braucht keinen Gott!« Er zerknüllte Overbecks Zeichnung in seinen Händen.
Overbeck stand auf. »Die Kunst ist eine Harfe Davids, auf der man Psalmen ertönen lassen sollte zum Lob des Herrn.«
Das Lachen meiner Mitstudenten klang wie Spott in meinen Ohren. Auch wenn mir Overbecks Heiligkeit manchmal auf die Nerven ging, wusste ich doch, dass sein Glaube für ihn Halt und Stütze war.
Overbeck nahm seine Zeichenblätter und ging in Richtung Ausgang.
»Wo wollen Sie hin?« Caucig stemmte eine Faust in die Hüfte.
»Ich bin es leid, dass Sie meine Seele zu Boden drücken und jedes höhere Gefühl für die Kunst in mir abtöten«, sagte Overbeck aufgebracht und hatte schon die Klinke in der Hand.
Caucigs dickes Gesicht wurde puterrot. Er warf die zerknüllte Zeichnung auf den Boden. »Sie bleiben hier. Das werde ich Ihrem Vater melden.«
Overbeck stoppte einen Moment, während ihm die anderen Kommilitonen mit offenem Mund nachstarrten. Pforr stand auf, ging auf Caucig zu, bückte sich und hob das Papierknäuel auf.
»Ignorant«, raunte er und ging zur Tür.
Vogel raffte seine Sachen zusammen, stopfte sich das restliche Marzipan in den Hals und folgte ihnen.
Ich legte ganz gemächlich den Kohlestift in die Zigarrenschachtel, klemmte mir meine Zeichenmappe unter den Arm und ging in die Mitte des Saals. »Sie haben recht, Herr Professor. Wir brauchen keine Götter mehr.«
Ich versetzte Horus einen kräftigen Stoß. Die Gipsstatue kippte vom Sockel und landete mit einem lauten Krachen am Boden. Horus‘ Arm lag abgebrochen daneben. Ein erschrockenes Raunen ging durch die Klasse.
Caucigs Gesicht färbte sich von Rot zu Blauviolett. Er hielt sich sein Herz und schrie: »Ich werde Sie ausschließen lassen von der Akademie.«
»Arrivederci!«, antwortete ich lächelnd. Der konnte mir nicht mehr drohen.
»Exmatrikuliert – Sie alle!«, bölkte Caucig.
Ich blickte noch einmal auf die Statue. Was für eine Befreiung!
Ich fürchtete mich nicht davor, die Akademie zu verlassen. Hier konnten wir nicht weiterkommen. Auch wenn ich in diesem Moment noch nicht wusste, wohin es gehen sollte, spürte ich eine innere Sicherheit, dass wir uns auf dem richtigen Weg befanden.
Ich ging zur Tür, öffnete sie und folgte meinen Freunden auf den Flur.
Pforr versuchte mit einem Gummielastikum Caucigs Striche von der Lazarus-Skizze zu entfernen und Vogel legte den Arm um Overbeck, als sie die Stufen hinunterschritten. Ich schwang mich auf das Treppengeländer und rutschte pfeifend herunter.
Unten angekommen zeigte ich mit dem Finger auf meine Freunde. »Exmatrikuliert – Sie alle!«, wiederholte ich Caucigs Worte.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Vogel und blickte stirnrunzelnd zu Overbeck.
»Auf nach Rom!«, rief dieser begeistert.
Vogel sah mich verdutzt an.
»Auf nach Rom«, antwortete Pforr und gab Overbeck seine Zeichnung zurück. Vogel bot mir seine vom Marzipanbrot klebrige Hand an. Ich zögerte. Wie sollte ich die Reise bezahlen? Er nickte mir zu und drehte seinen Handrücken nach oben. Ich legte meine Hand auf seine und wusste in diesem Moment, dass ich mir mit Vogel als Freund und Reisegefährten über Geld keine Gedanken zu machen brauchte. Die anderen beiden folgten unserem Beispiel, und wir alle wiederholten gemeinsam:
»Auf nach Rom!«