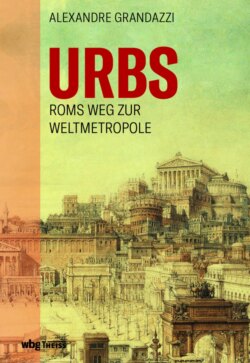Читать книгу Urbs - Alexandre Grandazzi - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Urbs condita1
ОглавлениеVon der Furche zur Mauer
Tief grub sich die bronzene Pflugschar an diesem Frühlingsmorgen in die noch feuchte Erde und zog langsam eine breite Furche. In ein Tuch gehüllt, das auch seinen Kopf bedeckte, führte ein Mann mit fester Hand den Pflug, während ihm eine kleine, leise psalmodierende Menschengruppe folgte. Das von zwei Tieren mit hellem Fell – rechts von einem Stier und links von einer Kuh – gezogene Gespann bewegte sich wie die Sonne am Himmel von Ost nach West. Bald würde der kleine Zug wieder seinen Ausgangspunkt am Fuß der Hügelflanke erreicht haben, die an der Flusskehre über dem Ufer aufragte. Kurz zuvor, als der Tagesanbruch die baumbestandenen Anhöhen mit einem ersten rosigen Glanz überzogen hatte, war der Mann auf die südwestliche Kuppe gestiegen. Auf einem Erdhügel neben einem hastig errichteten Altar hatte er nach Zeichen für die Gunst der Götter, vor allem des Ersten unter ihnen, Ausschau gehalten. Nach Osten gewandt beobachtete er, einem uralten, von ihren Vorfahren überlieferten Ritual entsprechend, die Vögel am Himmel. Später sollte er verkünden, oder verkünden lassen, dass ihm an diesem Morgen zwölf Geier erschienen seien, ein Beweis dafür, dass Jupiter seinem Unternehmen wohlgesonnen sei und den Ort segne, den er ausgewählt habe.2 Der Palatin mit seiner beinahe quadratischen Oberfläche erstreckte sich vor ihm, als er den Blick gen Osten und Südosten richtete, wo sich in der Ferne der Albanus Mons abzeichnete, das mystische Zentrum der latinischen Stämme.
Jetzt warf jeder Gefährte des Mannes eine Handvoll Erde aus seinem jeweiligen Heimatdorf in eine zu Füßen des Altars ausgehobene Grube:3 So würde die im Entstehen begriffene Gemeinschaft ihren Wohlstand und ihre Stärke aus der Einigkeit der kleinen Dörfer ziehen, die bislang über das gesamte Gebiet der Hügel am Fluss verstreut gewesen waren. Der Pflug kam zum Stehen. Bald schon würden die Zugtiere geopfert werden und die Teilnehmer der Zeremonie ihr Fleisch mit den Göttern teilen. Eine Furche umschloss nun den Hügel, und lediglich an zwei, drei Stellen war der Kreis kurz unterbrochen. Männer markierten ihn mit großen Steinen, um seinen Verlauf sichtbar zu machen. In den kommenden Tagen und Wochen würden sie auf der gesamten Linie dieser ersten Begrenzung eine Mauer errichten. Doch schon jetzt bezeichneten sie die durch den Pflug nach innen, zur Hügelkuppe hin, aufgeworfenen Erdklumpen als ‚Mauer‘ und die Furche als ‚Graben‘. Vertieft, erweitert und anschließend mit den meisten der Steinbrocken aufgefüllt, die ihn jetzt noch säumten, würde dieser Graben der künftigen Mauer als Fundament dienen. Die mit hölzernen Pfählen verstärkte, fünf bis sechs Meter hohe und etwa 1,30 Meter breite Konstruktion aus gestampftem Lehm war keine unüberwindliche Befestigung, sondern vielmehr die materielle Verkörperung jenes magischen Schutzkreises, der zunächst in Gestalt der rituellen Furche gezogen worden war. Denn an diesem Frühlingsmorgen wurde hinter dem Pflug nichts eingesät: Mit der feierlichen und traditionellen Wiederaufnahme des Ackerbaus nach der winterlichen Brache versinnbildlichte der Ritus vielmehr den Beginn des heiligen Bandes, welches durch das Pflügen zwischen den Menschen und der nährenden Erde und durch das Opfer zwischen den Menschen und den Göttern geknüpft wurde. Das Teilen des Fleisches der getöteten Tiere besiegelte ihren Bund und grenzte die menschliche Gesellschaft endgültig von der Natur und dem Animalischen ab.4 Was dieser Ritus des Frühlingspflügens darstellte, war die Erschaffung einer menschlichen Gemeinschaft, und in dieser Hinsicht war die gezogene Furche im wahrsten Sinne des Wortes fundamental: sulcus primigenius, allererste Furche oder Urfurche, sollte denn auch in den kommenden Jahrhunderten ihr Name sein. Der auf der äußeren Seite unter dem Joch gehende Stier kündete von der Wehrhaftigkeit des im Entstehen begriffenen Gemeinwesens, während die auf der Innenseite angespannte Kuh künftige Fruchtbarkeit und Wohlstand verhieß. Inmitten eines Territoriums, das bislang als von einer beängstigenden Vielzahl von Gottheiten bevölkert galt, begrenzte, markierte und definierte diese allererste Furche einen Raum, der nun nicht mehr unbestimmt, sondern besonders war, nicht mehr offen, sondern geschützt, nicht mehr ausschließlich alltäglich und menschlich, sondern außergewöhnlich und geheiligt. Der auf diese Weise geschaffene oder wiedererschaffene Raum befand sich auf dem Palatin: dem dafür idealen, weil zentralsten, größten und am leichtesten zu isolierenden Hügel in der Nähe des Flusses und seiner Insel. Und so bildete diese allererste Furche in der Tat die Grenze dieses Raums, der nun, nach der heiligen Pflügung, über eine ganz besondere Qualität verfügte. Schon für die Indoeuropäer galt die Furche als der Inbegriff einer Grenze. Doch es war eine verletzliche, provisorische Grenze, die den Unbilden der Witterung nicht lange standhalten würde. Die Furche existierte nahezu nur in dem Moment, da sie gezogen wurde, während die Begrenzung, deren flüchtiges Sinnbild sie war, im Gelände sichtbar bleiben musste, damit das an jenem Frühlingstag Geschaffene über das Ritual hinaus Bestand haben konnte. Also errichtete man über ihrem gesamten Verlauf eine Mauer, um diese erste Grenzlinie sichtbar, fassbar und dauerhaft zu machen:5 Am Fuß der Anhöhe gelegen, diente sie nicht der Verteidigung, boten die schroffen Hänge des Hügels doch genügend Schutz, sondern sie verdeutlichten vor aller Augen unmissverständlich dessen sakralen Charakter.
Weil die eigentliche Urfurche trotz ihrer religiösen Bedeutung von baldigem Verschwinden bedroht war, sollte die Mauer ihre Spur für die kommenden Jahre und Generationen erhalten. Darüber hinaus hatte sie jedoch auch einen praktischen Nutzen. Von ihrem Wehrgang aus überblickten die Wachen das Umland, und an ihren drei Toren kontrollierten sie das Kommen und Gehen auf dem heiligen Hügel. Unweigerlich brachte diese sehr konkrete Funktion die Mauer mit den Unreinheiten in Berührung, die sowohl mit dem möglichen Einsatz von Waffen als auch mit dem Abtransport des Unrats und der Toten einherging, die alle menschlichen Gemeinschaften produzieren. Daher ist sie nicht mit der religiösen Grenzlinie gleichzusetzen, die sie verkörperte. Denn auch wenn die Mauer daran erinnerte, dass der Hügel in einem entscheidenden Akt mit einer sakralen Grenze umgeben und unter den Blick der Götter gestellt wurde, darf man sie gleichwohl nicht mit dieser verwechseln, und sei es nur aus dem Grund, dass Furche und Mauer, um ein Leben auf dem Hügel überhaupt zu ermöglichen, Lücken aufwies, Öffnungen, an denen der Pflug eigens angehoben und ‚getragen‘ (lat. portare) worden war: die Porta Mugonia, deren Name die Römer künftiger Zeiten an das Brüllen (mugire) der Rinder erinnern würde, die das Tor damals zwei Mal am Tag passierten, und das sogenannte ‚Römische Tor‘ (Porta Romanula), dessen Name die moderne Forschung lange in die Irre geführt hat. Obwohl die Mauer also nicht mit ihr gleichgesetzt werden kann, machte sie die religiöse Grenze doch sichtbar, und dieser magische Kreis, der den Hügel von nun an schützte, verlief unmittelbar an ihrer Innenseite, weshalb er Pomerium genannt wurde, ein Begriff, der aus dem Ausdruck post murum (hinter der Mauer) hervorgegangen ist. Unübersetzbar, nicht einmal ins Griechische, mehr Konzept als Realität, umgab das Pomerium von nun an den Palatin als Einfassung, Begrenzung, mystischer Schutz und sakrale Auszeichnung, wodurch dieser nicht länger ein Hügel unter anderen blieb, und sei er auch der bedeutendste, sondern von diesem Tag an zum Mittelpunkt des gesamten Areals wurde, zum Zentrum der Macht und Ausgangspunkt jener Kernreaktion, die nun eingesetzt hatte. Die anfängliche Vogelschau hatte bestätigt, dass der Palatin wie die Gemeinschaft, die sich auf ihm versammelt hatte und seit mindestens zwei Jahrhunderten dort lebte, tatsächlich den Segen Jupiters genoss, die Urfurche hatte die sakrale Grenzlinie um den auserwählten Ort gezogen, und die Mauer würde ihre Existenz in die Realität der Landschaft übertragen und im Gelände deutlich machen. Wie unsichtbar, ungreifbar und abstrakt die magische Linie des Pomerium auch sein mochte, von nun an sollte sie im religiösen und institutionellen Leben der Gemeinschaft allgegenwärtig sein und diese vor dem schädlichen Einfluss äußerer Mächte schützten. Damit war der Keim gelegt für etwas Neues, das ab jetzt sehr viel mehr sein sollte als eine Siedlung auf einer Anhöhe, von denen es auf den Hügeln am Fluss längst etliche gab, und die alten Begriffe Mons und Septimontium genügten nicht mehr, um dieses Neue zu bezeichnen.
Was durch die auf dem Palatin vollzogenen Riten geschaffen wurde, war ein zentraler, privilegierter Raum, eine urbs, mehr noch, die Urbs schlechthin, ein Status, den Rom in Zukunft und für alle Zeiten für sich beanspruchen sollte. Wenn es stimmt, was Walter Benjamin einst sagte, dass nämlich die Stadt sich im Wesentlichen durch die Erfahrung jener Grenzen definiert, die sie setzt, dann war es in der Tat eine Stadt, die dort durch den Bruch mit einer langen Vergangenheit und unter Zuhilfenahme von Riten gegründet wurde, die den Beginn einer neuen Ära, einer neuen Geschichte ermöglichten. Bis zuletzt sollten die Römer immer wieder gern auf den hier beschriebenen Weiheritus zurückblicken. Unablässig würden sie in Gedichten, Erzählungen und Dramen, aber auch auf Münzen und Flachreliefs die Urszene nacherzählen und nacherleben, bei der ihre Stadt zum Leben erweckt, Rom durch Romulus gegründet und benannt wurde: Denn kein anderer soll den Gründungspflug geführt haben. Dass jeder ihrer Könige, jeder ihrer hohen Beamten und ihrer Auguren in all den folgenden Jahrhunderten genau wie er vor einer Entscheidung, welche die ganze Gemeinschaft betraf, die Vögel befragen musste, würde die Erinnerung an den ursprünglichen Segen, mit dem alles begonnen hatte, immer wieder aufs Neue wachrufen. Und lange noch sollten Roms Anführer und Priester jedes Mal, wenn es eine neue Kolonie zu gründen galt, diese Urszene nachahmen, den Himmel beobachten und den Pflug um das Gelände der neuen Stadt führen.
Doch was, wenn das alles nur Illusion wäre? Der Traum von einem Beginn, den es gar nicht geben konnte, weil so vieles auf den Hügeln am Fluss bereits begonnen hatte. Wäre es nicht seriöser, davon auszugehen, diese uralten Riten seien eben nicht ein erstes Mal, an einem ersten Tag vollzogen worden und eine Gründungszeremonie, die ihre Spuren im Gelände hinterließ, habe niemals wirklich stattgefunden? Es habe sich also lediglich um eine Fantasie der Römer selbst gehandelt, um eine erfundene Überlieferung, eine künstliche spätere Neuschöpfung der Ursprünge ihrer Stadt? Es war verlockend und zweifellos unumgänglich, dass die moderne Forschung zu diesem Schluss kommen würde, vor allem ab dem Moment, als man im 19. Jahrhundert die Geschichte als eine Wissenschaft zu definieren begann, die sich bei der Erforschung von Ereignissen auf schriftliche Zeugnisse aus der entsprechenden Zeit stützt. Da die Schrift jedoch erst mindestens ein gutes Jahrhundert nach der vermeintlichen Ziehung der allerersten Furche nach Rom kam, verschwand diese Szene, verschwanden das rituelle Pflügen und die angeblich daraus resultierende Mauer schlicht und ergreifend aus dem Blick der Wissenschaft und wurden für die moderne Forschung gleichsam undenkbar.
Aber man erinnere sich an Galileo Galilei: „Und sie bewegt sich doch!“, soll er nach dem Prozess ausgerufen haben, in dem seine Theorie, die Erde bewege sich um die Sonne, verdammt worden war. Und hier steht schlussendlich, unbestreitbar, wie erstaunlich es auch klingen mag, doch eine Mauer! Ende der 1980er-Jahre untersuchte ein Team von Archäologen auf dem Forum zwischen Titusbogen und dem Haus der Vestalinnen einen der wenigen Bereiche, die bei den Ausgrabungen vergangener Jahrhunderte noch nicht vollständig erforscht und mehrmals umgegraben worden waren.6 Schon die ersten Funde waren sehr bedeutend, stammten jedoch aus jüngeren Epochen. Aber plötzlich legten die Kellen Stück für Stück ein seltsames Gebilde frei: Im gewachsenen Boden verlief, noch deutlich erkennbar zwischen den mächtigen, in der Kaiserzeit gegossenen Betonfundamenten, eine mit großen Steinen markierte Rille. Die noch unterhalb der Überreste einer Art Bastion entdeckten Gefäße aus einem Grab der Latialzeit ermöglichten eine Datierung dieser Anlage in die Mitte des achten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Wie offensichtlich, ja geradezu zwingend der Zusammenhang zwischen solchen Überresten und den antiken Überlieferungen zur dreifachen Begrenzung des Palatins durch eine Furche, eine Mauer und einen magischen Kreis auch scheinen mochte, so hat diese spektakuläre und in Hinblick auf die vorherrschenden wissenschaftlichen Überzeugungen jener Zeit völlig überraschende Entdeckung in der Forschung zu einer intensiven Debatte geführt, die bis heute anhält.
Was wurde damals nicht alles über diese Mauer gesagt, denn dass es eine Mauer dort gegeben hatte, stand nun außer Zweifel! Zunächst wurde trotz der Datierung und des Fundortes behauptet, irgendetwas aus einer solchen Mauer folgern zu wollen, sei das Gleiche, als wollte man anhand einer mykenischen Scherbe die Existenz von Euandros oder Aeneas beweisen. Dann hat man sich darauf berufen, dass diese Art von Mauer in ganz Latium einzigartig sei und sie darüber hinaus viel zu anfällig, zu wenig massiv anmute. Außerdem wisse man aus der religiösen Überlieferung der Römer, dass eines ihrer Tore Porta Romanula genannt wurde, also das ‚römische‘ Tor. Und das, hieß es, sei doch der beste Beweis dafür, dass diese Mauer keinesfalls ein auf dem Palatin gelegenes Rom habe einfassen können: Die Porte d’Orléans sei ja schließlich auch der Ausgangspunkt der Straße von Paris nach Orléans und nicht umgekehrt. Ein ‚römisches Tor‘ am Fuß des Palatins müsse also zwangsläufig der Beginn eines Weges hin zu einem Rom gewesen sein, das nicht etwa auf dem Hügel gelegen habe, sondern abseits davon. Vor allem aber: Galt nicht das Wort urbs, mit dem diese vermeintliche Stadt in den alten Schriften bezeichnet wurde, ebenso wie dieser Ritus der allerersten Furche als etruskisch, einer entsprechenden Aussage des Gelehrten Varro zufolge? Und es sei doch wohl allseits bekannt, dass sich die Etrusker erst knapp zwei Jahrhunderte nach der vermeintlichen Gründung auf dem Palatin in Rom angesiedelt hätten. Aus all diesen und noch vielen weiteren Gründen, deren primärer die Angst davor ist, das gesamte von mehreren Forschergenerationen geduldig errichtete Wissenschaftsgebäude einstürzen zu sehen, wird die Urszene des rituellen Pflügens um den Palatin in der zeitgenössischen Forschung auch weiterhin, man kann es nicht anders nennen, verdrängt. Inzwischen wurde der Untergrund, aus dem vor dreißig Jahren die Spuren der Mauer zum Vorschein gekommen waren, wieder zugeschüttet und eingeebnet, und auch die wissenschaftlichen Publikationen, in denen sie beschrieben und analysiert wurden, finden sich nach und nach eingekreist und ihrerseits gleichsam überdeckt durch eine Flut gegenteiliger Ansichten: Die alten Überzeugungen und Vorurteile nehmen ihren Lauf. Warum nicht so tun, als sei nichts geschehen? Als könnte die Vorstellung, Rom sei auf dem Palatin gegründet worden, nur ins Reich der Märchen gehören, nicht aber in jenes der Wissenschaft. Kurzum, warum die Mauer nicht einfach vergessen und mit ihr sämtliche Herausforderungen, vor die sie eine gewisse Sichtweise der Ursprünge Roms stellt?
Doch selbst wenn die Mauer nun wieder unsichtbar geworden ist, bleibt sie nichtsdestoweniger da und ist mehr als eine einfache Scherbe, ein Stück von einem zerbrochenen Tongefäß, das auch ein beliebiger Besucher an dieser Stelle hinterlassen haben könnte. Eine Scherbe ist ein anonymes Zeugnis, insofern losgelöst von Raum und Zeit, als sie an einem anderen Ort produziert worden sein kann, als dort, wo sie gefunden wurde, und auch zu einer anderen Zeit als dem stratigrafischen Kontext, in dem sie lag. Eine Mauer hingegen ist eine statische Struktur mit einer im ganz wörtlichen Sinne politischen Bedeutung: Nur durch das Handeln einer Gemeinschaft konnte sie dort entstehen, wo sie sich befindet, und auch nur auf Beschluss des- oder derjenigen hin, der oder die in dieser Gemeinschaft die Befehlsgewalt ausübten. Und da in alten Zeiten jede gemeinschaftliche Entscheidung religiös bestimmt war, muss der Bau einer solchen räumlichen Begrenzung auf die eine oder andere Weise ihre Entsprechung im Bereich des Sakralen gefunden haben. Mit anderen Worten, führt diese Mauer sowohl zu demjenigen, der sie wollte, als auch zu jener magischen Schwelle, die sie anzeigt. Dies gilt umso mehr, als die römische Konstruktion heute nicht mehr, wie zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung, als Ausnahme erscheint: Jüngste Ausgrabungen haben an anderen Orten in Latium und Mittelitalien die Existenz von Mauern nachgewiesen, die aus derselben Zeit stammen wie jene in Rom, teilweise sogar noch älter sind. Und auch die Tatsache, dass eines der Tore in dieser Mauer ‚römisch‘ genannt wurde, führt nicht zwangsläufig zu dem Schluss, dass diese Bezeichnung auf eine Siedlung außerhalb des Palatins verwies. Im Gegenteil, wie das Beispiel der von König Servius Tullius errichteten Mauer zeigt: Mehrere Tore in dieser späteren Mauer waren nach Örtlichkeiten benannt, die sich innerhalb und nicht außerhalb des durch sie geschützten Raums befanden. Es gibt also keinen Grund, warum dies nicht auch beim Römischen Tor des Palatins der Fall gewesen sein sollte.7 Das bedeutet: Rom beschränkte sich am Tag seiner Gründung noch ausschließlich auf den Palatin, und der Palatin allein bildete ganz Rom.
Doch woher stammt der zu solcher Größe bestimmte Name Rom? Offenbar ist er von einem Ort abgeleitet, der einer sehr alten Gottheit namens Rumina geweiht war, einer Fruchtbarkeitsgöttin, deren heiliger Feigenbaum am Fuß des Hügels stand und zwar an der Seite, die dem damals noch Rumon genannten Fluss zugewandt war. Als Wurzel dieser Eigennamen erkennen manche Linguisten ein altes italisches Wort, ruma oder rumen, das sowohl die Zitzen eines Tieres bezeichnete als auch die abgerundeten Hügelkuppen einer Landschaft.8 Rom – umspült von einem Fluss, der sich aus den Bergen kommend zu Füßen abgerundeter Hügelkuppen dahinwand – wäre demnach der Ort, an dem sich ein Klan niederließ, dessen Totem die säugende Wölfin war.
Urbs: Archäologie eines Wortes
Doch wie könnte man annehmen, dieser Ort sei seit dem achten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eine urbs gewesen, wenn es tatsächlich stimmt, was einige römische Gelehrte schreiben und die Gründungsriten etruskischen Ursprungs waren? Ist die berühmte Urszene des allerersten Pflügens nur ein Fantasieprodukt ohne jeden realen Hintergrund? Natürlich könnte man vermuten, die ersten Römer hätten sich diese Riten von der nahe gelegenen und bereits mächtigen etruskischen Stadt Veji abgeschaut. Aber die Etrusker waren keine Indoeuropäer, und es erscheint doch etwas seltsam, dass die Bewohner der Hügel am Fluss, die mit Latein eine indoeuropäische Sprache sprachen, Riten und Konzepte, mit denen sie ihrer künftigen und neuen Form des Zusammenlebens Ausdruck verleihen wollten, ausgerechnet einem anderen Sprach- und Kulturkreis entlehnt haben sollen. Umso mehr, als der Großteil der Begriffe aus dem Umfeld dieser Gründungsriten eindeutig lateinischen, also indoeuropäischen Ursprungs sind: Das gilt sowohl für auspicia und auguria, was die Beobachtung des Vogelflugs an einem templum genannten Himmelsabschnitt bezeichnet, als auch für die Furche (sulcus primigenius), natürlich die Mauer (murus) und schließlich pomerium, den magischen Kreis, der jenes erste palatinische Rom abgrenzte. Alles lateinische Begriffe, bis auf einen: urbs. Lange glaubte die moderne Forschung, dieses Wort sei etruskischer Herkunft, bis die Experten endlich einräumten, dass ihnen die etruskische Sprache immer noch größtenteils ein Rätsel war und sie über den Ursprung des Wortes daher schlichtweg nichts sagen konnten.
Die Lösung für dieses bedeutende etymologische und historische Problem liegt, was allerdings noch nicht ausreichend bekannt ist, in der komparativen Linguistik, und sie kommt von weither. Gegen Anfang des 20. Jahrhunderts erforschten Archäologen – solche, wie sie auf Fotografien aus jener Zeit mit Monokel und abnehmbarem Kragen zu sehen sind – die Ausgrabungsstätte einer großen hethitischen Stadt bei Boğazköy im anatolischen Hochland.9 Es waren Deutsche, die im Rahmen der damaligen deutsch-türkischen Annäherung forschten. Ihre Ausgräber förderten aus dem Sand, der die Überreste der versunkenen Hauptstadt bedeckte, Hunderte Tontafeln mit Inschriften zutage, die dank eines Feuers erhalten geblieben waren, welches die Gebäude, in denen sie aufbewahrt wurden, verwüstet hatte. Bedřich Hrozný gelang schließlich das Entziffern der hethitischen Schrift, und während des gesamten Jahrhunderts, das auf ihre Entdeckung folgte, wurden die Inschriften in monumentalen Sammlungen von unfehlbarer Gelehrsamkeit transkribiert: Tafel für Tafel, Zeile für Zeile, Wort für Wort wurde dort alles verzeichnet und gewissenhaft sortiert. Zufällig erregte 1988, just als in Rom die Palatinmauer zum Vorschein kam, unter diesen Tausenden von gesammelten Wörtern eines die Aufmerksamkeit einer italienischen Linguistin,10 die mit nunmehr neuen Argumenten an eine alte, zuvor bereits verworfene Hypothese anknüpfte und vorschlug, darin eine Verbindung zum lateinischen Wort urbs zu sehen. Nachdem diese Theorie mehr als zwanzig Jahre lang in erlesenen Fachkreisen der vergleichenden Sprachwissenschaft diskutiert worden war, war ein Konsens erreicht, den auch mit römischer Frühgeschichte befasste Althistoriker nicht länger ignorieren können. Denn auf zwei auf Luwisch und in Keilschrift verfassten Tontafeln und zwei weiteren mit hethitischen Inschriften, die aus den Annalen des Großkönigs Muršili II. stammen, in Dokumenten also, die zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehören, tauchen zwei Wörter auf, die man offenbar als ferne Vorfahren der berühmten lateinischen Formel urbem condere, ‚eine Stadt gründen‘, identifizieren kann: warpa dai. Dieser Ausdruck soll die indoeuropäischen Wurzeln der Bezeichnung jenes Aktes reflektieren, durch den ein halbes Jahrtausend später und Tausende Kilometer entfernt Rom als urbs zum Leben erweckt wurde. Wie zu erwarten, verweist der hethitische Ausdruck nicht auf eine städtische Realität im eigentlichen Sinne, denn man weiß seit Langem, dass das Indoeuropäische kein Wort mit der unmittelbaren Bedeutung ‚Stadt‘ kannte. Vielmehr soll diese hethitischen Formulierungen so viel bedeuten wie ‚einen Umkreis abstecken‘ oder ‚einen Kreis ziehen‘, was neben profanen Verwendungen zunächst einen rituellen, sakralen Akt beschreibt. Und die Religion erklärt auch, weshalb ein Wort, ein Ausdruck, den das Lateinische beinahe ausschließlich Rom und seiner Gründung vorbehalten hat, über Zeit und Raum hinweg bewahrt wurde. Urbs ist ein Quasi-Eigenname, der sich in neun von zehn Fällen auf Rom, und nur auf Rom, bezieht. Und natürlich ist diese lexikalische Exklusivität kein Zufall, sie verrät uns, dass die ersten Römer ab dem Moment, da sie den Palatin rituell umpflügt hatten, die entsprechende Bezeichnung ausschließlich der Siedlung mit dem Namen Roma quadrata vorbehalten wollten: Rom, quadratisch wie der Grundriss des Hügels, auf dessen Anhöhe sie lag, und quadratisch wie die Plattform, von der aus durch die Beobachtung des Vogelflugs die Auspizien der Gründungszeremonie eingeholt worden waren. Das Wort urbs, das gewissermaßen zum Zweitnamen Roms werden sollte und auch dieses Buch betitelt, war also zunächst die Bezeichnung eines Ritus aus ferner indoeuropäischer Vergangenheit, der mit den Latinern auf die Hügel am Fluss gelangte.
Doch wieso bezeichneten die Römer selbst diesen Ritus gelegentlich als etruskisch, was zahlreiche Vertreter der modernen Forschung dazu verleitet hat, den gesamten Gründungsmythos mehr oder weniger radikal zu verwerfen? Der Grund dafür ist, dass das Zentrum der italienischen Halbinsel seit dem zwölften und elften Jahrhundert v. Chr. eine Zone intensiven kulturellen Austauschs war, in der sich unterschiedliche Einflüsse begegneten: Die künftigen Etrusker, damals noch Teil der Villanovakultur, übernahmen von den Latinern, deren kollektive Identität rings um die Heiligtümer in den Albaner Bergen zu jener Zeit bereits sehr viel stärker ausgebildet war als ihre eigene, zahlreiche Götter und Riten, darunter auch diejenigen zur Begrenzung einer Siedlung. Nachdem die Etrusker jedoch im Laufe der Zeit gerade auf dem Gebiet der Stadt eine besonders hoch entwickelte Zivilisation geschaffen hatten, begannen die hinter dieser Evolution zurückgebliebenen Römer für etruskisch zu halten, was ursprünglich zwar nicht etruskisch war, aber in Etrurien seine höchste Entwicklungsstufe erreicht hatte. Daher glaubten sie, die Stadtgründungsriten seien etruskisch, obwohl sie sie mit lateinischen Begriffen bezeichneten.
Dies alles erklärt, weshalb in lateinischen Texten wie auch auf Münzen oder Flachreliefs eine Pflugszene später als Symbol für die Gründung einer Stadt genügte, sei es nun die Gründung von Rom selbst oder einer ihrer Kolonien: Denn auch Letztere nahmen einen Ritus auf, der nicht, wie behauptet, im Nachhinein für sie erfunden worden war, sondern der sich ihnen als römisches Modell geradezu aufdrängte. Und damit ist auch die semantische Verbindung hergestellt zwischen dem Wort urbs und Begriffen wie urbare, das in der religiösen oder juristischen Sprache den Akt des Pflügens bezeichnet (urvum), der Bezeichnung für die gebogene Pflugschar, oder auch orbis, das auf das Konzept des Kreisumfangs verweist. Der Ritus schuf die Stadt, nicht die Stadt im Nachhinein den Ritus, und in Rom entstand damit, wie fortan noch so oft, aus Altem und bereits Bekanntem etwas radikal Neues.
Die Urbs war also zunächst eine Abgrenzung, ein Kreis, verkörpert durch eine Furche, die mit einem Pflug in den Boden gezeichnet worden war. Und dieser Pflug bewegte sich natürlich nicht von selbst. Das bedeutet, wir müssen zugeben, so unglaublich, so unvorstellbar es auch scheinen mag, dass diese ursprüngliche Szene des Sulcus Primigenius tatsächlich stattgefunden haben kann. Welchen Namen geben wir also dem Mann, der den Pflug führte und der zweifelsohne auch den Befehl dazu erteilte, den Palatin mit einer Mauer zu umschließen? Die Römer nannten ihn bekanntermaßen Romulus, und wenn sie ihm einen Zwillingsbruder namens Remus gaben, dann fraglos deshalb, weil in der mythischen Vorstellung – nicht nur der Indoeuropäer – Zwillinge als Zeichen göttlicher Gunst und Macht galten. Alte Namen, die, selbst wenn sie erfunden sind, nicht später als im sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstanden sein können und die auf die eine oder andere Weise mit dem Namen Rom in Beziehung stehen.
Zwar sind diese Schlussfolgerungen sicherlich von großer Bedeutung, um die Anfänge einer Stadt zu verstehen, die sich selbst während ihrer gesamten tausendjährigen Geschichte als Urbs bezeichnen sollte. Doch bleiben scheinbar unüberwindbare Gegensätze zwischen Archäologie und Etymologie bestehen. Denn verrät Erstere uns nicht, dass der Palatin im achten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bereits seit Langem besiedelt war? Er also keineswegs jener einsame, menschenleere Ort war, den die Romuluslegende voraussetzt? Wie soll unter diesen Umständen gegründet worden sein, was längst existierte? Ist das Vorhandensein von Siedlungsspuren auf dem Palatin, die weiter zurückreichen als die vermeintliche Zeit des Romulus, nicht Beweis genug, dass es schlichtweg keine solche Gründung gab, dass wir es lediglich mit einem Mythos zu tun haben, der im Geist der Römer zwar allgegenwärtig war, aber jeglicher historischen Grundlage entbehrt? Es scheint nur zwei Möglichkeiten zu geben: Entweder ist die Romuluslegende wahr, dann war der Palatin menschenleer, oder aber der Palatin war bereits besiedelt, dann ist die Legende falsch.
Gewiss, aber die Kontinuität und Komplexität des konkreten, vielschichtigen Verlaufs realer Geschichte lässt sich nicht unbedingt durch die starke Vereinfachung einer solch binären Logik erklären. Im vorliegenden Fall ist die entscheidende Frage nicht so sehr, ob der Palatin vor dem achten Jahrhundert bereits besiedelt war oder nicht, sondern vielmehr, in welchem Rhythmus und unter welchen Gegebenheiten diese Besiedelung erfolgte, denn an der Tatsache menschlicher Präsenz auf dem Hügel in jener Zeit besteht kein Zweifel mehr. Ganz zu schweigen von den vereinzelten Zeugnissen kleinerer Gruppen, die seit dem Paläolithikum auf dem Hügel Feuerstein bearbeiteten und in jahreszeitlichem Wechsel dort lebten, während die ersten Überreste dauerhafter Besiedelung, wie wir gesehen haben, aus der mittleren Bronzezeit stammen,11 auch wenn der Palatin damals nur an zweiter Stelle hinter dem besser zu verteidigenden Saturnischen Berg rangierte. Ab dem zehnten und vor allem dem neunten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung begann sich diese Hierarchie umzukehren, und nach und nach wurde der Palatin zum Zentrum der Besiedelung auf den Hügeln am Flussufer. Die Details dieser Entwicklung lassen sich nicht so leicht rekonstruieren, denn – und darin liegt die ganze Schwierigkeit – selbst in der Archäologie gibt es keine klaren Fakten. Alles, oder zumindest fast alles, ist letzten Endes Interpretationssache, was keineswegs bedeutet, dass jede beliebige Hypothese möglich ist! So bleiben etwa sowohl die absolute als auch die relative Datierung der Siedlungsspuren immer noch äußerst schwierig und umstritten: Allein die berühmten Löcher für die Stützpfosten der Hütten, die heute noch im Boden des südöstlichen Palatins zu erkennen sind, wo sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts freigelegt wurden, sind Gegenstand intensivster Debatten. Wie viele Hütten, aus welcher Zeit, mit welcher Funktion? Einige Experten ordnen sämtliche Spuren einem einzigen großen Dorf zu, das bereits im neunten Jahrhundert an dieser Stelle existiert haben soll. Andere wiederum vertreten die Ansicht, es handle sich um zeitlich aufeinanderfolgende Hütten, und die eigentliche Siedlung sei somit deutlich jünger. Eine Kuhle im Boden wird bald als Gründungsgrube interpretiert, die möglicherweise an ein Ereignis von großer historischer Bedeutung – eventuell sogar die Gründung Roms selbst! – erinnert, bald als schlichtes Grab. In weiteren Bodenvertiefungen sehen die einen Grabstätten, andere die Vorratskammern nahe gelegener Hütten und manche gar ganz gewöhnliche Abfallgruben …12
Nichtsdestoweniger scheint das neunte Jahrhundert auf dem Palatin tatsächlich eine deutliche Schwelle zu markieren: Etwa in der Mitte des Hügels und in seinem nordöstlichen Bereich entstand allmählich ein Dorf. In jener Zeit waren die Gräber noch nicht klar von den Hütten abgegrenzt, im südwestlichen, zum Fluss hin weisenden Teil des Hügels, dem die Römer später den Namen Germal geben sollten, lagen am Beginn des Jahrhunderts noch zahlreiche Grabstätten. Doch dann wichen die Toten den Lebenden: Zweifellos begünstigt durch den nahen Fluss, bildete sich gegen Ende des Jahrhunderts an dieser Stelle ein kleiner Weiler. Dicht bei der Hügelkante, wo der Aufstieg, die sogenannte Cacus-Treppe (Scalae Caci) begann, wurde eine große Hütte mit ovalem Grundriss errichtet, die möglicherweise Schauplatz religiöser Riten war. Um die Mitte des achten Jahrhunderts schließlich tauchte ein Dorf auf, dessen Hütten nahezu ausnahmslos nach Osten ausgerichtet waren. Jedes Mal, wenn ihre Bewohner sie verließen, sahen sie vor sich am Horizont die wuchtige Masse des Albanus Mons, des für den alten Latinerbund magischen Berges. Dieses Dorf auf dem Germal hatte etwa zwei Jahrhunderte lang Bestand, danach wurde es aufgegeben, und in der Nähe einer seiner Hütten richtete man eine religiösen Zeremonien vorbehaltene Fläche ein. Seit dem Beginn des achten Jahrhunderts also scheint der gesamte Hügel, von der Cacus-Treppe bis hin zu dem, was eines Tages die Weinberge der Barberini sein werden, immer dichter besiedelt gewesen zu sein.13 Daher fällt in die Mitte jenes Jahrhunderts natürlich nicht der Bau der allerersten Behausungen auf dem Palatin, diese sind sehr viel älter, wohl aber die endgültige Bestätigung der herausgehobenen Stellung, die der Hügel im Laufe einer Entwicklung erlangte, die mehr als ein Jahrhundert zuvor begonnen hatte, als Palatin und Velia im Rahmen der Feierlichkeiten des Septimontium als Erste Schauplätze des prestigeträchtigsten Opfers waren.14 Dabei ist diese Entwicklung augenfällig genug, um Folge einer bewussten Entscheidung zu sein. Mit anderen Worten, sie verläuft ganz so, als sei sie das Ergebnis einer autoritären Maßnahme mit dem Ziel, die bislang auf dem gesamten Areal verstreut lebenden Menschen auf dem Palatin zusammenzufassen. Denn im Nordwesten des Hügels zögerten die Erbauer der Mauer nicht, einen Weiler dem Erdboden gleichzumachen, der aus einigen noch recht neuen Hütten bestand:15 Der Wille, den Palatin mit dem magischen Schutz des Pomerium zu versehen, überwog demnach gegenüber der Rücksicht auf bestehende Verhältnisse. Und erst ab diesem Zeitpunkt begann der Hügel, eine Einheit zu bilden, eine geeinte Siedlung, aus der die Gräber verbannt wurden – wenn nicht vollständig, so doch zumindest an den Rand der Anhöhe – und in der dieselbe Autorität, die ringsum eine Mauer hatte errichten lassen, nun Menschen und Güter bündeln konnte. Ein bereits mehrere Jahrhunderte währender, allmählicher Prozess hatte den Boden für die nun endlich möglich gewordene Gründung eines geschlossenen Raums bereitet, dem der uralte Ritus der allerersten Furche für alle Zeiten den Namen Urbs verleihen sollte. Und dass es eines so langen Vorlaufs bedurfte, bis allein der Palatin zu einer Einheit zusammenwachsen konnte, macht es umso unwahrscheinlicher, dass die verschiedenen Hügel am Ufer des Flusses bereits ein Jahrhundert zuvor ein geeintes Ganzes gebildet haben könnten, wie es sich jene Verfechter eines großen ‚Proto-Rom vorstellen.
Der im achten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erfolgte Entwicklungsschritt war mithin nicht der erste, wohl aber der entscheidende und sollte der Stadt Rom ihren Namen und ihre Identität verleihen. Bis zum Ende der Antike würde die Urbs dieses Gründungsmoments gedenken. Und selbst nachdem das Dorf auf dem Germal aufgegeben worden war, blieb eine fortwährend erneuerte Hütte unter dem Namen Casa Romuli, ‚Haus des Romulus‘, unverändert bestehen – wie man auch heute noch in Japan, dem Land der Wolkenkratzer und der fortschrittlichsten Technologien, ein hölzernes Heiligtum findet, das seit Jahrhunderten zu Ehren der Göttin Ise und im Gedenken an eine vergangene Gründungsepoche immer wieder auf identische Weise neu errichtet wird.
Die Lupercalia
Die Vorrangstellung des Palatins wurde in Rom jedes Jahr mit einem großen religiösen Fest verdeutlicht, dessen Rituale fraglos zu den eigentümlichsten, aber auch zu den beliebtesten gehören, die je auf dem Boden der Urbs gefeiert wurden: die Lupercalia.16 An jedem 15. Februar strömten die Römer beim Palatin zusammen. Anfangs waren es noch nur einige Hundert, doch später sollten an diesem Tag Zehntausende in einer wahren Menschenkette die unteren Hänge des Hügels zum Velabrum und zur zentralen Talsenke hin bevölkern. Was gab es dort zu sehen? Rennende junge Männer, mit nichts als einem Lendenschurz bekleidet, die in ihrem Lauf nur innehielten, um mit langen, schmalen Fellstreifen Frauen zu peitschen, die sich ihnen in den Weg stellten und sich bereitwillig den Schlägen aussetzten! Am Ende ihres Laufes erreichten die Männer wieder den Ausgangspunkt, das Lupercal, jene Höhle in der Nähe des Flussufers, in der die Wölfin der Legende nach die Zwillinge aufgenommen haben soll, nachdem deren auf dem Tiber treibende Wiege am Fuß der Anhöhe gestrandet war. Sehr viel später machten die Römer, die diese alte Erzählung nicht mehr verstanden, aus der Wölfin eine Dirne mit großem Herzen. Die moderne Forschung hingegen sieht in ihr, dank der Erkenntnisse der Ethnologie, ein Totem: Durch eine für das ‚wilde Denken‘ typische Umkehr wurde der Wolf, Inbegriff des Raubtiers in einer Hirtengesellschaft, deren wesentliche Aktivität in der Aufzucht von Schafen bestand, zum schützenden Tier. Schützend und somit beruhigend, umso mehr, als es sich um eine Wölfin mit nährenden Zitzen handelte. Nahezu unbekleidet und rennend, was das Zeug hielt, während es sich für einen anständigen Bürger geziemte, Kleidung zu tragen und sich gemessenen Schrittes zu bewegen, feierten die beiden Gruppen der heiligen Bruderschaft der Luperci ein Ritual, das unter der Ägide des Faunus stand, des wilden und zugleich zivilisierten Grenzgottes: An diesem einen, teilweise den Toten geweihten Februartag imitierten sie, unter Verweis auf die Jugend der Gründerzwillinge, jenes wilde Leben, das vor der Stadtgründung, vor Rom, an diesem Ort geherrscht hatte. Als Luperci, die Ziegen und einen Hund opferten, waren sie ‚Wolfsmänner‘, bis der Ritus sie in ‚Bocksmänner‘ verwandelte, wodurch sie symbolisch den Übergang vollzogen vom Räuber in der Herde zum Befruchter derselben und somit zu einer Figur, die für Wohlstand und Lebensunterhalt sorgte. Ihr zügelloser Lauf, der für sie selbst den Eintritt ins Erwachsenenalter markierte, bedeutete für den gesamten Palatin, Ort der ersten Urbs, eine Form der Reinigung und sollte für das Anwachsen der Gemeinschaft sorgen, deren Zentrum der heilige Hügel war. Denn in jenen archaischen Zeiten fühlten sich die Menschen verletzlich, bedroht sowohl durch die gewaltigen Kräfte der Natur als auch durch die Feindseligkeit benachbarter Völkerschaften. Es war eine Welt, in der man sich nicht, wie in der unsrigen, vor Überbevölkerung fürchtete, sondern im Gegenteil davor, durch Krankheiten oder Hungersnöte dezimiert zu werden und somit dem Untergang geweiht zu sein. Gegen diese noch lange anhaltenden Ängste wappnete die Zeremonie der Lupercalia, die am Fuß des Palatins begann und endete, ohne den Hügel jedoch zu umrunden,17 die römische Gemeinschaft mit den magischen Kräften einer reinigenden, fruchtbringenden Erneuerung. Durch das kollektive Gedächtnis der Stadt einer nunmehr gemeinschaftlichen Zeit, einem gemeinschaftlichen Raum zugeschrieben, ermöglichte der rituelle Lauf der ‚Wolfsmänner‘ während der gesamten Geschichte Roms jedem Bewohner einmal im Jahr, den Übergang von der Natur zur Kultur, die Geburt der Stadt und den für alle Zeiten privilegierten Status des geheiligten Hügels mitzuerleben.
Vor allem auf der nördlichen Seite des Hügels, dem Tal zugewandt, wo die Stadt ihre Toten begrub, wachten wohlwollende chthonische Schutzgottheiten.18 Diese Laren (Lares Praestites) waren keine anderen, als die ins Jenseits übergetretenen Zwillinge der Gründungssage, welche die Gemeinschaft auch weiterhin vor Unheil bewahrten, insbesondere im Bereich der Porta Mugonia. Und nicht weit von dem Tor entfernt, das den Namen Roms trug, lag das Grab der Acca Larentia, der ‚Mutter der Laren‘. Dort befand sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu vergleichbaren Gestalten, etwa der Tacita Muta (die Große Stumme) oder der Angerona (die Beklommene), jener Göttin der beängstigenden Verkürzung der Tage in der dunklen Jahreszeit. Bezeichnenderweise huldigten die Römer all diesen Göttinnen zur Wintersonnenwende: im Dezember, dem, wie bereits sein Name verrät, damals zehnten Monat eines Jahres, das mit dem März begann. Dort gelegen, wo der heilige Palatinhügel endete, und verehrt am Ende des Jahres, verkörperten ihre Kultstätten somit eine dreifache, räumliche, zeitliche und gemeinschaftliche, Begrenzung. Sie schieden die Urbs von der Außenwelt, das laufende Jahr von dem vergangenen und die Gemeinschaft der Lebenden von den Toten. Das bedeutet, diese erste Stadt ließ ihre Bewohner durch ihr Erscheinungsbild eine immer wieder erneuerte symbolische Übereinstimmung zwischen der Anordnung des Raums und dem Lauf der Zeit sehen und erleben: Schon in diesem frühen Stadium bildete die Urbs eine Art verkleinertes Universum, einen unter den Schutz der Götter gestellten eigenen Kosmos. Dank der Rituale der Vogelschau und der allerersten Furche war sie ‚befreites‘ Territorium, das heißt geschützt vor äußeren göttlichen Bedrohungen, sie war sakral ‚abgegrenzt‘ und ‚inauguriert‘. Was nicht bedeutete, dass sie wie ein Tempel einer oder mehreren Gottheiten geweiht gewesen wäre – in diesem Fall hätten die Sterblichen dort nicht leben können! –, sondern dass die positiven Zeichen, welche die ursprüngliche Beobachtung des Vogelflugs (auspicium) ergeben hatte, ihrem Boden von diesem Tag an das Augurium garantierten, ein göttliches Potenzial, gleichsam eine mystische Kraft und Macht – kurzum göttlichen Segen.19
Ein Ereignis ohne Ende
Trotz der unbestreitbaren und vielfältigen früheren Besiedelung der Hügel hatten die, wie wir inzwischen wissen, aus ferner indoeuropäischer Vergangenheit übernommenen Riten zu einem endgültigen Bruch geführt: Nichts konnte danach mehr so sein wie zuvor. Obwohl dies chronologisch betrachtet sicher nicht der erste Moment ihres kollektiven Werdens war, beschlossen die Römer, ihn als den – zumindest fast – absoluten Beginn ihrer bürgerlichen Geschichte und Erinnerungen zu betrachten. Die Gründung der Urbs auf dem Palatin bildete von nun an für sie einen gleichermaßen chronologischen wie topografischen Ankerpunkt, der mehr als ein Jahrtausend lang der Datierung, insbesondere religiöser Ereignisse, diente. So vermeldeten offizielle Dokumente der Republik oder des Kaiserreichs, etwas habe in einem bestimmten Jahr ‚seit der Gründung der Stadt‘, ab Urbe condita stattgefunden. Im Zentrum steht hier also etwas ganz anderes als die simple Frage, ab wann der Hügel faktisch erstmals besiedelt war. Nicht nur auf dem Palatin, auch auf anderen Hügeln lebten bereits vor dem achten Jahrhundert zumindest vorübergehend Menschen. Wie wir gesehen haben, war die Phase des Septimontium von großer Bedeutung, und es könnte sogar sein, dass das kollektive Gedächtnis der Stadt zunächst sie als zeitliche Referenz nahm.20 Doch letzten Endes war es die romuleische Gründung, die Rom für sich als Geburtsort und -stunde wählte, und ebendiese Entscheidung ist ein historischer Akt, dessen gesamte Tragweite es zu ermessen gilt. Denn in der Vergangenheit wurden Vorgang und Intention verwechselt, und man hat vergessen, dass die Gründung in erster Linie religiöser und symbolischer Natur war.21 Gründen bedeutet, gründen zu wollen. Es bedeutet, feierlich und rituell zu verkünden, dass hier und jetzt etwas erschaffen wird. Bevor die Gründung zu einem einmaligen, Jahr für Jahr durch die Feier der Parilia am 21. April gewürdigten Akt wurde, war sie ein Gedanke. Sie war ein Anfang, der als solcher in den Bereich des Immateriellen gehört und dazu bestimmt ist, stets wieder aufs Neue begonnen und begangen zu werden: ein Ereignis ohne Ende. Die Gründung Roms entspricht somit der Gründung des Mythos von der Gründung Roms.
Und so steht tatsächlich auch der Mythos im Vordergrund, wenn die römische Überlieferung aus dem Gründer den Sohn eines Gottes und einer heiligen Jungfrau macht, der auf wundersame Weise aus den Fluten gerettet worden und nach seinem Tod als Gottheit wieder auferstanden sei. Aufgrund dieser Allgegenwart des Mythos hat eine gewisse positivistische Strömung jede Möglichkeit einer historischen Wahrheit kategorisch ausgeschlossen, eine Sichtweise, auf der sie nach wie vor beharrt. Doch nachdem uns die spektakulären archäologischen Funde der letzten Jahrzehnte den archimedischen Hebel in die Hand gegeben haben,22 nachdem sämtliche Minen, die die alten Theorien auf ihrem Weg zurückgelassen hatten, sorgsam entschärft worden sind, ist es nun an der Zeit einzusehen, dass der Mythos im ‚primitiven‘ römischen Denken wie in jedem ‚wilden‘ Denken keinen Gegensatz zur Geschichte bildet, sondern vielmehr Ausdruck der Geschichte ist. Eben weil das kollektive Gedächtnis der Römer die Bedeutung dessen unterstreichen wollte, was sich damals vollzog und durch die Errichtung einer ersten Mauer um den Palatin Gestalt annahm, erschuf es das Bild eines vor der Ankunft der Zwillinge menschenleeren, nur von weidendem Vieh bevölkerten Hügels – und das in offenkundigem Widerspruch zur Existenz bereits bestehender Siedlungen. Mythos und Geschichte sind also beileibe keine Antagonismen wie Irrtum und Wahrheit, Virtualität und Realität, stattdessen beweist vielmehr der mythische Charakter der römischen Überlieferungen zur Stadtgründung auf dem Palatin letztlich deren historischen Wahrheitsgehalt. Mit dem Ziehen der allerersten Furche entstanden sowohl ein sakral geschützter Raum als auch eine neue Ära: Was durch das Gründungsritual geschaffen wurde, war eine Stadt, die von diesem Moment an unablässig bestrebt sein würde, sich als die Stadt zu manifestieren, das heißt als eine Welt, die es der Gemeinschaft auf den Hügeln ermöglichte, ihre kollektive Identität für die kommenden gut zwölf Jahrhunderte in einem neuartigen Raum-Zeit-Kontinuum zu leben.