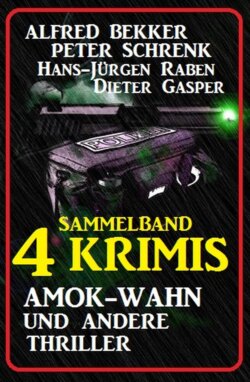Читать книгу Sammelband 4 Krimis: Amok-Wahn und andere Thriller - Alfred Bekker - Страница 45
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеWelcome to READING twinned with DÜSSELDORF.
Form und Farbe des Schildes auf der linken Straßenseite sind unüblich für englische Ortsschilder. Auch der rote Stahlrohrrahmen drumherum weicht von der Norm ab und erhöht Benedicts Erwartung an diese Stadt, die aus ihm unbekannten Gründen irgendwann einmal den Reigen organisierter Städtepartnerschaften eröffnet hatte. Haifa in Israel und Karl-Marx-Stadt in Ostdeutschland waren gefolgt. Letztere auf besondere Empfehlung des allmächtigen Brillenträgers. Des gebürtigen Saarländers. Aber wie auch über diese Städte wissen normale Bewohner der rheinischen Landeshauptstadt kaum etwas über das englische Reading. Selbst der halbwissende Ehrgeizling Eugen Sprotte, seines Zeichens auf die Karlsruher Berufung hoffender Staatsanwalt in Düsseldorf, hatte ihm einen angenehmen Aufenthalt in »Rieding« gewünscht. Vitus H. Benedict wollte seinem Intimfeind von der Staatsanwaltschaft daraus keinen Vorwurf machen. Die englische Sprache hielt selbst für die Eingeborenen eine Menge verzwickter Fallen bereit, und je tiefer man in die Nischen der fremden Sprache vorzudringen glaubte, desto schwerer waren Doppelböden und Fallstricke zu erkennen.
Die abenteuerliche Nervosität bei der Einfahrt in die unbekannte Stadt zwingt ihn zu angespannter Konzentration. Schließlich setzt er sich einfach zwischen einen Möbeltransporter und den beigeroten Doppeldeckerbus mit der Aufschrift Reading Transport. So kann er sich etwas entspannter in das ungewohnte Terrain hineintreiben lassen.
Gemächlich rollt der Wagen im nachmittäglichen Sonnenschein dahin. Kinder turnen auf den Spielgeräten eines weitläufigen Parks auf der linken Seite. Am Ende des Parks eine rotbraune Kirche aus verwitterten Ziegeln. Gewaltig überragt eine Trauerweide graue Gräberreihen. Klein Friedhofs-Manhattan. Muss bei nächtlichem Vollmond schön gruselig sein. Rechts putzige Reihenhäuschen in neuzeitlicher Ziegelbauweise. Aneinandergereihte Perlen auf dem Rechenschieber. Hellrot. Die könnten überall so rumstehen. Ein kleiner Fish&Chips-Laden namens »Mr. Cod«. Ein indischer »take-away«-Imbiss. Also doch noch England.
Jetzt kommt‘s aber dicke: anthrazitgraue Geschäftsmoderne. Rechts und links der Straße hingeklatscht. Versicherungsspiegelhochglanz. Ein ausladendes Gewerbegelände mit modernen Lagerhallen. Werbeflächen von Sainsburys und Toys »R« Us senden grelle Grüße. Als sei es noch nicht genug, lange Reihen schimmernder Fensterflächen auf den Hochhäusern expandierender Computerfirmen.
Benedicts Mundwinkel sind vor Enttäuschung tief heruntergezogen, als er am gleichfalls modernst gestylten Pyramidenbau des Bahnhofs den Begleitschutz der beiden großen Fahrzeuge verlässt und links in die Queen Victoria Street einbiegt. Na gut. Cambridge, Oxford oder gar Stratford-upon-Avon hatte er nicht gerade erwartet. Aber das hier ... schließlich hatte man doch gewisse Vorstellungen von einer englischen Stadt. Gegen dieses architektonische Sammelsurium sehen ja selbst Birmingham und Manchester noch typischer aus.
Soll er jemanden nach dem Weg zum Hotel fragen? Kaum jemand auf der Straße. Merkwürdig. Am Ende der Straße muss er neben dem Gebäude der Barclay Bank als Rechtsabbieger warten und wirft einen Blick auf den kleinen Orientierungsplan, der den Tagungsunterlagen beigefügt war. Das rot markierte Parkhaus liegt gottlob auf der anderen Seite der Oxford Road, wo das Ramada-Hotel ist. Vorbei an der überdachten Zufahrt des großen Hotels fährt er noch etwa 100 Meter, um dann nach rechts in das Parkhaus am Eaton Place einzubiegen.
Mit dem Koffer in der Hand blickt er auf eine doppelspurige, unter der Oxford Road hindurchführende Autostraße hinunter, die eigentümlich leer im Sonnenlicht liegt. Kopfschüttelnd geht er die wenigen Meter weiter zum Eingang des rostig schimmernden Ramada-Hotels. Weder in der großen Hotelhalle noch am Rezeptionsschalter ist jemand zu entdecken. Hier scheint ja alles verlassen zu sein, wundert sich Benedict. An der Wand hinter dem langen Empfangsschalter zeigen zwei Uhren unterschiedliche Zeiten. Darunter eine Tür. Halb angelehnt. Aus dem Raum dahinter tönt das aufgeregte Stakkato einer Sportreporterstimme. »Hallo?«, ruft der Düsseldorfer halblaut und als sich dann immer noch nichts rührt, nochmals lauter: »Hallo!«
Das Gesicht der jungen Frau, die jetzt eilig in der Tür erscheint, gleicht sich der Farbe ihrer Jacke an. Mit hochrotem Kopf stößt sie ein verlegenes »Sorry, Sir!« hervor und weist stotternd darauf hin, dass sie sich gerade das Fußballspiel zwischen England und Holland im Fernsehen ansehe und ... dann fragt sie ihn aber doch noch, ob er reserviert habe.
Benedict macht sich nicht besonders viel aus diesem Fußball. Er legt ihr nachsichtig lächelnd die Hotelbestätigung auf den Schalter. Augenblicklich wird ihr eben noch entspannter Gesichtsausdruck verschlossen förmlich. Mit einem hastigen »Excuse me, Sir!« verschwindet sie wieder durch die Tür nach hinten und kommt wenig später mit einer Namensliste wieder, auf welcher sie einen Namen abhakt.
»Sie haben das Zimmer 602 im sechsten Stock!« Sie legt die Schlüssel auf den Schalter. »Der Lift ist dort drüben!« Ihre ausgestreckte Hand deutet auf die rechte Seite der Hotelhalle.
Bevor sie wieder verschwinden kann, fragt Benedict hastig noch: »Können Sie bitte mal nachsehen, ob ein Mr. Sakamoto schon eingetroffen ist? Er müsste auch auf Ihrer Liste stehen.«
»Nein«, ist die enttäuschende Antwort der Dame in Rot, »aber die meisten Herren sind auch erst für Montagmittag avisiert. Sorry, Mr. Benedict!«
Als der sich etwas mürrisch mit dem Koffer in der Hand nach links wendet, ist er fast sicher, dass sie schon wieder durch die Tür nach hinten verschwunden ist. Im Aufzug dudelt die gleiche Überallplätschermusik wie in der Hotelhalle. Ohne Halt fährt er hoch in die letzte Etage des sechsstöckigen Hotels. Ein Gong verkündet das Ziel, und leise summend öffnen sich die verchromten Lifttüren. An der Flurwand gegenüber hängt ein braunes Hinweisschild mit einem nach rechts weisenden Pfeil. Räume 601-620. Darunter zeigt ein anderer Pfeil in die entgegengesetzte Richtung des Ganges zur Präsidenten-Suite.
Feudal, feudal, denkt Benedict. Besorgt stellt er dann fest, dass sein Zimmer rechts fast neben dem Aufzug liegt. Nur das Zimmer 601 befindet sich als Schalldämmung zwischen seinem Schlaf und den Aufzuggeräuschen. Auch scheint auf den ersten Blick der mit grünem Teppich ausgelegte Raum doch etwas eng. Er wirft die Schlüssel auf den kleinen braunen Schreibtisch und legt seinen Koffer auf die Ablage davor. Jacke, Weste und Krawatte verschwinden in dem großen Wandschrank gleich neben der Zimmertür. Erleichtert schält er seine braunen Sommerslipper von den angeschwollenen Füßen und streckt sich wohlig grunzend auf dem breiten Doppelbett aus. In dem großen Spiegel gegenüber, über dem Schreibtisch, kann er sein von Anstrengung leicht gerötetes Gesicht sehen. Die graublonden gescheitelten Haare haben ihre Fasson verloren, als er die noch geknotete Krawatte hastig über den Kopf gezogen hatte. Genüsslich lässt er seine Fußzehen in den beigen Socken Aerobic machen.
Links vom Schreibtisch mit dem Spiegel steht ein schwarzer Fernseher, dann kommt schon die Wand mit dem Fenster. Er würde nachher mal einen Blick nach draußen werfen. Na, bis Freitag nächster Woche würde es schon gehen.
Benedict richtet sich auf der zu weichen Matratze wieder auf. Suchend irrt sein Blick durch das kleine Zimmer. Irgendwo muss doch ... er steht auf und öffnet nochmals die Schiebetüren des großen Wandschranks neben der Tür. Da findet er sie endlich. Versteckt in der Ecke rechts unten – die Minibar. Er nimmt den Zimmerschlüssel vom Schreibtisch, bricht das Türsiegel und schließt den kleinen Durstlöscher auf. Die Musterung des Inhaltes ist unbefriedigend. Kein Champagner und keine grünen Jameson-Minis. Fast übel wird ihm, als er die beiden braunen 33-cl-Flaschen sieht. Die zu flüssiger Chemie geronnenen Bieranmaßungen der Firma Anheuser-Busch aus dem US-Bundesstaat Missouri mit der ketzerischen Aufschrift »Budweiser King of Beers« auf dem blauweißroten Etikett. Trinkbar, nicht genießbar, nur eisgekühlt und somit von den Geschmackssensoren nicht mehr zu erfassen. Und das ihm, einem langjährigen Kenner und Liebhaber des echten Bieres aus dem tschechischen Budweis. Der vor der geöffneten Minibar hockende Mann schüttelt sich und nimmt verzweifelt eine Cola heraus.
Erst mal duschen, und danach werde ich sehen, was mit diesem Reading sonst so los ist.
Die Polizeiführung wollte nichts anbrennen lassen.
Statt den Umgang mit der mächtigen Medienmafia irgendwelchen hilflosen Kreispolizisten zu überlassen, schickt der Düsseldorfer Polizeichef den routinierten Pressesprecher Bernd Stüchow an die journalistische Front.
Zu oft hatte man in der Vergangenheit erleben müssen, wie ungelenken Dorfsheriffs von abgezockten Polizeireportern der Boulevardpresse die Worte im Munde verdreht wurden. Schon die hektische Wirklichkeit eines aus dem Ruder laufenden Polizeieinsatzes war schlimm genug. Da brauchte es nicht noch zusätzliche Verwirrung und Stimmungsmache durch profilierungssüchtige Redaktionskarrieristen.
So hatte das »Karo« den Düsseldorfer Pressesprecher mit einer klaren Order in das Hotel Luisenhof geschickt: »Sorgen Sie dafür, dass die Polizeikräfte nicht durch rumturnende Presseleute gefährdet werden. Keine Behinderung des Einsatzes durch allzu detaillierte Berichterstattung in Funk und Fernsehen. Ich will das Gesicht des Täters nicht als Medienstar auf irgendeinem Bildschirm sehen! Ist das klar? Na dann ... Glück auf!«
Stüchow ist ein Profi. Als Bulle und als Pressesprecher. Auch er will Karriere machen. Noch vom Präsidium in Düsseldorf aus lässt er über alle ihm erreichbaren Kommunikationskanäle verlauten, dass um 19 Uhr 30 im Hotel Luisenhof in Metzkausen eine große Pressekonferenz der Einsatzleitung stattfinden wird. Anschließend fliegt er sofort an Bord eines Polizeihubschraubers in die 15 Kilometer entfernte Kreisstadt.
»Haben Sie noch irgendwo einen größeren Raum im Hotel? So für circa zwanzig, dreißig Leute?«, fragt er die erschöpft wirkende Hotelbesitzerin.
»Im Hotel selbst nicht«, schüttelt die am Empfang stehende Frau den Kopf, »aber Sie können vielleicht das Restaurant benutzen. Kommen ja heute sowieso keine Gäste mehr ... wo hier alles gesperrt ist!«
Der kantige Stüchow überhört den weinerlichen Vorwurf und fragt brüsk: »Können Sie das veranlassen?«
»Nein, das kann ich nicht. Das Restaurant gehört ja gar nicht zum Hotel. Da müssen Sie schon den Besitzer fragen!«
»Und wo finde ich den?« Stüchow ist schon mit ganz anderen pikierten Damen zurechtgekommen.
»Wer ersetzt mir eigentlich die Ausfälle?«, ist gleich die erste Frage des aus der Küche herbeigeholten Mannes.
»Die werden von der Landesregierung ersetzt! Wir schicken Ihnen die Formulare zu. Kann ich also bei Ihnen einen Presseraum einrichten?«
Der feiste Restaurantbesitzer zeigt Befriedigung auf den Grübchen seines Rundkopfes. »Doch ... doch, doch. Dann schon!«, nickt er.
Mit zwei Mitarbeitern der Pressestelle gruppiert Stüchow schnell die Einrichtung des französischen Restaurants um. An das Kopfende kommen drei Tische für die Sprecher, dann in mehreren Reihen Tische und Stühle für die Journalisten.
»Wo ist denn der ermittelnde Staatsanwalt?«, fragt er sich anschließend weiter durch.
»Draußen im BefKw!«, kommt die knappe Antwort.
Die Befragung des Gesuchten draußen im großen Kommandobus hätte er sich fast ersparen können. Staatsanwalt Eugen Sprotte ist bei der Düsseldorfer Polizei berühmt und berüchtigt für seine glanzvollen Presseauftritte.
»Dann um Punkt 19 Uhr 30 drüben im Restaurant, Herr Sprotte!«
»Selbstverständlich, Herr Stüchow!«
Den Leitenden aus dem Krisenstab im Präsidium zu einer Pressekonferenz aufs Land zu bekommen, da versagen selbst Stüchows Künste. So muss er mit der zweiten Wahl, dem Einsatzleiter der Kreispolizei, vorliebnehmen. Von irgendwoher organisiert er dann noch Mikros, Lautsprecher und Blankokarten für Akkreditierungsausweise. Lässt sich vom Fernmeldetechnischen Dienst mehrere Telefone und sogar ein Telefax in den provisorischen Presseraum legen. Die Verbindungstür zwischen Restaurant und Hotelhalle wird für den normalen Betrieb gesperrt und von einem Beamten bewacht. Auch am Restauranteingang zur Florastraße postiert er eine Polizistin, und innen, gleich hinter dem Eingang, sitzt einer von der Pressestelle, der auf der im Hotel requirierten Schreibmaschine die Akkreditierungen tippen soll. Auch noch an ein weiteres großes Messtischblatt des Einsatzgebietes kommt Stüchow irgendwie. Dekorativ hängt er es im Rücken der Sprechertische auf.
»Fertig!«, meint er dann mit dem zufriedenen Rundumblick eines Künstlers. Aber irgendwas scheint noch zu fehlen. Das Werk ist noch nicht perfekt. Schon wieder ist der schlanke Mitdreißiger mit zielstrebigen Schritten unterwegs. Kommt wenige Minuten später mit einem organisierten Fernseher unter dem Arm wieder zurück. Platziert auch den schwarzen Monitor als Blickfang am Ende des Raumes.
Jetzt klatscht er in die Hände.
»Fertig! Die Geier können kommen!«
Stüchows Ankündigung einer Pressekonferenz über die Kommunikationskanäle vorhin wirkt wie Rizinus in den Eingeweiden. Als Gernot Ganser leicht verrußt von seinem SEK-Ausflug zurückkommt, ist das zum Pressezentrum umfunktionierte Eckrestaurant proppenvoll.
Es ist laut. Die Journalisten rutschen unruhig auf ihren Sitzen herum, sich gegenseitig den letzten Stand der Dinge mitteilend. Professionelles Halb- und Nichtwissen macht laut die Runde. Fotografen probieren ihre Blitze aus. Blendende Helle fällt auf die noch leeren Tische am Kopfende, wenn die Fernsehteams ihre aufgestellten Scheinwerfer justieren.
Mit seiner warmen Cola in der Hand setzt sich der Kriminalhauptmeister neugierig auf einen der an die Wand gerückten Speisetische. Eingekeilt von einem Pulk Kameramänner, die in der Enge um die günstigste Aufnahmeposition kämpfen, lässt er die Beine baumeln. Hier, wo Ganser erstmals seit Stunden wieder etwas zur Ruhe kommt, machen sich die Schleier der Müdigkeit bemerkbar. So ist das wohl, wenn man zu plötzlich aus Urlaubsträumen gerissen wird. Ärgerlich wischt er sich über die Augen. Will gewohnheitsmäßig in die Gesäßtasche greifen. Dann fällt ihm aber ein, dass er den Kamm ja hin zu den Zigaretten in die Brusttasche verlagert hat. Der eckige Gegenstand, der sich dafür unangenehm hart an seinen Hintern presst, ist zum Kämmen weniger geeignet, eine Sig-Sauer-Polizeipistole, die er sich vom Waffenmeister ausgeliehen hat.
In der stickigen Wärme des überfüllten Raumes fallen Ganser trotz des lärmigen Stimmenwirrwarrs die Augen zu. Polizeischlaf. Das grüne Sandmännchen. Kurz, aber heftig. Elementarer Lehrstoff jeder Grundausbildung. Desgleichen das automatische Erwachen bei veränderter Lage.
Immer noch ist es laut, aber es scheint nicht mehr so chaotisch wie vorhin. Ganser blinzelt dahin, wo das Licht der Scheinwerfer am grellsten ist. Reibt sich die verklebten Augen und schüttelt eine verkrumpelte HB aus der Packung in der Brusttasche. Sollte wirklich damit aufhören, denkt er, als nach dem ersten Qualm die Tränen fließen. Dann entfährt ihm ein lautes »Ach, du liebe Sprotte!«. Vorn am Tisch sitzt der polizeibekannte Staatsanwalt neben dem Pressesprecher und sonnt sich im Glanze seines Scheinwerferglückes. Und an Stüchows grüner Seite sitzt der uniformierte Kommisskopp von vorhin. Der mit der Zentimeterlatte.
Jetzt wird es wieder lauter. Die Fotografen und Kameraleute schieben und schubsen. Aus der ersten Reihe recken sich dem lichtbestrahlten Dreigestirn Mikrofone und Aufnahmegeräte entgegen. Auch Ganser reckt den Hals, um alles genau mitzubekommen.
Aus der provisorischen Lautsprecheranlage knackt und röchelt es. »Ruhe bitte, Kollegen!«
Stüchow wartet noch einen Moment, bis sich der Medienmob eingekriegt hat. »Einiges zum Ablauf dieser Veranstaltung vorweg: Sie werden erstens von mir Informationen über den von den Behörden bisher ermittelten Tathergang erhalten. Diese Informationen aber nur soweit, wie sie als gesichert gelten können und den laufenden Einsatz nicht gefährden. Punkt! Zweitens werde ich einige Angaben zu dem noch laufenden Polizeieinsatz machen und ...«, er bricht kurz ab, um dann noch einzufügen: »... natürlich nur soweit diese Angaben gesichert sind und den Einsatz nicht gefährden. Punkt! Drittens haben Sie die Möglichkeit, anschließend 10 Minuten lang Fragen an den Einsatzleiter vor Ort und den ermittelnden Staatsanwalt zu stellen. Sie haben sicher Verständnis für diese Beschränkung der Fragezeit, da beide Herren an anderer Stelle dringender gebraucht werden. Fragen mit spekulativem Charakter oder Fragen, die den Einsatz beziehungsweise die Einsatzkräfte gefährden, werden nicht beantwortet. Punkt!«
Stetig ist das Gemurmel in den Reihen der Berichterstatter angeschwollen, während der Pressesprecher monoton seine knappe Einführung durchzog. Jetzt öffnen sich die ersten Münder zu einer empörten Erwiderung, als ihnen Stüchow trocken die Worte abschneidet: »Geht alles von der Fragezeit ab. Viertens, alle Informationen über den Verlauf des Einsatzes erhalten Sie hier im Pressezentrum Luisenhof. Und zwar ausschließlich hier! Es steht Ihnen natürlich frei«, hier verziehen sich Stüchows schmale Lippen zur Andeutung eines freudlosen Lächelns, »im weiteren Einsatzgebiet oder unten in der Stadt ihrer Arbeit nachzugehen. Kann Ihnen ja niemand verwehren. Ich möchte Sie aber vorsorglich darauf hinweisen, dass bei Verlassen des Pressezentrums automatisch Ihre Akkreditierung erlischt. Sie werden anschließend keinen Zugang mehr zu den Lageinformationen des Pressezentrums haben. Ausrufungszeichen!«
Ganser zieht den Kopf zwischen die Schultern. Tritt dann vorsichtig den geordneten Rückzug zur bewachten Verbindungstür an. Gleich wird hier die Hölle ausbrechen. Die Hand schon auf der Türklinke, erwartet der Kripo-Mann den Pressesturm.
Irrtum. Stüchow hat die Bande im Griff. Wenigstens die Knochen brauchen sie für den Fressnapf. Wenn es denn schon kein Fleisch sein soll. Ein paar Vereinzelte kläffen was von Zensur und Maulkorb, aber der Rest der Meute klemmt den Schwanz ein.
»Sie haben ohne Zweifel recht. Die Arbeitsbedingungen sind nicht gerade ideal zu nennen«, hört Ganser den Pressesprecher noch eins draufsetzen, »aber den ganz fixen Jungs ... und Mädels unter euch will ich noch sagen, dass der Einsatzfunk über Sonderfrequenzen läuft. Also keine Chance! Ich beginne jetzt mit der Schilderung des Tathergangs. Gegen 14 Uhr 30 ...«
Kriminalhauptmeister Ganser verschwindet aus dem Pressezentrum, um sich unten in der Einsatzzentrale zu melden.
Ein schöner lauer Abend. Fast schon ein Sommerabend.
Benedict hatte sich für seinen ersten Erkundungsgang leichte Popelinehosen und ein kurzärmeliges Jerseyhemd angezogen. War die inzwischen wieder belebte Oxford Road und deren Verlängerung, die Broad Street, entlanggeschlendert, um dann auf dem Rückweg zum Hotel doch noch einen Linksschlenker in die St. Mary‘s Butts zu machen, wo er dann an der Ecke die Auswahl hatte, ob er zurück durch die Castle Street gehen oder doch noch einen Abstecher nach links in die etwas schäbige Gun Street machen wollte. Er entschied sich für links.
Das winzige, aus dem Rahmen fallende Kellerlokal mit den leuchtend grünen Rundmarkisen über Tür und Fenstern und dem ungewöhnlichen Namen Cartoons Wine Bar hatte ihn sofort angezogen. Schließlich hatte dann, nach dem gerade überstandenen Anheuser-Busch-Erlebnis im Hotelzimmer, das grüne Bierschild auf der gelbverputzten Hauswand den Ausschlag gegeben. Heineken.
Benedict mag die Holländer im Allgemeinen nicht besonders. Macht dabei aber zwei Ausnahmen: seinen alten, inzwischen pensionierten Freund von der Amsterdamer Polizei, Commissaris de Rijn, und die Produkte dieser holländischen Brauerei, welche in seiner eigenen Biergüteskala gleich hinter dem tschechischen Originalgebräu auf dem zweiten Platz rangieren.
Jetzt, in der angenehmen Kühle des kleinen Kellerlokals und mit einem erfrischenden Bier vor sich, beginnt er sich langsam besser zu fühlen. Obwohl ... ein bisschen zu alt scheint er schon für das Publikum hier zu sein. Bis auf eine blonde Frau mit strähnigen Haaren sehen alle hier aus wie um die Zwanzig. Ziemlich studentisch. Erinnert ihn an irgendwas. Er schwankt, ob er nicht doch lieber gehen soll. Aber mit Blick auf das halb volle Bierglas entschließt er sich zu bleiben. Sind sowieso nicht so viele Leute hier. Bis auf die bärtigen Jünglinge mit der Blonden in ihrer Mitte an dem großen Nebentisch ist er der einzige Gast in dem schummerigen Kellerraum.
Der junge Typ hinter der Theke, der wohl gleichzeitig auch für die Musik zuständig ist, legt eine neue Platte auf und macht sich wieder an der gleich explodierenden Kaffeemaschine zu schaffen. Aus den Lautsprechern ertönt eine Frauenstimme. Keine schöne Stimme. Schreiend, fast krächzend über die einfachen Gitarrenakkorde weg. Ein Lied von mutwillig von Weißen abgeknallten Büffelherden und verhungernden Indianern. Die Stimme fährt Benedict in die Knochen. An den Wänden hängen irgendwelche Karikaturen und Poster, die zu oder gegen etwas aufrufen. Neben der Eingangstür ein schwarzes Brett mit allerlei Zetteln. Die Jungens am Nebentisch diskutieren heftig mit der blonden Frau über etwas, das er wegen der eindringlichen Stimme aus den Lautsprechern nicht verstehen kann. Die Blonde schreibt, kurzsichtig tief über einen Block gebeugt, etwas auf, während die anderen auf sie einreden. Immer wieder fallen ihr Haarsträhnen ins Gesicht, die sie ärgerlich mit der Hand wieder zur Seite wirft.
Überraschend blickt sie auf einmal hoch und zeigt ihm ihr Gesicht. Weiße Haut, stark herausstehende Knochen und sehr hellblaue Augen. Benedict runzelt erstaunt die Brauen, fühlt sich neuerlich an etwas erinnert, aber da fällt ihr Kopf auch schon wieder über den Block. Nachdenklich blättert er in seinem Kopfbuch. Überfliegt die Jahresseiten. Da, zögernd noch, unterbricht die Frau ihre Schreiberei erneut und sieht verstohlen zu ihm rüber. Als sie seinen Blick auf sich gerichtet fühlt, senkt sie ihren Kopf hastig wieder. An der veränderten Haltung ihrer schmalen Schultern erkennt der Kriminalbeamte aber, dass auch in ihr etwas arbeitet.
Die eindringliche Stimme mit den Indianerliedern ist verstummt. Der Junge am Plattenspieler hält schon eine neue LP in der Hand. Benedict steht auf und fragt ihn, was das eben für eine Platte gewesen sei. Der reicht ihm ein Plattencover über die Theke.
»Indianerin. Aus Kanada«, murmelt er kurz angebunden.
Eine junge Frau mit brauner Haut und lackschwarzen Haaren lächelt unter einem keck aufgesetzten Cowboyhut von der Plattenhülle. Der Schreihals mit der Gitarre. Benedict nimmt sich eins der überall rumliegenden Flugblätter und schreibt auf die freie Rückseite den Titel auf. »The Very Best of Buffy Sainte-Marie.« Dazu noch die Plattenfirma. Muss er sich gleich nach seiner Rückkehr in Düsseldorf besorgen.
Er bestellt sich noch ein zweites Heineken und geht zu seinem Tisch zurück, überlegend, wo er diese Blonde, sie mochte so in seinem Alter sein, bloß hintun sollte. Wie er sich hinsetzt, steht die Frau von drüben entschlossen auf und kommt an seinen Tisch.
»Excuse me, have we met somewhere before? I have a rather strong feeling!«
Jetzt, wo sie mit fragend gerunzelter Stirn vor ihm steht, fällt ihm ein leichter Akzent in ihrem Englisch auf.
»I don‘t know ... I had the same feeling since I saw you here, but ... maybe, if you tell me your name?«, antwortet er leicht befangen.
»Yes, my name is Margot ... Margot Forrester!«
Benedicts Gedächtnis sucht verzweifelt nach einer Forrester-Erinnerung, während auch er sich nun vorstellt: »I am Benedict. Vitus Benedict. I am from Germany. If that helps!«
»Bennieee!!!«
Ihr Urschrei gellt durch den kleinen Raum, die restlichen Besucher aufschreckend. Beunruhigte Gesichter wenden sich zu ihnen herum. Wie ein aufgeregter Vogel hippelt die Blonde vor ihm herum.
»Ein Heidelberger Genosse! Hier in Reading! Ja, Mensch, was machst du denn hier?«
Der Hauptkommissar schluckt. Lahm steht er mit einer verlegenen Höflichkeitsgeste halb von seinem Stuhl auf, um sich sofort wieder fallen zu lassen. Zu tief ist ihm der Schreck in die Knie gefahren. Sein Gesichtsausdruck flattert unentschlossen zwischen Freude und Abwehr. Wärmende Sehnsucht an vergangene Gemeinsamkeiten breitet sich aus in seiner Brust. Die fast erstickende Wohligkeit stößt aber plötzlich an grätige Ränder schmutzigen Eises in seinem Rückgrat. Mit der Flut der Vergangenheit steigt da noch ganz anderes Gerümpel auf. Die widersprüchlichen Empfindungen zwischen fast versengender Wiedersehensfreude und dem ahnungsvollen Erschrecken vor verborgenen Erinnerungen aus dieser Zeit lassen seine Stimme zu sprödem Glas werden.
»Aber ... heißt du nicht ... Reschke?«, stottert es aus ihm heraus. »Ja, Margot Reschke! Irgendwo aus dem Hannoverschen!«
Er versucht einen Gesichtsausdruck hervorzubringen, der Freude beweisen soll, aber er ist sich nicht sicher, ob ihn dieses Wiedersehen wirklich freuen soll.
Die aufgeregte Frau in dem weißen T-Shirt zieht sich einen Stuhl ran und setzt sich zu ihm. Am Nebentisch machen sie neugierige Gesichter.
»Nein, nein. Das mit Thomas ist schon lange vorbei. Er ist nach Hamburg zurückgegangen. Warte mal, das war kurz nachdem wir uns das letzte Mal in London getroffen haben. Da warst du mit‘m Mädel zusammen. So einer feinen Hübschen. Hast irgendwas an der LSE studiert.«
Mein Gott. Hat die ein Gedächtnis.
»Nein, nein. Ich bin dann nach Reading an die Uni gegangen und habe hier meinen jetzigen Mann kennengelernt. Deshalb auch Forrester. Er ist Meteorologe. Arbeitet hier am EZMW.«
»Am was?«, versucht der immer noch Überraschte einzuwerfen.
»Am Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Das ist hier in Shinfield. So ein kleiner Vorort von Reading. Oh dear! Benny! Sag doch endlich mal, was du hier eigentlich machst! Ist das toll, mal einen alten Heidelberger zu treffen, you won‘t believe it! What a surprise!«
Tja, was macht er hier. Er kann ja schlecht ...
»Wir haben hier eine Tagung ... über internationale Zusammenarbeit, weißt du.« Zum Glück ist sie zu aufgeregt, um sein ausweichendes Gestammel zu bemerken.
»Ach so. Und wie lange bleibst du? Wo wohnst du?«
»Äh ... eine Woche. Im Ramada-Hotel.«
»Mensch, du könntest doch bei uns draußen in Shinfield wohnen. Wir haben massig Platz. Und mein Mann hätte bestimmt nichts dagegen.«
»Ja ...«, sagt Benedict nur und hofft, dass sie einfach weiterreden wird.
Ein roter Krollekopf vom Nebentisch kommt jetzt rüber und beugt sich zu Margot runter, um ihr etwas ins Ohr zu tuscheln. Erschrocken sieht sie auf ihre Armbanduhr. Schüttelt dann bedauernd mit dem Kopf und steht hastig auf. Kramt mit verzweifeltem Gesichtsausdruck in ihrer großen Umhängetasche herum. Greift sich schließlich eines der Blätter vom Nebentisch und kritzelt eilig etwas auf die Rückseite.
»Pass auf, Benny! Du musst mich unbedingt anrufen, damit wir was vereinbaren können. Unbedingt! Morgen ist Sonntag, da bin ich zu Hause, und du kannst mich unter dieser Nummer hier erreichen. Ab Montag bin ich dann ab 10 Uhr unter der zweiten Nummer im Beckett-Archiv in der Uni. Da arbeite ich.«
»Der Beckett? Warten auf Godot?«, fragt Benedict erstaunt.
»Ja, ja. Der Beckett. Wir sind hier doch ein Zentrum der Beckett-Forschung. Weißt du das nicht?«
Der Düsseldorfer schüttelt den Kopf. Er kennt auch das Stück nur dem Titel nach.
Ungeduldig zupft der Rothaarige sie am Ärmel ihres T-Shirts. Mit einem letzten »Vergiss den Zettel mit den Nummern nicht!«, stürmt Margot im Kreise ihrer Jünger aus dem Lokal.
Vitus H. Benedict wartet, bis die Kneipengäste sich wieder um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, und bestellt ein frisches Bier. London. Das muss 1971, nein 72 gewesen sein. Er hatte damals die Wartezeit auf Amerika mit einem einjährigen Gaststudium an der London School of Economics, der LSE, überbrückt. War eines der letzten wilden Jahre gewesen. Kitty, die damals noch nicht seine Frau war, hatte die meiste Zeit in der British Library oder in der Tate Gallery verbracht, während er in der linken Szene Londons rumgefallen war. Und dann der große Streik der Postgewerkschaften. Zur großen TUC-Kundgebung hatten alle Unis Solidaritätsabordnungen geschickt. Und er war zusammen mit Kitty und der roten Fahne mit den Greisenköpfen bei den Maoisten mitmarschiert. Bis zum Trafalgar Square, wo sie dann im dichten Kundgebungsgetümmel in Margot und Thomas reingelaufen waren. Das war auch so ein Geschrei gewesen. Ausgerechnet in London auf die alten SDSler aus Heidelberg zu treffen. Damals hatten sie das kurze Wiedersehen in einer kleinen Konditorei gefeiert und sich dann endgültig aus den Augen verloren. Hat er sich so wenig verändert?
Das Lokal wird rasch voller. Eine Gruppe junger Leute an der Theke wirft begehrliche Blicke zu seinem freien Tisch rüber. Benedict steckt den Zettel mit Margots Nummer in die Hosentasche. Trotzdem glaubt er nicht, dass er anrufen wird.
Als er Cartoons Wine Bar in der Gun Street wieder verlässt, ist es draußen schon richtig dunkel. Hastig strebt er dem Schutz des großen Hotels entgegen. Nochmals kehrt die Erinnerung an diesen Tag in London zurück, und er lächelt. Ja. Wie lange vermisste Geschwister waren sie einander um den Hals gefallen. Hatten fast geheult vor Freude. Und hatte die Gruppe in Heidelberg ihm damals nicht wirklich die fehlende Familie bedeutet? Das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Gemeinschaft, sie nannten es Solidarität, war das für ihn nicht die eigentliche Triebkraft seines Handelns gewesen? Sicher. Niemand von ihnen hätte das damals zugeben wollen. Schließlich waren sie ja alle enorm politisch und hüteten sich, in so persönlichen Kategorien wie Geborgenheit oder Vertrauen zu denken. Geschweige denn zu reden. Dennoch war er mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass auch viele andere die politischen Aktivitäten zwar betrieben hatten, aber im Grunde genommen nur auf der Suche nach einem Gefühl gewesen waren. Brüderlichkeit. Liebe zwischen Gleichgesinnten. Väterchen Ho. Bruder Che. Genosse Kral. Und Margot, Burkhardt, Joscha, Monika, Rainer ... es war schon auch eine Art Liebe gewesen. Venceremos! Aber das ist doch wirklich vorbei. Genau wie die im Winde wehenden Banner der Gewerkschaften auf dem Trafalgar Square.
Am Rande der Großkundgebung hatte damals ein kleiner, alter Mann mit einem selbstgemalten Plakat gestanden. Auf dem war zu lesen gewesen: »Fliehet vor dem Zorn, der über Euch kommt.«
Im Krisenstab am Düsseldorfer Jürgensplatz hängen zwei große Karten, an denen die Beteiligten Einsatzalternativen planen.
Der wichtigste Plan, markiert mit einer Unzahl bunter Nadeln und Fähnchen, zeigt die versammelten Polizeikräfte im Einsatzgebiet Metzkausen. Die Außenabsperrungen im Norden an der Hornberger und der Hasseler Straße, im Westen an der vom Peckhauser Weg abzweigenden Florastraße, im Süden am kleinen Kirchendeller Weg und der Nordstraße sowie die Hundertschaft, die das Einsatzgebiet nach Osten hin auf den freien Feldern absichert. Hier war es schon bei der ersten Dunkelheit einem Spezialtrupp mit Bahren gelungen, die zwei verletzten Insassen aus den zerschossenen Fahrzeugen in der Kurve der Hasseler Straße zu bergen. Der Fahrer eines weiteren Fahrzeuges war verschwunden. Die Einsatzleitung im Luisenhof nahm an, dass er bei anbrechender Dunkelheit von selbst über die Felder geflohen war. Dann die rote Fahne, die Einsatzleitung im Hotel Luisenhof und den Kommandobus bezeichnend. Die Positionen der Sondereinsatzkommandos. Im Wäldchen unterhalb der Scheune, wo nach einem Scharmützel schon ein Ausfall gemeldet worden war. Zum Glück keine schwere Verletzung. Auf dem Dach eines der angrenzenden Terrassenhäuser und auf dem Gelände eines Tennisclubs auf der anderen Seite der Hasseler Straße, die direkt an der Scheune vorbeiführt. Eine vergrößerte Luftaufnahme, von einem der Hubschrauber aus am Nachmittag aufgenommen, zeigt das Einsatzobjekt von oben. Auf der rechten Seite die Scheune, die mit der Schmalseite zur Hasseler Straße hinzeigt. Sie bildet mit einem etwa zwanzig Meter weiter, parallel stehenden Wohnhaus und einem anderen Wohngebäude ein zur Hasseler Straße hin offenes U. Zwischen der Scheune und dem Haus, welches den unteren Bogen dieses U bildet, führt eine kleine Asphaltstraße auf den Innenhof. Von hier aus sind auch die beiden Wohnhäuser zugänglich.
Im Zuge der Evakuierung durch die der Scheune abgewandten Fensterfronten dieser beiden Häuser hatte die Metzkausener Einsatzleitung zwei Sonderkommandos eingeschleust. Die waren aber praktisch blind, da der Mann in der Scheune in unregelmäßigen Abständen Streusalven rüberfeuerte und ihre Anwesenheit unbedingt bis zu einem eventuellen Überraschungszugriff verborgen bleiben musste.
Ein zweiter Plan zeigt die weitere Umgebung der Kreisstadt mit den möglichen Fluchtwegen. Vorsorglich hat der Leitende in den vergangenen Stunden an abgestimmten Punkten zivile Einsatzfahrzeuge positioniert, die unauffällig die Verfolgung aufnehmen sollen. Drei schwere Kraftfahrzeuge der Marken Audi, BMW und Mercedes stehen auf dem Hof der Kreispolizeibehörde bereit, falls der Täter ein Fluchtfahrzeug für sich und die Geisel anfordern sollte. Alle Fahrzeuge sind vollgetankt und mit einem Zündunterbrecher präpariert, der die Wagen ferngesteuert zum Stehen bringen kann. Es ist geklärt, wer sich im Ernstfall als Austauschgeisel zur Verfügung stellt und wie er sich zu verhalten hat.
Das Dumme ist nur, dass der in der Scheune mit einer Geisel verschanzte Killer bis jetzt keinen Fluchtwagen angefordert hat. Er hat überhaupt nichts verlangt.
Um es genau zu sagen, es ist der Verhandlungsgruppe bis jetzt, 20 Uhr 30, nicht gelungen, mit dem Mann in der Scheune überhaupt in Kontakt zu treten. Wie sollte sie auch, wenn jede diesbezügliche Aktivität sofort mit heftigem Gewehrfeuer beantwortet wird und in dem Objekt auch keine Fernsprechanlage ist. Auch der Mann drinnen hatte von sich aus keine Anstrengungen unternommen, mit irgendwelchen Forderungen an die Öffentlichkeit zu treten.
Seit ungefähr 18 Uhr war man wenigstens einen Schritt weitergekommen. Beamte der Sonderkommission hatten die evakuierten Bewohner der neben der Scheune stehenden zwei Häuser befragt. Ihre Ermittlungen hatten ergeben, dass es sich bei dem mordenden Geiselnehmer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den 31-jährigen jugoslawischen Staatsbürger Goran Josevanovics handelt, der auch eine Zweizimmerwohnung in dem angrenzenden Haus bewohnt. Die anfänglichen Vermutungen der Evakuierten, die Josevanovics gleich als hauptsächlichen Nutzer der Scheune bezeichnet hatten, fanden ihre Bestätigung. Der Computer spuckte Josevanovics als Halter eines Geländewagens vom Typ Landrover aus, dem Fahrzeug, aus welchem nach anderen Zeugenaussagen die tödlichen Schüsse in der Fußgängerzone der Kreisstadt abgegeben worden waren. Schüsse, denen bis zu diesem Zeitpunkt schon neun Menschen zum Opfer gefallen waren.
Die Psychologen der Beratungsgruppe bemühten sich, aus den Angaben der Mitbewohner des Jugoslawen ein Bild des Mannes in der Scheune zu gewinnen. Nur wenn es ihnen gelänge, die möglichen Aktivitäten und Reaktionen des Gewalttäters für die nächsten Stunden abzuschätzen, hätte die Polizei eine Möglichkeit, weitere Opfer zu verhindern und den Täter in Gewahrsam zu nehmen. Die Angaben der Mitmieter sind dürr. Ein mürrischer Einzelgänger, der seit drei Jahren im Parterre des Mietshauses neben der Scheune wohnte. Noch verschlossener, seit seine deutsche Frau mit ihrem Baby vor zwei Monaten ausgezogen war. An den Vormittagen trieb sich Josevanovics mit seinen beiden scharf abgerichteten Schäferhunden auf den Feldern der Umgebung rum, und danach zog er sich in die alte Scheune zurück, wo er Autos reparierte oder an irgendwelchen Geräten rumbastelte. An zwei Abenden war er regelmäßig zum Bodybuilding gegangen, und manchmal holte er sich einen Kasten Bier. Dann hörten die Nachbarn laute Musik und heftigen Tumult aus seiner Wohnung, hatten aber aus Angst vor den Hunden nicht gewagt, sich bei ihm zu beschweren. Die Kreispolizei unterrichtete den Krisenstab darüber, dass mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Josevanovics anhängig waren. Körperverletzung, Beleidigung und mehrere Verkehrssachen. Wahrscheinlich wäre er über kurz oder lang sowieso nach Jugoslawien abgeschoben worden.
Dr. Walther, Leiter der Beratungsgruppe, macht aus seiner Besorgnis keinen Hehl. »Also, vor dem Hintergrund dieser Persönlichkeitsstruktur und der heute Nachmittag bereits nachhaltig bewiesenen Vernichtungsenergie habe ich starke Zweifel daran, dass wir an den Mann mit unseren Mitteln noch rankommen. Wenn auch nur irgendwo ein Funken Kommunikationsbereitschaft bei ihm da wäre, dann hätte sie sich schon äußern müssen. Da er jede Kontaktaufnahme zu sich verhindert, müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass er über keinerlei verbales Konfliktlösungspotential mehr verfügt. Warum auch immer!«
Der Leitende reagiert ungewohnt aggressiv.
»Und was soll das für uns heißen?«
»Na ja«, windet sich der Psychologe, »ich fürchte ...«
»Lassen Sie mal«, winkt der Leitende ab und starrt wieder in sich zusammengesunken auf die beiden großen Karten an der Wand. Es ist ihm auch so schon klargeworden, dass ihm keine andere Möglichkeit bleiben würde. Wenn da bloß nicht dieses Mädchen noch in der Scheune wäre. Und wenn er doch nur wüsste, wie es jetzt auf dem Innenhof vor dem Objekt aussieht. Dem ist zuzutrauen, dass er alles Mögliche für sie vorbereitet hat. Nach den Angaben der Mitbewohner soll er ein großer Waffennarr sein. Allein die Munition, die der bisher schon verballert hat. Vielleicht gelingt es uns ja noch, die Frau und sein Kind aufzutreiben. Aber lange konnten sie das nicht mehr rauszögern. Irgendwann müsste er seine Entscheidung treffen.
Nach einem erneuten Blick auf die Wanduhr ordnet der Einsatzleiter an: »Veranlassen Sie, dass ein Hubschrauber mit einer Nachtsichtkamera über das Objekt fliegt. Ich will wissen, wie‘s da jetzt aussieht! Ach ja«, fügt er mit leicht resigniertem Unterton noch an, »versuchen Sie ein Megafon in den Hof runterzulassen.«
Der Psychologe öffnet den Mund, aber der Leitende stoppt ihn brüsk mit einer kurzen Handbewegung. Dann versinkt er wieder in brütender Starre.
Gegen neun Uhr hatte ihn der Hunger doch noch runter in das Hotelrestaurant getrieben. Er hatte erst überlegt, ob er vielleicht auswärts bei einem Chinesen essen sollte, aber sich dann doch fürs Hierbleiben entschieden. Eine Überraschung reichte ihm für heute.
Das Restaurant ist ein abgetrennter Teil der großen Hotelhalle und nennt sich Caversham Corner. Was Caversham heißt, weiß Benedict nicht, aber Corner steht für Ecke, und da zieht es gewöhnlich. So weiß er wenigstens, warum das Hotelrestaurant diesen Namen hat. Natürlich haben sie ihm in der kaum besuchten Speiseecke so einen dieser kleinen Single-Katzentische irgendwo im Bedienungsniemandsland zugewiesen. Die dauernd dudelnde Hotelmusik spielt Händel oder Vivaldi oder James Last. Oder alles zusammen. Blaugoldene Paravents, auf denen sich goldig moderne Chinoiserien tummeln, trennen das Restaurantgeschehen von Empfangshalle und der Hotelbar Pavilion. Die Tagessuppe heißt mit Namen Champignoncreme. Schon der Gedanke an eine schleimige Pilzgeschmacklosigkeit lässt ihn schaudern. Aber vielleicht ist es auch nur die Zugluft. Auch der Rest der Karte ist nicht so richtig nach seinem Geschmack, IAK: International-Amerikanische Küche. So bestellt er aus verzweifelter Unlust Spare ribs und ein T-Bone mit Pommes und weiß doch schon während der Bestellung, dass er den Schutt nicht mögen wird. Er hätte doch zum Chinesen gehen sollen.
Als die Chefkellnerin das zweite Gedeck von seinem Tisch räumt, ist er alleine mit sich und den obligatorischen Tischnelken in Hotelvase, einem Pärchen weißer Gewürzstreuer, drei blassen Butterkügelchen auf Salatblatt und zwei kleinen Brötchen. Und noch immer Händel oder Vivaldi oder James Last. Hinter seinem Rücken strecken glänzende Hydropflanzen ihre grünen Fettblätter nach ihm aus. Über die Trennwand hinweg tönt immer mal wieder das helle Schnarren der Telefone vom Empfangsschalter. Gläser klirren an der gleichfalls unsichtbaren Bar. Händel oder Vivaldi oder James Last heißen jetzt Jean oder Gilbert oder Edith und schwelgen mittlerweile pseudofranzösisch in Akkordeongeigen. Oui, je regrette.
Wenigstens kommt kein Chlorgeruch vom Swimmingpool rüber. Die »spare rib«-Soße, laut Speisekarte ein Geheimrezept, entpuppt sich als süßlicher Sud aus Chilisoße, Misofond und Mango Chutney. Wahrscheinlich noch angereichert mit einem kräftigen Schuss der überall rumstehenden HP-Brown Sauce. Während das braune Soßengemisch von Benedicts Händen auf den Teller zurücktrieft, spielen Querflöten zu gestelzten Menuetten auf. An der Bar hinter den Paravents fallen klappernd irgendwelche Flaschen um. Kunstbanause, knurrt der einsame Gast mit den versoßten Fingern, während er verbissen an der amerikanischen Fleischrippe herumknabbert. Der Barkeeper hinter dem Raumteiler stößt einen lauten Fluch aus. Die Querflöten trillern in immer höheren Kadenzen, und das Pforzheimer Besteck beginnt vibrierend auf dem Tisch mitzuschunkeln.
Die Computerkasse am Restauranteingang rechnet rasselnd elektronische Endbeträge. Merkwürdiges Geräusch. Früher vermittelten Kassen selbst durch ihre Addiergeräusche noch ein Gefühl richtigen Wertes. Ihr klingelndes oder metallisch klirrendes Arbeitsgeräusch zeigte dem Zahler ernst die Schwere seines Verlustes in der Geldbörse an. Dadurch aber auch auf die Bedeutung des erhaltenen Gegenwertes hinweisend. Heute aber scheppern diese neumodischen Computerkassen flach und eintönig, ohne Höhen und Tiefen, ihre Anzeigen heraus.
Was die hier wohl unter »medium« verstehen! So ein Steak würde man ihm in Düsseldorf nicht ungestraft vorsetzen. Während er immer missmutiger an dem zähen Leder-T rumsäbelt, kommt es plötzlich über ihn. Ganz unvermittelt. In diesem fast leeren Restaurant des Ramada-Hotels in Reading. Ein heimtückischer Überfall. Und als er mit dem letzten Schluck des schalen Bieres den Geschmack zu fetter Pommes frites herunterspült, findet er sich im Zustand des Heimwehs. Nach seiner vertrauten Wohnung im schönen Oberkassel. Mit Blick auf den Rhein und den Schlossturm auf der anderen Seite. Nach einem frischen Budweiser mit richtiger Schaumkrone und einer leckeren, von seiner alten Haushälterin Lore zubereiteten Mahlzeit.
»Excuse me, are you Mr. Benedict from Düsseldorf?«
Aus seinen Gedanken aufgeschreckt, entfällt das Essbesteck den Händen des überraschend Angesprochenen. Während der Düsseldorfer noch das laute Klappern des Metalls wie einen Gong in seinen Ohren klingen hört, steigt ihm ein Geruch in die Nase. So vertraut. So weit zurück. Und immer noch der Schmerz ...
Nachdem die Gruppe HEINER einen Mann durch den Schießwütigen in der Scheune verloren hatte, meldet sich Ganser freiwillig bei der Einsatzleitung als Ersatz für den abtransportierten Verwundeten.
»Hmm. Ich weiß nicht recht, ob das im Rahmen der Einsatzbestimmungen ist«, murmelt der stellvertretende Einsatzleiter, dessen Chef noch immer bei der Pressekonferenz sitzt. »Klären Sie das besser mit der SEK-Führung im Kommandobus draußen.«
Wieder steht er dem hartgesichtigen Barettmann gegenüber. Die bläulichen Neonlampen im Inneren des Busses verleihen der Situation etwas von Bunkeratmosphäre.
»Na ja. Immerhin waren Sie schon mal unten und kennen sich aus.« Seine knochigen Finger trommeln einen Wirbel auf dem Kartentisch. »Aber so können Sie auf keinen Fall zur Einsatzgruppe gehen. Tarnen Sie erst mal Ihr Gesicht ab, Kollege. Und besorgen Sie sich eine Drillichjacke! Haben Sie überhaupt eine Waffe?«
Der Kriminalhauptmeister zieht die Pistole aus der Gesäßtasche.
»Was wollen Sie denn damit?«
»Das ist eine ganz normale Sig-Sauer!«
»Is‘ was zum Cowboyspielen!«, knurrt der Kantige verächtlich und verschwindet einfach durch die Tür nach draußen.
Unbehaglich bleibt Ganser stehen. Na, das war‘s wohl gewesen. Vielleicht konnte er sich ja irgendwo anders nützlich machen. Oder ... Die Bustür klappt wieder auf, und der SEK-Führer schmeißt ihm eine Heckler&Koch-Maschinenpistole an die Brust. »Können Sie damit umgehen?«
»Ich habe ganz gute Ergebnisse«, untertreibt der Kripo-Mann und versucht seine Freude hinter einem gleichmütigen Gesicht zu verbergen.
»Also gut. Hier ist Ihr Funk und ... wie heißt du eigentlich mit Vornamen?«
»Gernot.«
»Mm? Na egal. Ich melde dich dann über Funk bei HEINER an. Und ... Gernot, mach keinen Scheiß da unten!«
Dann liegt er wieder fast an der gleichen Stelle auf dem Waldboden und starrt an dem noch immer glühenden Buswrack vorbei auf die Scheune. Anfänglich kommt ihm die Stille fast unheimlich vor. Nach einer Weile merkt er aber, dass die sternenhelle Nacht doch voller Geräusche ist. Das Knistern verglühenden Metalls vom Bus da vorne, Hundegebell und Hühnergackern aus einem Garten neben der Scheune, auf- und abschwellende Polizeisirenen aus Richtung der Kreisstadt, spitze Pfiffe erschrockener Feldmäuse und das Aufheulen ferner Motoren. Nur da oben auf dem Hügel, wo die Umrisse der Scheune in den Nachthimmel ragen, ist es still. Während der flüsternden Einweisung durch den Gruppenführer HEINER hatte Ganser erfahren, dass der Mann in der Scheune in unregelmäßigen Abständen weitere Gewehrsalven in sämtliche Himmelsrichtungen abfeuerte. Diese Aktionen waren unberechenbar und zeigten, dass der Täter auf der Hut vor überraschenden Annäherungen war. Aber jetzt ist es still da oben. Ob das Mädel überhaupt noch lebte?
Ganser schreckt auf, als die leise Stimme im Funk ertönt. Hatte er etwa geschlafen? Seine Armbanduhr zeigt auf sieben vor zehn. Gott sei Dank.
»Meldung von DÜSSEL für alle Einsatzkräfte Scheune! Gegen zehn Uhr Anflug eines Hubschraubers auf Objekt aus nördlicher Richtung. Maschine wird das Objekt in niedriger Höhe überfliegen. In keinem Fall Feuerbefehl! Jetzige Positionen dürfen nicht gefährdet werden! Wiederhole ...«
Kaum ist die Stimme abgebrochen, meldet sich auch schon der Gruppenführer. »Für HEINER 1-12! Wir werden die Ablenkung durch den Hubschrauber zu einem Positionswechsel nutzen. HEINER 3, 5 und 7 arbeiten sich auf Kommando Gruppenführer bis auf Höhe Reisebus vor. HEINER 2, 4 und 6 schließen während der Aktion drei Meter nach rechts auf. Bestätigung und dann Funkstille!«
»HEINER 2 verstanden!«, bestätigt Ganser den erhaltenen Auftrag und presst sich noch fester auf den Boden. Während er gespannt auf das erste Geräusch des anfliegenden Hubschraubers wartet, fragt er sich, ob dieses Manöver wohl die Billigung der Einsatzleitung hatte. Natürlich ist es eine gute Gelegenheit, ein paar Leute des Kommandos näher an die Scheune heranzuführen. Bei einem Zugriff haben sie so eine bessere Ausgangsbasis. Andererseits ... wenn der Höllenhund da oben das spitzkriegt, müssten wir den Kameraden Feuerschutz geben. Dann ist die ganze Position des SEK verbrannt. Sicher ist sich der Gruppenführer dieses Risikos bewusst und ... ein leises Brummen kündigt den anfliegenden Hubschrauber an. Jetzt klingt das Dröhnen schon ganz schön nahe. Muss aus Richtung Heiligenhaus kommen. Gansers Hände spannen sich fester um das kühle Metall der Maschinenpistole.
Es ist so weit. Der Lärm des schweren Triebwerks bricht sich donnernd in den Wänden der umstehenden Häuser. Ganser sucht noch am dunklen Himmel nach den blinkenden Positionslampen, als das Fluggerät schon zum ersten Mal den Hügel umrundet. Fast auf Höhe der Baumwipfel fliegend, drücken die lärmenden Rotorblätter einen Schwall wirbelnder Luft und abgefegter Äste nach unten. Vor Schreck presst der am Boden Liegende sich noch tiefer in den weichen Boden.
»Achtung, Buskommando!«, kommt die Vorwarnung des Gruppenführers kaum verständlich aus dem Funk. Der Hubschrauber steht jetzt fast senkrecht dröhnend über der Scheune. Ein heller Scheinwerferstrahl flammt plötzlich am Cockpit auf und taucht die Scheune in grelles Licht. Gleichzeitig hallt eine Lautsprecherstimme herunter. »Achtung! Hier spricht die Polizei! Wir lassen Ihnen ein Megafon ...« Gelbe Perlen steigen vom Dach der Scheune fast senkrecht in die Höhe. »Buskommando los!«, knattert die Stimme in Gansers Funkgerät. Drei dunkle Gestalten hetzen tief geduckt in den Schutz des kohlenden Buswracks. Lassen sich dort blitzschnell fallen. Wieder ziehen Leuchtspurgeschosse senkrechte Furchen in den Nachthimmel über dem Hügel. Enden dort, wo der blendende Scheinwerferstrahl des Hubschraubers seinen Ausgangspunkt hatte. Eben noch regelmäßig dröhnend, wechselt der Ton des Triebwerks zu einem stotternden Klappern, unterbrochen von knallenden Aussetzern. Jetzt hört Ganser auch das Stakkato der Gewehrsalven von der Scheune her. Die Maschine dreht sich schwerfällig um die eigene Achse. Richtet stöhnend die Nase nach oben. Das Rotorgeräusch setzt vollends aus. Sie kippt taumelnd langsam nach rechts. Schmiert am hohen Schornstein des Schulheizwerks vorbei auf die Felder hinter der Hasseler Straße ab. Orgelnd kreischt gequältes Metall. Der Todesschrei eines verwundeten Tieres. Ein dumpfer Knall. Ganser liegt wie betäubt.
Es ist wieder still auf dem Hügel.
An der ungemütlichen Hotelbar hatte es ihn nur so lange gehalten, wie er brauchte, um sich einen doppelten Whiskey zu besorgen. Zwar hatten sie seine Hausmarke, den Jameson-Whiskey auch hier unten nicht, aber mit dem nordirischen Black Bush konnte er sich auch ganz zufrieden in die bequeme Lounge neben der Eingangstür zurückziehen. Im Grunde genommen hätte er auch mit jedem anderen Getränk vorlieb genommen. Das war alles so egal. Jetzt.
»Haas‘! Haas‘?«, hatte er gestottert.
Erstmals hatte er diesen Namen wieder laut ausgesprochen. Ein innerliches Tabu durchbrochen. Kittys Kosename, den er ihr wegen ihrer leicht vorstehenden Vorderzähne gegeben hatte. Haas‘ und Maus. Sie der Haas‘, er die Maus. Seit ihrer Abreise zu dieser unglückseligen Bergtour in die Alpen war ihm der Name nicht mehr über die Lippen gekommen. War es vielleicht nicht doch nur ihr Parfüm gewesen? Je reviens. Die herbe Süße der Vergangenheit?
Warm breitet sich der Alkohol in seiner Brust aus. Er zündet sich eine Partagas an. Die blauen Wolken steigen auf und zerfasern träge an den Rändern. Von seinem Platz aus kann er den Empfangsschalter mit den zwei Wanduhren im Auge behalten. Kann beobachten, wie sie ab und zu aus den dahinter liegenden Büroräumen nach vorn an den Schalter kommt. Ist sie nicht sehr häufig vorn? Hat sie wirklich so viel da zu tun, oder ist das Blatt Papier in ihrer Hand nur ein Vorwand? Lächelt sie nicht zu ihm rüber? Das gleiche Zurückziehen der kleinen Oberlippe wie bei Kitty. Die gleichen leicht vorstehenden Zähne.
Als sie wieder nach hinten verschwindet, holt er sich ein neues Glas von der Bar.
»Ist Ihnen nicht gut, Mr. Benedict?«, hatte sie auf deutsch gefragt und ihn aus erschrockenen Augen angesehen. Blaue Augen, die mit einem leichten Perlmuttschimmer überzogen schienen. So wie bei Kitty. Ihm war schlecht, sein Hals trocken, die Knie weich, das Herz dröhnte in seinen Ohren. Aber er hätte vor Glück aufjubeln können. Kitty war nicht tot! Da stand sie ja vor ihm! In einer roten Jacke über einem schwarzen Rock. Ein kleines Namensschild am Revers.
»Nein, nein, nein!«, hatte er rumgestammelt und dann völlig blödsinnig »Sie sprechen deutsch?« gefragt.
Natürlich war sie nicht Kitty. Kitty von Salm müsste ja heute 43 Jahre alt sein. Und dieses Mädchen war höchstens fünfundzwanzig. Er könnte ja ihr Vater sein. Es war nur der erste Schock einer verblüffenden Ähnlichkeit gewesen. Eine Ähnlichkeit, wie er sie nicht für möglich gehalten hätte. Und auf dem Namensschild an ihrer Brust stand Sonja Stein geschrieben. Sie stellte sich als Conference & Banqueting Manager des Ramada-Hotels vor. Zuständig für die Betreuung der Teilnehmer der Interpol-Konferenz. Hatte erst für Montag mit dem Eintreffen der Konferenzteilnehmer gerechnet und war nur durch Zufall von seiner verfrühten Ankunft informiert worden. Und deutsch sprach sie, weil ihre Eltern Österreicher sind.
Nachdem beide ihren anfänglichen Schock überwunden hatten, erzählte sie ihm auch noch von ihrer wunderschönen Zeit in Düsseldorf, wo sie zwei Jahre im Ramada-Renaissance-Hotel gearbeitet hatte. Als sie aufgestanden war, um noch ihre Abschlussarbeiten zu erledigen, hatte Benedict so etwas wie Bedauern in ihrem Gesicht gelesen. Er ärgert sich, dass er sie nicht gefragt hatte.
Leise knistert unter ihm das Geflecht des Korbsessels. Rattanmöbel, wohin das Auge reicht. Vielleicht haben die mal irgendwo eine ganze Rattan-Plantage gekauft. Oder wird das Zeugs auf Rattan-Farmen gezüchtet? Kleine, possierliche Rattänchen, die, wenn diese Hotelkette so weitermacht, bald auf der Liste der aussterbenden Arten stehen werden?
Auf einem blauen Zweiersofa schmust ein junges Pärchen. Sehr. Der Kellner an der Kaffeemaschine beginnt mit sorgenvollen Blicken um sich zu werfen. Auch der Kronleuchter an der Decke der Empfangshalle scheint mit seinen zur Decke gebogenen Leuchtarmen lüstern zu beben.
Er könnte wirklich ihr Vater sein. Aber in ihren Augen war so was gewesen. Warum hatte er sie nicht gefragt, ob sie sonntags frei hätte? Auf unsicheren Beinen, die verdammte Überallmusik klarinettiert sich gerade durch diverse Lloyd-Webber-Kompositionen, marschiert Benedict nochmals hinüber zur Pavilion Bar und lässt sich einen weiteren Black Bush abfüllen.
Was der Ganser wohl dazu sagen würde?
Wieder geht die Tür hinter dem Empfangsschalter auf. Wieder dieser freudige Schreck, lang Ersehntes zu sehen. Der gleiche Schwung der weiblichen Hüften. Der verschmitzt offene Blick mit den Antworten auf nicht gestellte Fragen.
Die Farben des Empfangsschalters haben Ähnlichkeit mit dem Beigerot der Doppeldeckerbusse von Reading Transport. Sie verschwimmen vor seinen Augen mit dem leuchtendroten Bolerojäckchen von Kitty ... nein, Sonja ... oder doch Kitty?
Er wird sie fragen.
Jetzt.
»3 Uhr!«
Die zwei Worte, leise gesprochen von einem graugesichtigen Einsatzleiter im Raum des Krisenstabes am Düsseldorfer Jürgensplatz, führen zu einem kurzen Moment der Ruhe. Kleine Sekunden, in denen jeder der übernächtigten Anwesenden daran denkt, was war und was die Konsequenzen dieser zwei Worte sein werden. Gleich werden die letzten Vorbereitungen für den bevorstehenden Zugriff anlaufen.
Alle in der Einsatzleitung hatten das katastrophale Ende des letzten Versuchs einer Kontaktaufnahme zu Josevanovics an den Lautsprechern mitverfolgen können. Das Operationszentrum der Hubschrauberstaffel Rheinland am Flughafen hatte den Funkverkehr mit Hummel 3 auch über die Funkverbindung zum Präsidium geschaltet. Immer verbissener waren die Mienen der zur Untätigkeit verdammten Zuhörer geworden. Schließlich schienen die von wächserner Blässe überzogenen Gesichter zu bleichen Totenmasken erstarrt. Der eine oder andere vorwurfsvolle Blick war gar zum Leitenden rübergewandert, dessen Handknöchel fast die Haut darüber zu sprengen drohten. Den meisten Beamten des Krisenstabes war aber auch die Erleichterung anzusehen, dass sie für diese Entscheidung nicht die Verantwortung zu tragen hatten.
Der Abschuss des Hubschraubers und die zwei schwerverletzten Polizisten, die von rasch herbeigeeilten Kräften der Bereitschaftspolizei aus den Trümmern der zerstörten Maschine gerettet wurden, hatten zu der einhelligen Meinung geführt, dass nun nicht mehr gewartet werden konnte. Jede weitere Verzögerung könnte neue Opfer kosten. Kühl und nüchtern wurde schlussendlich auch konstatiert, dass die weibliche Geisel in der Scheune schon lange getötet worden sein konnte.
»3 Uhr!«
Nun, da der Termin des Zugriffs festliegt, wird die Zwischenphase mutloser Lethargie von einer hektischen Betriebsamkeit abgelöst. Auf allen verfügbaren Leitungen werden die Einsatzbefehle rausgejagt. »DÜSSEL für BODO! Ordnen Sie Einsatzbereitschaft ROT an! Dirigieren Sie die Krankenwagen in die entsprechenden Bereitstellungsräume! Wiederhole ...«
»DÜSSEL für LUISE! Einsatzplan ROT! Alarmhundertschaft ANTON auf Position 3 vorziehen! BERTA 500 Meter vorrücken ...«
»DÜSSEL für Hummel! Führen Sie zwei weitere Maschinen bis auf 5 Kilometer im Luftraum heran! Weitere Anweisungen folgen 2.55! Wiederhole.«
»DÜSSEL für MARTHA! Bitte um Koordinierungsmaßnahmen ...«
Als alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, zeigt die große Wanduhr in der Einsatzleitung des Präsidiums auf 2 Uhr 45. Gespannte Ruhe herrscht in dem gerade noch vor Betriebsamkeit vibrierenden Raum. Nur ab und zu unterbrochen durch leise gegebene Anweisungen.
Der Leitende starrt aus entzündeten Augen auf den sich langsam vorwärts bewegenden Uhrzeiger. Wünscht im Stillen, dass er da draußen bei seinen Jungs wäre. Hier bleibt ihm nichts mehr zu tun als warten. Und hoffen, dass alles gutgeht.
Es ist Punkt 2 Uhr 45, als Kriminalhauptmeister Ganser im Wäldchen unterhalb der Scheune von der Stimme des Gruppenführers aus dem Funkgerät aufgeschreckt wird.
»Gruppe HEINER fertigmachen! Tief kriechend auf Position RB Vorarbeiten! Ich will nicht mal einen Mäusefurz von euch hören! Gruppe HEINER, los!«
Wenigstens Witze kann der noch machen, denkt Ganser, während er schweißüberströmt die unendlich scheinenden dreißig Meter zum Bus robbt. Aber endlich geht‘s los. Diese Warterei war ja nicht mehr zum Aushalten. Wäre ein paarmal fast eingepennt.
Am Bus ist er wenigstens nicht der Letzte. Sie gruppieren sich im Halbkreis um den Kommandoführer, der halblaut die letzten Anweisungen gibt.
»Uhrenvergleich! Es ist genau 2 Uhr 52 Minuten. Jetzt! Einsatzbeginn Gruppe HEINER 3 Uhr! Signal für Angriff auf Objekt: Blendgranaten! Angriff auf die vereinbarten Ziele. HEINER 1 und 2 zu mir! Rest der Gruppe Stellung beziehen!«
Ganser bewegt sich zum Gruppenführer.
»HEINER 2!«, meldet er sich flüsternd bei ihm.
»HEINER 1!«, sagt leise eine andere Stimme.
»HEINER 1. Du bildest zusammen mit HEINER 2 ein Team. Gib ihm eine kurze Einweisung, schnell!«
Ganser klappert in der feuchten Morgenkühle mit den Zähnen und versteht kaum etwas von dem, was ihm der andere ins Ohr flüstert. Nur so viel, dass er sich während der Aktion bei ihm halten solle.
»Muffe?«, fragt ihn sein Teamgefährte noch teilnahmsvoll, da kommt auch schon das Kommando: »Achtung!«
Plötzlich wird es taghell. Ein ohrenbetäubender Knall. Noch einer und noch einer. Der Boden scheint unter Gansers Füßen wegzukippen. Laute Kommandorufe. Gellende Schreie. Jemand reißt ihn hoch und vorwärts. Taumelnd hastet er über harten Asphalt. Fühlt dann ansteigenden Wiesengrund unter seinen Füßen. In der Luft lautes Motorengeräusch. Sirenen. Dann wieder ein Knall. Ein anderer. Eine gewaltige Explosion. Rotgelbe Blitze vor seinen Augen. Etwas wirft ihn zu Boden. Er fühlt einen heißen Windstoß über sich hinwegfegen. Ein scharfer Schmerz. Wieder dieses Scheißknie, denkt er noch, als etwas Schweres auf seinen Kopf niederprasselt. Dann ist nichts mehr.
Gegen sechs Uhr morgens steigt Gernot Ganser auf seine immer noch am Zaun stehende Maschine in der Florastraße. Er trägt einen weißen Kopfverband. Am Knie ist nichts zu sehen, hatte ihm der Notarzt gesagt, aber wegen der Gehirnerschütterung solle er sich ein paar Tage krank schreiben lassen. »Müssen ein ganz schönes Ding verpasst bekommen haben. Na, ist ja auch genug runtergekommen!«
Wie es schien, war die Scheune das reinste Sprengstoffarsenal gewesen, oder der hatte eh vorgehabt, die ganze Chose beim ersten Anzeichen eines Polizeiangriffs in die Luft zu jagen. Jedenfalls hatte der Schock durch die Blendgranaten nicht genügt, ihn davon abzuhalten. Ein Wunder, dass von den anstürmenden SEK-Leuten niemand durch die Explosion getötet worden war. Der hätte nur etwas länger warten müssen. Die ganze Bruchbude war mit ihm zum Teufel gegangen. Und die Geisel auch. Dumme Geschichte.
Als Ganser vor Angelas Haus von der Maschine steigt, scheint die Morgensonne von einem klaren Himmel. Die Vögel singen für Frühaufsteher. Er fröstelt in seinem kurzärmeligen Sommerhemd. Steif stakt er die Stufen hoch und steckt den Schlüssel ins Türschloss. Die Tür schnappt auf. Ihm fällt ein, dass er das Eis für Stephanie vergessen hat.