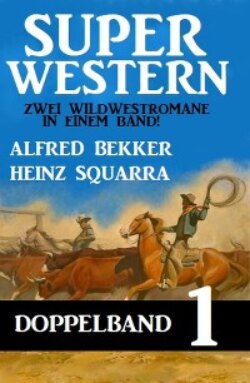Читать книгу Super Western Doppelband 1 - Zwei Wildwestromane in einem Band - Alfred Bekker, Frank Rehfeld, Karl Plepelits - Страница 9
2
ОглавлениеEs war längst dunkel, als die Wagen zusammenfuhren, die Ochsen ausgeschirrt wurden und das übrige Vieh in die Wagenburg hineingetrieben wurde.
Ted Catto war zurückgeblieben. Er spähte nach Osten. Aber die Indianer, deren Angriff er fürchtete, ließen sich nicht sehen.
Das Schnauben eines Pferdes ließ ihn zusammenfahren und über die Schulter blicken. Undeutlich erkannte er einen Schatten in der Dunkelheit vor den Wagen, zwischen denen Lichtschein aufflackerte.
„Wer ist da?“, rief Ted, während er das Gewehr mit einer schlenkernden Handbewegung repetierte.
„Ich, Stone!“
Ted ließ das Gewehr sinken.
Der Reiter kam näher. „Glauben Sie, die können auch von den Wagen kommen?“, fragte der Aussiedler.
„Indianer können nachts von überall kommen“, gab Ted zurück. „Aber sie machen in der Regel keine Geräusche.“ Stones Hunde tauchten aus dem Dunkel auf und strichen um die Pferde, um sich dann ins Gras zu legen und ihre Pfoten zu lecken.
„Die Indianer sehen wir nicht mehr“, sagte Stone. „Denen hat gereicht, was sie bekommen haben.“
„Es waren ja auch nicht viele“, sagte Ted.
„Haben Sie schon mal mehr auf einem Haufen gesehen?“
„Ja. In Texas haben sie mal eine Stadt angegriffen, in der ich gerade war. Da war ein Hügel schwarz von Comanchen.“
„Na ja.“ Stone nahm den Schlapphut ab und strich sich über die schweißnasse Stirn. Dann stülpte er den Hut wieder auf — „Wie lange werden wir bis Fort Laramie noch brauchen?“
„Nach unseren Karten legen wir ungefähr zehn Meilen am Tag zurück. Und gut vierhundert sind es vom Missouri.“
„Dann haben wir noch dreihundert vor uns“, murmelte der stämmige Aussiedler, „Dreißig Tage, wenn wir keine Pause machen und nicht aus der Richtung kommen.“
„Aus der Richtung kommen wir schon nicht.“ Ted blickte auf die beiden Hunde und er fragte sich, ob die es merken würden, wenn sich Indianer anschlichen.
Zwischen den Wagen wurde jetzt ein großes Feuer entzündet.
„Haben Sie Posten ausgestellt?“, fragte Ted.
„Natürlich.“
„Und was gibt es noch zu essen?“
„Das Rind, das die Bande erschossen hat.“
„Darüber wird es ja morgen.“
Stone strich sich über das Gesicht. „Die Männer und Frauen wollten es so. Und sie haben schon so halb und halb beschlossen, einen Ruhetag einzulegen.“ Ted grinste den Mann an. „Dann brauchen wir ja jetzt schon einunddreißig Tage!“
„Ja, ich weiß. — Halten Sie es für möglich, dass wir auch an eine große Indianerbande geraten?“
„Möglich ist alles.“
„Es sind aber doch sicher schon zahllose Trecks über die Prärie gezogen und nicht angegriffen worden. — Sutter soll mit sechzig Ochsen eine Dampfmaschine über die Prärie und die Berge nach Kalifornien geschafft haben.“
„Das ist schon Legende“, sagte Ted spöttisch. „Damals wussten die Indianer noch nichts von der Eisenbahn, auf die sie heute so verrückt wie auf den Teufel selbst sind, Mister Stone.“
„Was haben wir damit zu tun?“
„Wir sind der Eisenbahn sehr nahe“, entgegnete Ted, während er nach Osten spähte. „Ich hab Ihnen doch gesagt, dass wir viel sicherer sind, wenn wir zwanzig Meilen weiter im Norden fahren.“
„Das nehmen Sie doch nur an“, knurrte der Aussiedler. „Im Übrigen entfernt sich die Trasse der Bahn mit dem Tal des Platte River immer weiter nach Süden, je näher wir Fort Laramie kommen. Wir sind von der Bahnlinie schon mindestens dreißig Meilen entfernt!“
„Jaja, das ist richtig“, gab Ted zu.
Nach einer Weile schob sich am Horizont die Mondscheibe in die Höhe und überstrahlte das weite Prärieland mit ihrem kalten Silberlicht.
Die beiden Hunde waren aufgestanden und kläfften den Mond an, aber Stone brachte sie wieder zur Ruhe.
Auf einmal kam von Norden ein dumpfes Poltern; erst ganz leise und kaum hörbar, dann immer deutlicher.
„Was ist das?“, zischte der Farmer und spannte den Hammer seines Gewehres.
Ein Reiter sprengte von Norden heran und schrie: „Indianer! Sie kommen wieder!“
Irgendwo wurde in die Luft geschossen.
Ted schaute zurück und sah hastende Schatten zwischen den Wagen. Er lauschte, schüttelte den Kopf und sagte: „Das sind keine Indianer. Das ist nur ein einzelnes Tier!“
Das dumpfe Poltern wurde von einem Brüllen übertönt. Dann war ein vielstimmiges Kläffen zu hören.
Die Hunde sprangen auf und schlugen an.
„Wölfe“, sagte Ted und blickte den Reiter an, der von der nördlichen Seite der Wagenburg gekommen war. „Schnell, reiten Sie zu den Männern! — Sagen Sie, es sind Wölfe, die eine Büffelkuh verfolgen, weiter nichts!“
Unsicher blickte der Mann auf Stone.
„Nun reiten Sie schon!“, herrschte Ted den Mann an.
„Jaja, bin ja schon unterwegs!“ Der Mann zog sein Pferd herum und sprengte den Wagen entgegen. „Nicht schießen, ich bin’s, Hooker!“, schrie er.
Ted blickte nach Norden. Das Poltern war so nahe gekommen, dass er kaum begriff, wieso er noch nichts sah.
„Hoffentlich täuschen Sie sich nicht“, knurrte Stone.
Das Kläffen der Steppenwölfe war schon nicht mehr zu überhören.
Dann tauchte die gewaltige Büffelkuh auf, kam hinter hohem Gras hervor und jagte über kargen Sandboden, beleuchtet vom silbernen Licht des Mondes. Weit war die Büffelkuh noch nicht gekommen, da schoss auch das Wolfsrudel aus dem Büffelgras und folgte der Kuh.
„Still!“, schimpfte Stone.
Die Büffelkuh verschwand im wogenden Gras, tauchte erneut auf und verschwand abermals, dass es schon fast wie ein Spuk wirkte. Das Wolfsrudel schien dem gehetzten und sicher kranken Tier immer näher zu kommen, aber bevor die Steppenwölfe über die Kuh herfallen konnten, verschwand das Tier vollends aus dem Blickwinkel der beiden Männer.
Knurrend beruhigten sich die Hunde.
Aus der Ferne kam das Donnern der Hufe und das Kläffen der Wölfe, sank zu einem Flüstern herab und verklang allmählich.
„Ein kranker Büffel, der mit der Herde nicht mehr Schritt halten konnte“, sagte Ted an Stone gewandt.
„Seltsam.“
„Was ist daran seltsam? Die kranken Wölfe werden von ihrem Rudel auch zurückgelassen. — Das soll es übrigens auch bei Weißen geben.“
„Jetzt halten Sie aber die Luft an!“
„Ich red doch nicht von Ihnen.“ Ted lächelte Stone an. „Jemand hat mir erzählt, Sie seien in einer Waggonfabrik in Pittsburgh gewesen und als Rädelsführer einer verbotenen Organisation verhaftet worden. — Ist das wahr?“ Stones Gesicht schien kantiger zu werden. In seine Augen trat ein kaltes Strahlen. „Wer hat das gesagt?“
„Ist doch egal.“
„Ja, vielleicht. Passt Ihnen daran was nicht, dass sich die Arbeiter zusammenschließen?“
„Ich hab darüber nie nachgedacht“, sagte Ted. „Ich kenne die Verhältnisse in den Fabriken nicht.“
„Die sollten Sie aber kennen, wenn Sie darüber reden!“, schimpfte der Mann aufgebracht. „Wir sind ausgebeutet worden. Wir hatten Kessel, die wurden unzulässig unter Druck gesetzt, dass sie zerplatzten, und Dutzende Männer so verbrüht wurden, dass sie starben. — Man hat unsere Kinder arbeiten lassen — zehn, zwölf Stunden am Tag.“
„Das hätten Sie doch unterbinden können, Stone!“
„Natürlich. Dann hätten wir mit zusehen müssen, wie die Kinder verhungern. Oder denken Sie, in den Fabriken wird so viel verdient, dass eine Familie davon satt werden kann? — Wir wollten eine Organisation gründen, wollten die Gefahren, die Folgen der Habgier der Fabrikbesitzer abschaffen und gerechten Lohn haben. Aber die Millionäre haben die Polizei in der Hand und bestimmen, wer Sheriff wird und wer nicht. Der Sheriff von Pittsburgh war ein Mann der Millionäre. — Und wir lebten in der Einbildung, wir wären stärker als seine Polizei. — Deshalb wurde ich verhaftet, Catto, nun wissen Sie es!“
„Entschuldigen Sie, Stone“, murmelte Ted gepresst. „Ich hatte davon keine Ahnung. — Hat man Sie lange festgehalten?“
„Nein. — Ich fand einen Richter, den sie offenbar noch nicht gekauft hatten. — Die Unruhen hatten auch derart zugenommen, dass sie nicht noch mehr böses Blut machen wollten. Vielleicht hat er auch daran gedacht, dass bei dem ersten Zusammenstoß mit der Polizei mein Sohn ...“ Stone brach ab und schüttelte den Kopf. „Das wird Sie nicht interessieren.“
Ted hatte den Kopf eingezogen. „Sie haben einen Sohn? Davon wusste ich nichts, Stone,“
„Ich hatte einen Sohn“, sagte der Mann. „Er ist erschossen worden. Von der militanten Polizei der Kapitalisten. Wir hatten nicht ein einziges Gewehr, aber die haben doch auf uns geschossen. Mein Sohn war zwanzig, als er starb.“