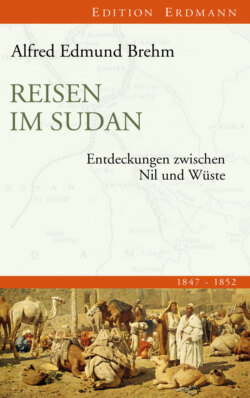Читать книгу Reisen im Sudan - Alfred Edmund Brehm - Страница 19
ОглавлениеZwischen Derr und Korosko verlässt der Nil seine südlich-nördliche Richtung und wendet sich nordöstlich. Auf dieser Strecke ist der herrschende Nordwind den Schiffen ungünstig, weshalb diese am »Trekseile«, arabisch »Libbahn« genannt, weitergezogen werden müssen. Ein Befehl der Regierung hat den Bewohnern des rechten Ufers – das linke ist Wüste – die Pflicht auferlegt, diese Arbeit zu übernehmen. Auch wir machten von dem Vorrecht aller Vornehmen Gebrauch und ließen uns so rasch als möglich befördern. Aber es empörte uns die Art und Weise, mit welcher man die Nubier zum Schiffsziehen presste. Zwei unserer Matrosen, tüchtige, handfeste Burschen, liefen den Barken voraus und trieben die in den Feldern, an den Schöpfrädern oder in den Häusern arbeitenden Männer mit Gewalt und Prügeln zum Zugseil. Wir wollten ihrer Roheit Einhalt tun, sahen aber ein, dass es ohne die landesübliche Methode nicht möglich war, fortzukommen, und mussten diese daher ihren Weg gehen lassen.
Während der Fahrt bereitete uns Don Angelo, dessen Furcht vor dem Ertrinken ich schon gedacht habe, ein spaßhaftes Intermezzo. Unsere Dahabïe lag still, der Nil war seicht und ruhig und die Luft höchst angenehm. Man redete also dem guten Padre zu, sein Rettungsboot, die Gummimatratze, doch einmal zu versuchen, um ihre Nützlichkeit bei einem tatsächlich vorkommenden Schiffbruch zu erproben. Es fehlte nicht an Gründen und Vorstellungen, ihm die Sache recht einleuchtend zu machen; er entschloss sich wirklich zu einer Probefahrt. Die luftgefüllte Matratze lag auf dem Wasser, Don Angelo entkleidete sich und bestieg sie mit Hilfe des Barons sehr vorsichtig. Behaglich schaute er von seinem Lager herab in den Strom. »Nun wüte, Nil, ich bin geborgen!« Aber – eine Bewegung – das trügerische Bett drehte sich, Don Angelo lag im Wasser! Obgleich er auf festem Grund stand, rief er doch kläglich um Hilfe. Man brachte ihn an Bord, um eine Hoffnung weniger. Von nun an sah er nur mit der höchsten Seelenangst in die trüben Fluten des Stromes.
Abends landeten wir in Derr, einem großen, zwischen Palmen versteckten, ganz unbedeutenden Dorf, in dessen Nähe sich ein halbverfallener Felsentempel befindet. Hier hatten unsere geistlichen Herren eine Amtsverrichtung. Ein Vater begehrte Hilfe für sein krankes, ganz erbärmlich aussehendes Kind. Man wusste nicht, was man diesem geben sollte, da die Mutter schon lange vor seiner Geburt an Syphilis gelitten hatte. Aber der Bischof wusste sich zu helfen. Er ließ es dem Vater unter dem Vorwand, dass er ihm Arzneien geben wolle, abnehmen und taufen! O sancta simplicitas!
Von Derr aus fehlte uns der Wind. Die Barken wurden deshalb von unserem Schiffsvolk am Libbahn langsam weiter gezogen. Am 29. kamen wir an der zerstörten Mamelukkenfestung Ibrim vorüber. Ein Dorf gleichen Namens liegt am Ufer des Stromes unter Palmen. Die Festung befand sich auf einem fast senkrecht vom Nil aufsteigenden Felsen, wenig stromaufwärts vom Dorf. Ihre Mauern waren zwar nur aus lufttrockenen Steinen aufgeführt, aber diese sind in Ländern, in denen es fast nie regnet, ein vollkommen dauerhaftes Material. Ibrim war einer der letzten Haltepunkte der Mamelukken5, jener von Mohammed-Ali sehr gefürchteten, willens- und tatkräftigen Kriegerschar, dem Pascha, solange sie bestanden, gefährlicher als das an einem Haar hängende Schwert dem Damokles. Lange war es ihm nicht möglich, etwas gegen die wohlverteidigte, fast unersteigliche Festung zu unternehmen, während die Besatzung, insgeheim mit den Nubiern im Bund, dem Angreifer durch Plünderung der den Strom befahrenden Schiffe und kühne Ausfälle beträchtlichen Schaden tat. Das Felsenschloss war mit Nahrung und durch eine in den Felsen gehauene, aus dem Strom gefüllte Zisterne auch mit Trinkwasser wohlversorgt. Endlich entschieden die Geschütze des Paschas den Fall desselben. Er zerschoss, eroberte und zerstörte die Burg und trieb die geschlagenen Feinde bis zur Insel Sais. Dort fanden sie später vollends ihren Untergang.
Am 1. November erreichten wir die Felsentempel von Abu-Simbel6 oder Ibsambol. Es sind zwei großartige Monumente, welche die kühnsten Erwartungen übertreffen. Vor dem vom Sand der Wüste fast verschütteten Portal des großen Tempels sitzen vier Kolosse von der Höhe des Memnoninus (vierundsechzig Pariser Fuß); ihre Gesichter sind wie die aller ägyptischen Bildsäulen unschön, aber wirklich grauenhaft anzusehen und deshalb imponierend. Der innere Tempel ist ganz aus dem Felsen gehauen. Er enthält vierzehn Kammern und Hallen mit Hieroglyphentafeln und Statuen von mehr als dreißig Fuß Höhe. In der hintersten und kleinsten Zelle sieht man drei Steinbilder, wahrscheinlich Sinnbilder verschiedener Gottheiten. Nach Prokesch* beträgt die innere Tiefe des Riesenbaues hundertdreißig, die Breite hunderfünfundvierzig Wiener Fuß. Der zweite Tempel verschwindet neben ihm. Er liegt nur wenige hundert Schritte von dem großen Tempel entfernt dicht am Strom, ist kleiner und weniger schön.
Dem Reisenden fällt die ewige Bettelei der Kinder und Erwachsenen aller nubischen Dörfer sehr zur Last. Bis hierher erstrecken sich noch die Reisen der gewöhnlichen Touristen, welche das Volk durch kleine Geschenke so verwöhnt haben, dass man in Dörfern, zumal wenn man europäisch gekleidet ist, sogleich von einem Haufen nackter Knaben oder in Lumpen gehüllter Erwachsener umringt und mit den im Chor geschrienen Worten: »Chawahdje haht Bakschisch [Herr, gib uns ein Trinkgeld]!« förmlich verfolgt wird. Selbst ganz kleine Kinder rufen dem Fremden schon »Bakschisch« entgegen; es sind die ersten Laute, welche sie stammeln lernen. Gegen die oft die Grenzen himmlischer Geduld – und diese besaß ich nie – übersteigende Anmaßung der Erwachsenen halfen mir gemeiniglich einige Hiebe mit dem unübertrefflichen Dolmetscher meiner Entrüstung, der aus der Haut des Hippopotamus geschnittenen Peitsche, kurzweg »Nilpeitsche« genannt. Da habe ich zum Beweis der unersetzbaren, überraschenden Wirkungen dieses vorzüglichen Instruments dann häufig sagen hören: »›Samehhuhni ja sihdi!‹ [Verzeihe mir, Herr], ich wusste nicht, dass du den ›tartieb el belled‹ [die Sitte, den guten Ton des Landes] so gut verstündest, ich will durchaus kein Bakschisch; aber ich hielt dich für einen des Landes Unkundigen, ›mahlesch‹ [lass es gut sein].« »Rabbena chaliek [Unser Herr erhalte dich]!« Erst oberhalb Wadi-Halfas, dessen Katarakt den Touristenreisen Grenzen setzt, hört diese Bettelei allmählich auf.
Abu Simbel
Am dritten November erreichten wir den letztgenannten Ort. Er liegt in einem meilenlang sich am rechten Ufer hinziehenden Palmenwald zerstreut, ist armselig, ohne Bedeutung, und bietet an und für sich gar nichts. Nur der eine Viertelmeile oberhalb der letzten Häuser des Dorfes beginnende, sogenannte »zweite Katarakt« hat Wadi-Halfa8 bekanntgemacht, denn es besitzt nicht einmal einen Markt. Sein Name ist aus den Worten »wadi«, d. i. ›Niederung‹, und »halfa«, der Benennung eines trockenen scharfschneidigen Riedgrases, abgeleitet.
Wir bezogen die große, von den Einwohnern »el-Khassr«, ›das Schloss‹, betitelte Karawanserei und mussten hier, weil sich in Wadi-Halfa weder Kamele noch oberhalb der Stromschnelle Schiffe vorfanden, dreizehn Tage verweilen. Unsere Wohnung bestand – vier Jahre später lag sie fast ganz in Trümmern – aus einem zweistöckigen, zimmerarmen Wohnhaus und einem sehr ausgedehnten Hofraum. Das Gebäude war durchgehend aus lufttrockenen Ziegeln aufgeführt und mit (zu diesem Zweck unbrauchbarem) Sparrwerk aus Palmenstämmen gedeckt. In der Ringmauer, welche das Ganze umschloss, sah man viele auf die Möglichkeit einer Verteidigung hindeutende Schießscharten. Früher mochte es wohl nötig gewesen sein, die reichen Karawanen vor etwaigen Angriffen zu schützen; zur Zeit unseres Aufenthalts in Wadi-Haifa, wo der Handel Monopol der Regierung war, erschien der Bau als nutzlos. Jedenfalls kam er uns aber sehr gelegen.
Wir langweilten uns in Wadi-Halfa ganz entsetzlich. In unserer Wohnung peinigten oder ängstigten uns große, in Menge vorhandene Skorpione; im Freien ärgerten wir uns über das unergiebige Jagdterrain. Nur durch Zufall erhielten wir einige wertvolle Vögel. Am 23. November konnten wir endlich die Reise fortsetzen. Einige Nubier schafften unser Gepäck über den Katarakt hinauf; wir verließen, auf Eseln reitend, nachmittags den einförmigen Ort und zogen längs des Nilufers an dem Katarakt hinauf. Mehrere unserer Reisegesellschaft hatten zum ersten Mal Reitkamele bestiegen und machten, um sich in den hohen Sätteln im Gleichgewicht zu erhalten, wunderliche Anstrengungen.
Die Entfernung unseres Ziels, des Lagerplatzes Amke oder Abke, beträgt, von Wadi-Halfa aus gerechnet, über zwei Meilen. Schon eine Viertelmeile oberhalb des letztgenannten Ortes sieht man keine menschlichen Wohnungen mehr. Man gelangt in das Gebiet des von Wüsten eingeschlossenen zweiten oder »großen Katarakts«. Das Auge erschaut nichts als Steine, Sand, Felsen, den Himmel und den durch Hunderte von Felseninseln zerspaltenen, schäumenden und donnernden, seine gestauten Fluten gewaltsam über die hemmenden Felsblöcke stürzenden Nil; nur hier und da reckt ein Mimosenbäumchen seine Zweiglein in die ruhige Luft; es hat am Ufer oder selbst mitten zwischen dem zerklüfteten Gestein doch noch Nahrung und somit die Möglichkeit zum Leben gefunden. Das Schauspiel ist entsetzlich schön. Es scheint, als läge hier die Natur noch in der chaotischen Verwirrung des Schöpfungsmorgens vor dem Auge des Beschauenden: so unendlich wild ist das vom Donner des Wasserfalls scheinbar erzitternde Panorama.
Scheik-Wohnung
Mit einbrechender Nacht kamen wir in Abke an. Die Matrosen vieler hier in einer Bucht wie im Hafen liegenden Barken saßen bei einer Temperatur von +14° Reaumur am Feuer und wärmten sich. Auch unseren verwöhnten Körpern tat die Wärme des Feuers wohl. Die Nacht war wundervoll. Noch hallte das Tosen des Katarakts in unserer Nähe als Echo wider, aber es begleitete nur die nicht unmelodischen Klänge der nubischen Zither, welche, weil sich das junge Volk der Schiffer zum Tanz ordnete, vor uns von kundiger Hand geschlagen wurde. Im Strom konnte ein scharfes Auge den Mastenwald der unweit vereinigten Schiffe erkennen; er selbst glich einem stillen, nur melodisch an dem Felsenufer plätschernden See, darin die leuchtenden Sternlein wieder flimmerten. Würzige Mimosendüfte schwängerten die frische reine Luft. Im leichten Wind rauschten die Kronen der Palmen; sie rauschten sanfter und weicher – wir schliefen!
In Abke lagen mehr als fünfzig jener kleinen Barken, welche man zur Fahrt in den Katarakten benutzt, und löschten ihre von Dongola el Urdi hierhergebrachte, fast nur aus Sennesblättern bestehende Ladung. Die Schiffchen sind aus einzelnen, verhältnismäßig kleinen Planken ohne Rippen zusammengenagelt, haben einen Mast mit rautenförmigem Segel, aber keine Kajüten, sondern nur einen höchst unbequemen Schiffsraum, welcher selten mehr als vierzig arabische Zentner an Ladung aufnimmt. Alle Abweichungen dieser Bauart von der anderer Nilschiffe sind durch die gefährliche Wegstrecke, innerhalb deren sie sich bewegen, geboten. Die Rippen fehlen, damit das Boot eine möglichst große Elastizität bekommt und bei dem häufig vorkommenden Auffahren und Aufstoßen an Felsenstücke nicht sogleich leck wird; die zwischen zwei Rahen (eine bewegliche und eine unbewegliche) eingeklemmten Segel sind rautenförmig, damit man die Kraft des Segels nach der verschiedenen Stärke des Windes regulieren kann; das Boot ist klein, kurz und niedrig, weil alles darauf ankommt, schnelle Wendungen machen zu können.
Die Mission bedurfte acht dieser Schiffe zum Transport ihrer und unserer Effekten und stieß am 18. November zugleich mit einigen und zwanzig anderer Barken vom Ufer ab, um bei günstigem Wind ihre Reise fortzusetzen. Es war ein schöner Anblick, den Strom mit einem Mal von mehr als dreißig mit weit geöffneten, weißen Segeln fahrenden Schiffen bedeckt zu sehen. Unsere Boote zeichneten sich von den übrigen durch die an der Rahenspitze flatternden Pavillone aus. Die höchst malerisch auf einem zackigen kohlschwarzen Felskegel gelegene Lehmfestung von Abke verschwand den Blicken; wir betraten das Battn el Hadjar, »den Bauch der Steine«, d. i. das Steintal: die wüsteste Provinz Nubiens, den traurigsten Landstrich, welchen ich je gesehen habe. Hohe, kahle, schwarze und glänzende Felsenmassen steigen senkrecht aus dem Nil, welcher sich durch sie hindurch im Laufe der Jahrtausende sein Bett graben musste, empor, engen ihn ein und zersplittern, sich seinem tobenden Drängen kühn entgegenstellend, seine Kraft, stauen ihn hoch auf und zwängen ihn derart ein, dass er zur Zeit seines höchsten Wasserstandes um zweiundvierzig Fuß höher steht als im April. Sie brechen die Macht des Mächtigen. Er strebt, sie zu vernichten, umschäumt sie mit seinem ewig rauschenden Wogenschwall; sie stehen unerschütterlich. Alles Kulturland haben sie verdrängt, aber mit ihnen im ewigen Wechselkampf sucht der Strom sein göttliches Vorrecht, das segensreiche Korn zu nähren und zu stärken, auch hier geltend zu machen. Wo er ein stilles Plätzchen findet, senkt er seinen fruchtbaren Schlamm auf das nackte Gestein und führt diesem selbst den Samen zu. Mitten im Strom sieht man von Weidengebüsch überzogene, ursprünglich kahle Felseninseln. Die Weiden haben ihre Zweige tief eingesenkt in das zerklüftete Gestein und treiben zur Zeit des niedersten Wasserstandes Blätter, Zweige, neue Wurzeln. Sie gewähren den gefiederten Wanderern gastlich ein wirkliches Dach. Fröhliche Sänger durchschlüpfen die blüten- und insektenreichen Flecken; die ägyptische Gans brütet dort still auf ihren sechs bis zehn Eiern, der Pelikan ruht dort von seiner Fischjagd aus und putzt sich mit plumpem Schnabel das rosenrot überhauchte Gefieder, die schwanzwippende Felsenbachstelze (Motacilla capensis) wird hier geboren. Jetzt schwellt die gewitterreiche Regenzeit der Tropen den mächtigen Strom. Die Umstände ändern sich, die Felsen sind jetzt die Träger des Lebens, der Strom droht Vernichtung des grünenden Weidendickichts der Insel. Aber schlank und schmiegsam beugt sich die Gerte vor dem Zürnen des Gewaltigen. Sie senkt sich, zitternd vor dem heftigen Wellendrang, tief ein in die trüben Fluten, aber geschickt weicht sie und grünt und blüht bei fallendem Nil kräftiger und lebendiger als vorher.
Das Steintal ist kaum fähig, kleine Vögel zu ernähren, und dennoch gibt es Menschen, welche es ihre Heimat nennen. In meilenweiten Abständen haben sie sich kleine Hütten erbaut, sie besitzen nur das, was sie der Milde des Stromes zu verdanken haben. Mit Lebensgefahr schwimmen sie zu einer von dem Gebirge her vielleicht unzugänglichen, stillen Felsenbucht und streuen hier Blumenkörner in den auf den Steinen haftenden Schlamm. Der Ertrag der Ernte ist ihr Reichtum; sie besitzen weiter nichts; sie sind so arm, dass ihnen selbst die ägyptische Regierung keine Steuern auferlegen konnte. Es gibt im Battn el Hadjar wohl auch einzelne Stellen, an denen mehrere Nubier vereinigt ihre Strohhäuser aufgeschlagen haben, ein kleines Stückchen Feld bewirtschaften und zwei Rinder oder vier Ziegen halten können, aber das sind Oasen, welche nicht das Gepräge dieser unglücklichen Provinz an sich tragen. Ein Palmenbaum, ein Strauch, eine Hütte wird hier mit Jubel begrüßt; ein Bohnenfeld ist das Ziel tagelanger Hoffnung, ein Schöpfrad das Zeichen des Reichtums. Das Steintal ist unendlich, unsäglich arm!
Am 19. November. Die Mohammedaner feiern das Fest zur Erinnerung an das Opfer Abrahams; unser Schiffsvolk sitzt in Feiertagskleidern auf dem Deck der Barken und lässt den günstigen Wind unbenutzt vorüberblasen; wir kommen erst um Mittag in Bewegung. Ruhig sitzen wir im Schiffsraum. Urplötzlich erzittert die Barke in ihrem ganzen Bau, sie ist mit furchtbarem Krachen auf einen Felsen gefahren. Wir springen entsetzt auf und machen Anstalten zum Schwimmen. Aber unser alter stromkundiger Reïs Bellahl sitzt mit dem gemütlichsten Gesicht von der Welt am Steuer und ruft uns freundlich zu: »Mahlesch!« Dank sei es diesem »Berge und Täler ebnenden, das Unmögliche möglich, das Unerträgliche erträglich machenden, den Zorn beschwichtigenden, die Angst verbannenden« Wort, mit der unendlich vielfachen Bedeutung, welche ich mit: »Es tut nichts« übersetzen will – wir beruhigen uns. »Die Barken sind sehr fest und halten manchen Stoß aus; ich habe noch ganz andere erlebt«, sagt unser Altvater aller Kataraktschiffer, »seid ohne Sorgen!« Es war nicht zu bezweifeln, Bellahl kannte den Strom wie kein anderer, er wusste jeden unter dem Wasser liegenden Felsen, schon ehe wir hinkamen, aber ebenso unzweifelhaft schien es zu sein, dass er mit einem gewissen Behagen das Schifflein auf den ihm bewussten Felsen jagte. Einige Tage nach dem eben Erzählten stieß unser mit starkem Wind segelndes Schiffchen so heftig auf versteckte Felsen auf, dass das Wasser durch ein bedeutendes Leck ins Innere eindrang. Aber man war auch auf Ähnliches gefasst. Lumpen und Werg lagen bereit und wurden sofort zum Kalfatern verwandt; sie reichten nicht; da riss sich einer der Matrosen sein Hemd vom Leib und opferte es zu gleichem Zweck für das allgemeine Wohl. In wenigen Minuten war der Schaden beseitigt.
Am 20. November kamen wir zum Schellal* von Senne. Durch drei Stromengen, von einer kaum mehr als vierzig Fuß betragenden Breite, drängt sich die ungeheure Wassermenge des Nil hindurch. Das Wasser steht am Anfang der Stromschnelle positiv um sechs Fuß höher als zwanzig Fuß weiter stromabwärts. Wir fuhren mit aller Segelkraft bis an einen der brausenden Wasserstürze heran, unsere Matrosen stürzten sich mit einem Seil in die schäumende Gischt, durchschwammen den heftigen Wogenzug und befestigten ihr Tau und somit unser Schifflein an einem Felsblock. Hier lagen wir, bis sich die Mannschaft sämtlicher acht Barken vereinigt hatte, dann zog man das schwankende Boot an starken Tauen durch die tobenden Fluten, welche fast über den Stern desselben zusammenschlugen.
Zu beiden Seiten der Stromschnelle stehen kleine, aber zierlich ausgeführte und mit sehr scharf gearbeiteten Hieroglyphenbildern gezierte Tempelruinen aus der Pharaonenzeit.
Wenn der Wind fortdauernd günstig bleibt, kann man alle Stromschnellen des Steintals in sechs bis acht Tagen überschiffen. Leider hatten wir auf unserer diesmaligen Reise keinen guten Segelwind; wir legten in drei Tagen nur eine Strecke von anderhalb deutschen Meilen zurück. Weder die Mission noch das Schiffsvolk war auf die Möglichkeit einer so ungünstigen Fahrt eingerichtet. Die Lebensmittel gingen zur Neige; auf den Schiffen stellte sich, obgleich nur sehr dürftige Rationen verteilt wurden, wirkliche Not ein. Unsere Matrosen schwärmten bei der herrschenden Windstille vergeblich meilenweit herum, um etwas Genießbares aufzutreiben. Sie aßen anstatt des Gemüses wild-, aber spärlich wachsende Kräuter, welche sie hier und da auffanden, und blieben bei all ihrer Not frohen Mutes, sangen und lachten. Wir Europäer waren bei unserer schmalen Kost weniger zufrieden und sehnten uns nach frischem Fleisch und Gemüse. Am Morgen erhielten wir eine Tasse Kaffee und einen Schiffszwieback, mittags trockenen Reis, »Pillau« genannt, und abends eine magere Suppe. Den Gerichten fehlte alle Würze, weil uns das Schmalz schon seit mehreren Tagen mangelte. Ich erlegte eine Nilgans, deren Fleisch uns ein wahrer Leckerbissen wurde, und erwarb mir ein freundliches Gesicht meiner europäischen Reisegefährten wegen des gelieferten Bratens, die Bewunderung aller Nubier aber wegen des geschickten Schusses.
Zwei Nilgänse, schöne, aber scheue Vögel, waren auf eine uns gegenüberliegende, wohl dreihundert Fuß entfernte Felseninsel gekommen und liefen am Strand herum. Sie fühlten sich durch den breiten, wogenden und jählings abstürzenden Nilarm von uns getrennt, ganz sicher; aber meine treffliche Büchse erreichte sie doch. Ich sandte dem Männchen des Pärchens eine Kugel durch die Brust; nach wenigen Flugversuchen lag es getötet am Strand der Insel. Die vereinigte Mannschaft von mehr als zwanzig unterhalb der Stromschnelle versammelten Schiffen hatte mir zugesehen und brach in lautes Beifallsgeheul aus. Nun trennte mich aber der breite Wassersturz noch von meiner Beute. Da erbot sich, in der Hoffnung eines zu erlangenden Bakschisch, einer unserer Matrosen, den Vogel herüberzuholen. Er legte sich auf einen kurzen Holzstamm und stürzte sich in den brausenden Strom. Die schäumenden Wogen schienen ihn verschlingen zu wollen und entzogen ihn auf Augenblicke wirklich unseren Blicken, aber er arbeitete sich rüstig durch, erreichte glücklich sein Ziel und kam, mit dem Vogel in der Hand, ohne Unfall wieder bei uns an.
Man kann die Gewandtheit der nubischen Schwimmer nicht genug bewundern. Während sich der Ägypter nur nach einiger Selbstüberwindung zum Schwimmen entschließt, scheint sich der Nubier im Wasser ganz heimisch zu fühlen. Er schwimmt, oft mit einem mehr als hundert Fuß langen Tau zwischen den Zähnen, kühn von Fels zu Fels trotz Wogendrang und Stromschnelle. Von Kindheit an ist er in der Kunst des Schwimmens geübt. Der Knabe jagt mit dem Mädchen spielend im Strom herum; der Jüngling oder erwachsene Mann bläst sich einen dichten Lederschlauch mit Luft auf, legt sich darauf und lässt sich dann vom Strom tagereisenweit talabwärts treiben; Frauen und Männer setzen mit ihren Schläuchen ohne Bedenken über den oft mehr als tausend Schritte breiten Strom.
Am 25. November legten wir mitten in dem bedeutenden Schellal von Ambukobl an einem Felsenblock an. Die Bewegung der wohlbefestigten Barken in dem Strudel der Stromschnelle war so heftig, dass mehrere aus unserer Gesellschaft die Seekrankheit bekamen. Wir zogen es vor, auf dem Felsen zu schlafen, wählten uns eine durch den Strom aufgelegte, ebene Sandbank zur Lagerstätte, breiteten unsere Teppiche darauf und schliefen, umtobt von dem Donner des Katarakts, herrlich die ganze Nacht hindurch.
Wir bemerken zu unserer großen Freude, dass die Gegend besser zu werden scheint. Hier und da zeigt sich eine Palme oder eine Mimosengruppe. Große Flüge verschiedener Zugvögel wandern den Strom entlang nach Süden und geben uns Hoffnung auf Beute. Die Not ist bei uns groß; wir haben fast nichts mehr zu essen.
Erst am 28. November erhob sich der sehnlich herbeigewünschte Nordwind und trieb unsere Schiffe nun ziemlich rasch dem Strom entgegen. Zwei Tage später durchschiffen wir die Stromschnelle von Tanguhr. Eine gänzlich zertrümmerte Barke lag mitten im Katarakt auf einer Felseninsel; sie war vor einem Monat mit ihrer Ladung gescheitert. Auch heute gelang es nur den vereinigten Anstrengungen vieler Matrosen, ein Schiff unseres Geschwaders vom Untergang zu retten. Mohammed, der Koch der Mission, wollte schwimmend sein mitten im Strom liegendes Boot erreichen. Die heftige Strömung trieb ihn unwiderstehlich dem Schellal zu; er kämpfte verzweifelnd mit den Wellen, wäre aber ohne Zweifel ertrunken, wenn ihm nicht zwei andere Nubier zu Hilfe geeilt wären. Diese brachten ihn, obgleich selbst dem Versinken nahe, besinnungslos ans Ufer. Man versicherte mir, dass jährlich mehrere Barken hier zu Grunde gehen und oft auch Matrosen trotz aller Schwimmfertigkeit ertrinken.
Einer unserer Schiffsleute, Aabd-Allah mit Namen, hat seine Frau, eine wirklich schöne Nubierin aus dem Palmenkreis Sukoht, mit an Bord. Gestern näherte ich mich zufällig der nussbraunen Schönheit. Wie ein gereizter Tiger fuhr der Nubier auf mich los. »Herr«, rief er wütend, »was willst du von meiner Frau?« Ich mochte ihm beteuern, was ich wollte, er betrachtete mich von nun an mit namenloser Eifersucht und schien uns beide aus tiefster Seele zu hassen.
Am 1. Dezember. Wir befinden uns in einem weit besseren Landstrich als bisher. Palmen und Mimosen gruppieren sich zu kleinen Wäldchen. Vor uns liegt am rechten Ufer ein hoher Berg mit zackigen, ausgeprägten Gipfeln, der Djebel el Tibsche. Auch am linken Ufer erheben sich steile Felsmassen. Eins der schönsten Bilder des Battn el Hadjar liegt vor uns. Die glühenden, schwarzglänzenden Felsenpartien geben dem Panorama etwas schauerlich Wildes, aber da liegt wenig weiter oben Akahsche mit seinem weißen, zwischen Mimosen hervorschauenden Scheichsgrab, umgeben von freundlichem, bebautem Ackerland, und mildert das grausig Tote der übrigen Wildnis.
Gegen Mittag erreichen wir die heiße Quelle von Okme. Sie kommt neben einem alten, halbverfallenen und verschlemmten Turm, welcher sie früher wohl gefasst haben mag, zu Tage. Rings herum ist der Boden mit einer Salzkruste bedeckt. Die Wärme der Therme beträgt über 40° Reaumur; ihre Wassermenge ist gering, hell und nach Schwefel schmeckend. Obgleich überall in Nubien als Heilquelle bekannt, wird sie doch wenig benutzt. Selten badet ein Kranker in ihr, gewöhnlich aber mit gutem Erfolg. Diese Quelle ist die einzige, welche zwischen Khartum und Kairo in den Nil fällt.
Die Stromschnelle von Akahsche ist kaum eine halbe Meile südlich von ihr entfernt; wir erreichten sie nachmittags. Von allen Schiffen war das unsrige das einzige, welches den Schellal sofort durchschiffte. Unser stromkundiger Reïs wiederholte, unzählige Male von der Strömung zurückgeworfen, den Versuch, über den Katarakt zu schiffen, so lange, bis er gelang. Wir gingen oberhalb desselben am rechten Ufer ans Land.
Idrieß, unser schwarzbrauner, nubischer Diener, badete sich, kleidete sich festlich an und ging nach dem heiligen Grab, um dort das Abendgebet zu verrichten. Der daselbst ruhende Scheich steht, als Schutzpatron der Stromschnelle, in viel zu hoher Achtung, als dass es sich ein Schiffer erlauben würde, an seinem Grab vorüberzugehen, ohne zu beten. Das Schiffsvolk aller mit uns angekommenen Barken folgte dem Beispiel unseres Idrieß; nur der alte, religiöse Reïs Bellahl konnte nicht wohl abkommen. Da brachten ihm seine Leute Erde von dem heiligen Grab mit; er streute diese auf das Deck seines Schiffleins und betete auf ihr. Bellahls Gottesfurcht ist unserer Achtung wert. Ehe er sein Schiff in die brausenden Wogen steuert, kniet er zum Gebet hin, um sich den Segen Allahs zu der gefährlichen Fahrt zu erflehen; wenn die Gefahr vorüber ist, drückt er dankend die Stirn in den Staub. Er ermahnt seine Untergebenen, ihren religiösen Verpflichtungen nachzukommen; seine Frömmigkeit ist keine Maske, sondern tiefgefühlte Wahrheit.
Strohhütten unweit Okme
Am 9. Dezember. Es war Windstille. Der Baron hatte sich auf die Jagd begeben; ich lag, von dem ersten Anfall des klimatischen Fiebers gepeinigt, im Schiffsraum; der Fieberfrost durchschüttelte mich. Da erhob sich auf dem Deck der Barke ein wüstes Geschrei, dessen grelle Töne mir bald unerträglich wurden. Ich erfuhr von unserem Diener Idrieß, dass man auf den Baron unwillig sei, weil dieser nicht zurückkehre, nachdem Wind aufgekommen wäre. Um die Reise fortsetzen zu können, habe man den Matrosen Aabd-Lillahi (oder Aabd-Allah) fortgeschickt , um den Baron zurückzurufen. Mir ahnte davon nichts Gutes: Aabd-Lillahi war uns allen als jähzorniger, wütender und roher Mensch zur Genüge bekannt geworden.
Wenige Minuten später hörte ich den Baron um Hilfe rufen und sah ihn am Strand im ernsthaftesten Handgemenge mit dem Nubier, welcher sich der Jagdflinte meines Gefährten zu bemächtigen suchte. Er würde diesen, wäre er in Besitz der Waffe gelangt, wahrscheinlich zusammengeschossen haben, weshalb ich auch keinen Augenblick zögerte, das Gefürchtete womöglich noch zu verhindern. Ich nahm die Büchse zur Hand und den Nubier aufs Korn; aber die Streitenden veränderten ihre Stellungen so oft, dass ich, ohne den Baron zu gefährden, den Schuss nicht wagen konnte. Jetzt wurde er frei, ich zielte genauer – da brach er plötzlich, noch ehe ich geschossen hatte, blutend zusammen: der Baron hatte ihm sein Dolchmesser in die Brust gestoßen.
Von ihm erfuhr ich nun auch den Hergang der Sache. Aabd-Lillahi war im höchsten Zorn schimpfend und fluchend auf ihn zugekommen, hatte ihn mit Gewalt dem Ufer zugedrängt und in der Nähe des Schiffes sogar geschlagen. Der Baron nimmt erzürnt sein Gewehr von der Schulter und will dem Nubier einen Kolbenschlag versetzen, dieser aber springt wütend auf ihn los, presst ihm mit der Hand die Kehle zusammen, schimpft ihn Christenhund und Ungläubigen und droht, ihn mit dem Gewehr, dessen er sich bemächtigen will, niederzuschießen. Von diesem Menschen war alles zu fürchten und der Baron, bei seiner wehrhaften Verteidigung, in seinem vollen Recht.
Es ist unmöglich, von dem sich nach diesem Auftritt erhebenden Lärmen eine Beschreibung zu geben. Das Schiffsvolk schrie wie immer entsetzlich, schwor fürchterliche Rache und zog haufenweise zum Padre Ryllo. Dieser Jesuit war nicht nur niederträchtig genug, der Menge recht zu geben, sondern hetzte sie sogar noch gegen uns – Ketzer – auf. Don Angelo, der Arzt der Mission (welcher, beiläufig bemerkt, eine dunkle Idee von der Möglichkeit der Heilkunde haben mochte), wurde beordert, den »armen Verwundeten« zu sondieren und zu bepflastern. Das Volk wurde, wie leicht zu begreifen, durch diese christlichen Maßregeln noch weit erbitterter und anmaßender. Die Reïsihn erklärten unter tierischem Gebrüll wiederholt, unsere Barke zurücklassen und sich selbst Recht verschaffen zu wollen. Wir setzten unsere Waffen zu einer Verteidigung auf Leben und Tod in den besten Stand, bedeuteten die Schiffsführer, welche am nächsten Morgen ihre Drohungen erneuerten, ihre Pflicht zu tun, versprachen, uns vor das Gericht des Gouverneurs der Provinz Dongola zu stellen, und schworen, jeden, welcher sich unserem Boot in feindlicher Absicht nähern würde, niederzuschießen.
Unsere Energie verfehlte ihre Wirkung nicht. Die Matrosen fügten sich murrend unseren Gewaltmaßregeln und sagten uns Gehorsam zu.
Aabd-Allahs Wunde war nicht gefährlich. Eine Rippe hatte die Kraft des außerdem unfehlbar tödlichen Stoßes gebrochen. Nachdem das im Anfang sehr heftige Wundfieber vorüber war, genas er bald. Da er sich später willfährig zeigte, den Streit in Güte beizulegen, gab ihm der Baron drei Speziestaler Schmerzensgeld und schlichtete damit den bösen Handel zu beiderseitiger Zufriedenheit.
Die Jesuiten haben sich später bemüht, die Handlung meines Gefährten in ein schlechtes oder wenigstens zweideutiges Licht zu ziehen und seine Selbstverteidigung als Verbrechen darzustellen, weshalb ich ihn hier vertreten zu müssen glaube. Er handelte, wie jeder andere in seiner Lage gehandelt haben würde. Mord und Totschlag ist in jenen Ländern keineswegs etwas so Außergewöhnliches, dass man nicht an eine kräftige Verteidigung denken sollte, wenn man sein Leben bedroht sieht.
Unsere Reise förderte von nun an rasch. Wir näherten uns, weil der im Dahr el Mahhaß felsenfreie Strom uns nicht mehr aufhalten konnte, der Hauptstadt Dongola täglich mehr. Am 12. Dezember störte ein Zufall noch auf kurze Zeit die Ruhe einer äußerst angenehmen Nilfahrt durch das im Vergleich mit dem mühsam durchsegelten Battn el Hadjar reich bebaute Palmenland Dongola. Unser Reïs zertrümmerte beim Auffahren auf die letzten Felsblöcke, welche er zu finden glauben mochte, das Steuer unseres Bootes. Obgleich der Schaden notdürftig wieder ausgebessert wurde, blieb der Verlust doch so fühlbar, dass die Wellen bei einem heftigen Windstoß über Bord schlugen und an dem gänzlichen Umschlagen der Barke wenig fehlte. Nachdem uns Reïs Bellahl am 14. Dezember in seiner Wohnung mit Palmenwein* bewirtet hatte, schied er von uns. Wir fuhren weiter und landeten um Mittag auf der großen, gut bebauten und stark bevölkerten Insel Argo, auf welcher vormals ein eigener König herrschte9. Der hier wohnende Eigentümer unserer Barke machte uns seinen Besuch und beschenkte uns mit einem wohlgenährten Schaf und einem Krug Butter, welche hierzulande immer flüssig ist. Am folgenden Tag landeten wir in Dongola el Urdi, nachdem wir, von Wadi-Halfa aus, siebenundzwanzig Tage unterwegs gewesen waren.
Die Stadt Dongola, gemeiniglich schlechtweg »el Urdi«, das Lager, genannt, wurde nach einem Plan des Naturforschers Ehrenberg10 an der Stelle des kleinen Dorfes Akromar erbaut und diente den Türken, welche die Provinz erst vor Kurzem erobert hatten, anfangs als Festung. Dongola ist ein unbedeutender Ort, welcher schlechte Basare* mit wenigen Verkaufsartikeln, einige Kaffeehäuser und Branntweinkneipen enthält. Es ist der Sitz eines türkischen »Mohdihrs« oder Provinzgouverneurs.
Am ersten Sonntag nach unserer Ankunft (am 19. Dezember) las Padre Ryllo in der hiesigen koptischen Kapelle die Messe in arabischer Sprache. Das Gotteshaus war sehr zahlreich besucht worden. Ryllo brachte von dort ein Brötchen, wie es die koptischen Christen bei ihrer Abendmahlsfeierlichkeit gebrauchen, mit zurück. Es war aus Weizenmehl frisch gebacken, rund, einen Zoll hoch und hielt drei Zolle im Durchmesser; auf der oberen Seite sah man das fünffache Kreuz von Jerusalem.
Die Mission wollte die zu hoffende Genesung ihres von Kairo an ununterbrochen an einer sich mehr und mehr verschlimmernden Dysenterie leidenden Chefs in Dongola abwarten. Der Ort bot uns zuwenig, als dass wir diese unbestimmte Zeit hier hätten verbringen können. Wir trennten uns daher von der Mission, mieteten eine Barke bis zum Dorf Ambukohl am Eingang des Weges durch die Wüstensteppe Bahiuda und verließen Dongola am 20. Dezember. Unser Verhältnis zur Mission war nicht das beste gewesen, aber doch tat es uns leid, von Männern scheiden zu müssen, mit denen wir länger als drei Monate zusammen gelebt hatten; wir fühlten, dass wir von nun an ganz auf uns gestellt waren. Der falsche Bischof gab mir Gesundheitsregeln, Pater Knoblecher herzlich gemeinte Mahnungen mit auf den Weg; Padre Ryllo wünschte uns kalt und steif glückliche Reise; Don Angelo machte schlechte Witze, Padre Muhsa, mein alter grilliger, aber seelenguter, väterlicher Freund und Bekehrer, und Baron S.S. begleiteten uns bis zu unserem Schiff. So schieden wir in Frieden voneinander.
Oberhalb von Dongola bieten die Ufer des Stromes wenig Bemerkenswertes. Handak und Alt-Dongola, »Dongola adjuhs«11, sind so unbedeutende Ortschaften, dass sich wenig oder nichts über sie sagen lässt. Wir verkürzten uns den einförmigen Weg mit Jagen und Präparieren des Erlegten, bis der 24. Dezember herankam. Dieser weckte freilich mancherlei Empfindungen in unserem Innern. Wir befanden uns im Innern Afrikas, unsere Gedanken waren daheim. Der Abend stimmte uns weich; wir beschlossen, ihn wie im Vaterland zu feiern. Uns selbst konnten wir gegenseitig nichts bescheren, darum beschenkten wir unsere Diener. Dann holten wir Wein herbei und tranken aufs Wohl der fernen Lieben. Und als es vollends Nacht geworden war, setzten wir uns hinaus in die helle Sternennacht und horchten still dem Schlag der murmelnden, vom Kiel des Schiffes gebrochenen Wellen; und während dieses langsam, feierlich den Strom durchfurchte, begingen wir ernst und ruhig das Fest der Weihenacht.
Am 25. Dezember landeten wir in Aabduhn, einem unbedeutenden Dorf, weil wir gehört hatten, dass wir auch von hier aus durch die Steppe ziehen könnten und zwei bis drei Tage Zeit ersparen würden. Wir traten mit einem uns von unserem Reïs zugeführten Araber in Unterhandlung, welcher uns versprach, bis Sonnenuntergang acht Kamele für die Mietsumme von vierzig Piastern (für jedes Kamel) zu stellen. Aber wir warteten, nachdem er sich entfernt hatte, um die Lasttiere herbeizuschaffen, mehrere Stunden vergeblich auf seine Rückkehr. Ungehalten wegen der verlorenen Zeit, wollten wir den Lügner durch den »Kaimakahn«* bestrafen lassen und ließen diesen herbeirufen. Da erfuhren wir, dass dieser nicht die Macht habe, Aabd el Hamihd – so hieß jener Araber – zu züchtigen, weil er nicht unter seine Botmäßigkeit, sondern unter die eines verrufenen Beduinenstammes gehöre. Der Scheich* des Ortes habe ihm Kamele verweigert, weil er gezweifelt habe, dass wir unter Aabd el Hamihds Leitung jemals nach Khartum gelangt sein würden. Der Kaimakahn gab uns zugleich den Rat, uns in Zukunft, wenn wir Kamele bedürften, nur an Beamte der Regierung zu wenden; diese seien für die Sicherheit der Reisenden verantwortlich. In der Folge sah ich ein, wie Recht der Mann hatte.
Wir brachen nach dem eben Erfahrenen sogleich wieder auf, störten ein riesiges Krokodil mit Büchsenkugeln aus seinem Nachmittagsschlummer und gelangten mit gutem Segelwind am Mittag des folgenden Tages nach Ambukohl. Der »Kahschef« oder Bezirksvorsteher, ein durch Empfehlungsbriefe von seinem Vorgesetzten Muhsa-Beï sehr dienstfertig gemachter, wohlleibiger Türke, versprach alles zu tun, was wir wünschen würden. Abends erschien er auf unserem Schiff zu Besuch. Wir bewirteten ihn zuerst mit Kaffee und später mit Rum, weil uns sein Begleiter, ein schmächtiger, kriechender Kopte, versichert hatte, dass sein Gebieter die Befehle des Propheten zu interpretieren wisse. Das berauschende Getränk versetzte unseren biederen Türken sehr bald in fröhliche Laune. Begeistert rief er mehrere Male: »Oh, meine Herren, das ist der schönste Tag meines Lebens!« Das sollte jedoch nicht der Fall sein. Beim Nachhausegehen fiel der schwere, mehr schwebende als gehende Mann von dem den Schiffsbord mit dem Land verbindenden Brett in den Nil und zog seinen dienstfertigen Geist und Sekretär nach sich in die trüben Fluten. Wir wollten ihm zu Hilfe eilen, aber er hatte die terra firma bereits wiedergewonnen. Von Wasser triefend kehrte er an Bord zurück, um uns zu versichern, dass nicht er, sondern nur der lumpige Kopte in den Strom gefallen sei. »Seid ohne Sorgen, meine Herren, einer so schmiegsamen Kreatur schadet das nichts. Leïlkum saaïde!«, Glückliche Nacht!
* Diese Dampfschiffe legen die Hin- und Rückreise in zwanzig Tagen zurück. Bei jedem Tempel wird drei Stunden, in Theben fünf Tage verweilt. Mit Einschluss der Kost bezahlt jeder Reisende fünfundzwanzig Guineen für die ganze Tour.
* Plural von Khula.
* Man kann Akrahme mit »Gastfreundschaft« übersetzen.
* Die Almeh ist eine Sängerin, welche vor den im Diwan des Türken versammelten Gästen singt. Sie selbst sitzt hinter dem engvergitterten Fenster eines Nebengemachs, durch welches wohl ihre Töne dringen, sie aber nicht gesehen werden kann und darf.
* Plural von Rhausïe.
** Ich will dieses Wort, das ich gewohnheitshalber, wohl noch manchmal brauchen werde, erklären. Es ist nicht gleichbedeutend mit ανττσα der Griechen, obwohl davon abgeleitet oder herstammend, sondern bezeichnet jede Art von Unterhaltung oder nicht religiöser Festlichkeit eines Orientalen. Jeder Zierrat heißt Fanthasïe; ein gesticktes Kleid, ein graviertes, silber- oder goldbelegtes Gewehr mit geschnitztem Kolben, jeder farbenprächtige Teppich oder verzierte Sattel usw. ist »mit viel Fanthasïe« gearbeitet. Ein Trinkgelage, eine Tanzunterhaltung, ein festlicher Aufzug etc. ist »Fanthasïe«.
* Oder Hornblende- und Feldspatverbindung.
** Zollbehörde
*** Sie beträgt für einen Neger oder Abessinier zwanzig, für eine Negerin vierundzwanzig und für eine Abessinierin dreiunddreißig Taler unseres Geldes.
* Ein mit Wasserschläuchen beladenes Kamel kostet nach den von der Regierung erlassenen Bestimmungen, wie das Reitkamel, sechs Taler unseres Geldes für diese Tour, der Transport eines arabischen Zentners von hundert »Ardahl« oder einundachtzig Wiener Pfunden wird mit dreißig Piastern oder zwei Talern preußisch berechnet. Diese Mietpreise sind nicht niedrig, weil man bei dem beschwerlichen Weg einem Kamel nur drei arabische Zentner aufbürden darf und sehr viel Trinkwasser mit sich führen muss.
** hier: Geleit- und Schutzbrief
* »Das Land zwischen den Nilkatarakten.«
* Unter »Schellal« versteht der Nubier eine Stromschnelle.
* Ein braunes, durch leichte Gärung auserlesener Datteln erzieltes berauschendes Getränk.
* Im Jahr 1852 wurden diese vergrößert und verbessert; auch baute man auf Befehl Latif Pashas, des Generalgouverneurs von Ostsudan, eine Moschee.
* Der Kaimakahn ist der Vorsteher eines Dorfes, aber immer ein gedienter Soldat.
* »Scheich« ungefähr soviel als ›Schultheiß‹.