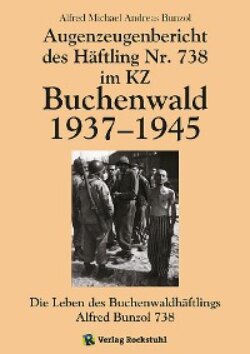Читать книгу Augenzeugenbericht des Häftling Nr. 738 im KZ Buchenwald 1937–1945 - Alfred Michael Andreas Bunzol - Страница 8
Die Jahre 1907 bis 1925
ОглавлениеIch sehe Bielschowitz, die Kirche, den Dorfladen, unser Haus. Bielschowitz, ein Bergarbeiterdorf in Oberschlesien. Dort wurde ich am 31. Mai 1907 als jüngster Sohn des Bergbauelektrikers Alfons Bunzol und seiner Ehefrau Marie im Schlafzimmer meiner Eltern geboren. Die Kinder wurden ja im Elternhaus geboren und man starb auch dort. Es war ein Freitag. Kein außergewöhnlicher, abgesehen von meiner Geburt, eben ein Freitag wie jeder andere Freitag davor. Die Kirchturmuhr schlug wie immer zu jeder vollen Stunde die Anzahl der bereits abgelaufenen. Bei meiner Geburt schlug sie elf Mal. Meine Geburt ging sehr schnell, als das ich groß darüber zu berichten hätte. Sie so ca. 50 min dauerte, eigentlich noch weniger. Mutters ersten Worte die ich zu hören bekam: war doch gar nicht so schlimm, mein Kleiner. Alle, Mutter, die Hebamme, meine Oma und eine Nachbarin, fingen an zu lachen. So war ich pünktlich zum Schichtende von Vater auf der Welt. Gemeinsam mit Mutter, ich nuckelte schon an ihrer Brust, konnten wir den staunenden Vater begrüßen. Fast alle Männer im Dorf arbeiteten in der Grube als Bergmann. Das dörfliche Leben in Bielschowitz wurde geprägt durch den Bergbau, von deren Wohlergehen die Masse der Dorfbewohner abhängig war. Daraus ergab sich eine weitgehende Interessengleichheit. Hierarchische Unterschiede gab es wohl, so zwischen Steiger und Obersteiger oder den einfachen Bergmann. Nach Schichtende gingen die wenigsten wie Vater nach Hause, die meisten in den Dorfladen um Schnaps zu trinken. Die Frauen versorgten Haus und Hof, ihre Männer und natürlich uns Kinder. Der Samstag war für sie der Hauptarbeitstag, an dem alles zum Sonntag gerichtet wurde, wie etwa Hof und Straße zu fegen und überall Ordnung schaffen. Je nach Jahreszeit wurde immer ein sehr leckerer Streusel- oder Obstkuchen gebacken. Tagsüber hielten sie ihr Schwätzchen auf der Straße und tauschten untereinander Neuigkeiten aus. Von fernen Ereignissen erfuhr man ja so gut wie nichts. Es sei denn, man hatte Geld übrig und konnte sich eine Zeitung leisten. So war man eben auf den engsten Bereich seiner Umgebung angewiesen. Haustüren wurden nicht abgeschlossen, es sei denn, Zigeuner waren in der Nähe, deren üblicher Rastplatz bei der Auffahrt zur Halde lag. Infolgedessen herrschte im Dorf ein ständiges Leben im Freien. Auch wir Kinder spielten, sofern man nicht die Schule besuchen musste, den ganzen Tag im Freien. Es sei denn, es regnete, da suchte man sich irgendeinen Schuppen oder einen anderen Unterschlupf. Getauft hat man mich natürlich in der Kirche von Bielschowitz. Die Taufe war meist ein Familienfest, aber oft wurde sie gleichzeitig auch zum Dorffest, an der die gesamte Nachbarschaft und Verwandtschaft teilnahm. Den Pfarrer nicht zu vergessen. Die Haustür wurde geschmückt. Man machte kleine Geschenke. Nach der Heiligen Messe am Vormittag gab es dann ein Festmahl im Hause, zu dem die Paten und die Familie eingeladen waren. Wenn man getauft ist, tritt man der Kirche bei. Dass ich getauft bin, liegt an meinen Eltern, obwohl sich diese Entscheidung natürlich auch auf mein Leben auswirkte. Es bedeutete für mich, dass ich von nun an zur katholischen Gemeinde von Bielschowitz dazugehörte. Wie alle in Bielschowitz zur katholischen Gemeinde dazugehören. Man gab mir den Rufnamen Alfred, sowie den Zweitnamen Eduard. Einer schönen Tradition folgend, es waren die Namen meines Großvaters oder Urgroßvaters? Ich weis es nicht mehr so genau. Ich war der jüngste von 3 Geschwistern, Hildegard genannt Hilde, Adelheid und Paul. Wir wohnten in einen Haus, es war natürlich auch Eigentum der Grube, in der mein Vater arbeitete. Wie fast alles in Bielschowitz Eigentum der Grube war, wahrscheinlich auch die Menschen die hier wohnten. Die Ausdehnung der Königin-Luise-Grube, so war ihr Name schon seit ca. 1820, reichten im Süden bis nach Kunzendorf (Delbrückschächte), Paulsdorf und Bielschowitz. Eine Ausdehnung von fast 45 qkm! Bielschowitz war eines von vielen typischen Bergarbeiterdörfern in Oberschlesien, mit einigen übrig gebliebenen Bauernhöfen, wo noch Landwirtschaft betrieben wurde. Die Bergarbeitersiedlung bestand aus Einfamilienhäusern in Klinkerbauweise. Unser Haus hatte 5 Zimmer, die Küche, die gute Stube, das Elternschlafzimmer und 2 kleine Kinderzimmer.
In einem der Kinderzimmer schliefen Hilde und ich, in dem anderen Adelheid und Paul. Toilette war auf dem Hof. Die anderen Häuser hatten bestimmt die gleiche Ausstattung. Jedenfalls sahen sie von außen alle gleich aus. Zum Haus gehörten ein großer Garten und ein kleiner Hof. Vater hielt sich, wie fast alle hier, Kaninchen, ein paar Hühner und einen Hund. Der Hund, die Rasse kann man schlecht beschreiben, weil vielleicht viele Hunde zu seiner Entstehung beigetragen haben, hörte auf den Namen Spitz. Spitz war der Liebling von uns Kindern und sehr verspielt. Er war unser ständiger Begleiter. Bielschowitz hatte 2 zentrale Anlaufpunkte. Die Kirche in der Dorfmitte umgeben von einem Park mit Teich und den Dorfladen, der rechts neben der Kirche stand. In dem Park waren Bänke, sie waren nachmittags Anlaufpunkt der Jugend des Dorfes. Wie die meisten jungen Menschen auf der ganzen Welt ihre Anlaufpunkte suchen. Sie brauchen ihre romantischen Plätze, ungestört, möglichst weit weg von der Welt der Erwachsenen. Alle Straßen führten zu diesen Zentrum, umkreisten es ringförmig und führten wieder hinaus. Der Kirchgang am Sonntag war heilige Pflicht. Alle Einwohner von Bielschowitz waren katholisch, ich wüsste keine Ausnahme. Im religiösen Leben der Bergleute nahm ja, getragen von der katholischen Tradition, die Heiligenverehrung einen breiten Raum ein. Oft begann die tägliche Arbeit sogar mit einem kollektiven Morgengebet. Meine Eltern und wir Kinder waren logischerweise auch katholisch und so ging es jeden Sonntag aufs schönste herausgeputzt zur Kirche. Wo alle beim sonntäglichen Kirchgang dem Herrgott huldigten, die meisten im täglichen Leben dagegen dem Schnaps. Man hörte sich die Messe an und beichtete anschließend. Ich wusste vor einer Beichte wirklich nicht, was ich da zu beichten hätte. Einmal beichtete ich, nur um überhaupt etwas zu beichten, ich war glaube neun oder zehn, dass ich der Nachbarstochter, sie hieß Maria, beim Doktorspiel zwischen die Beine geschaut habe. Darauf der Beichtvater: „Oh, Gott! Das hat dir doch nicht etwa Spaß gemacht, mein Sohn? Ich sagte, doch, sie durfte es ja auch bei mir!“ Die Strafe, ich solle zehn Mal das Vaterunser betten. Ich fand es sehr ungerecht, da die Höchstanzahl für uns Kinder normalerweise fünf Mal war. Doch was der Pfarrer sagte war Gottes Wort und somit Gottes Wille für uns alle. Wurden wir doch zur Hörigkeit gegenüber der Kirche erzogen. Für uns alle war der sonntägliche Kirchgang mit seiner Beichte jedoch eine Selbstverständlichkeit die zum Leben dazugehörte, wie Sonne und Mond, oder Feuer und Wasser. Zu meinem Leben gehörte auch, dass ich jeden Tag mit Hilde, vielen Freunden aus der Nachbarschaft, im angrenzenden Wald, auf dem Hof, oder ganz einfach im Garten, spielte. Oder wir zogen über die Felder. Manchmal kletterten wir auf die vielen Halden, die um Bielschowitz aufgeschüttet wurden. Und geschüttet wurde viel, denn es wurde immer mehr Steinkohle gefördert, wegen der man sich immer tiefer in die Erde graben mußte. Unsere Eltern sahen es aber nicht gern, da es gefährlich war. Gefährlich, weil im inneren der Halden Schwelbrände auftraten. Die Folge, es kam zu plötzlichen Einstürzen, auch waren die austretenden Dämpfe beim Einatmen sehr giftig. Oft holten Hilde und ich Vater von der Arbeit ab. Für uns war der Weg zur Grube sehr spannend und Vater freute sich immer sehr. Spannend deshalb, weil man Autos und Lkws bestaunen konnte. Für uns Kinder waren diese Dinger ein Wunder. Die Fahrer machten sich oft einen Scherz und hupten, wenn sie an uns vorbeifuhren. Man zuckte dann jedes Mal zusammen, über dieses urtümliche Geräusch. Wir setzten uns einfach vor das Werkstor und warteten bis Vater Feierabend hatte. Manchmal ging er dann mit uns in den Dorfladen, rechts neben der Kirche im Dorfzentrum und kaufte uns Süßigkeiten. Der Laden war zugleich Anlaufstelle für viele Bergleute, die hier ihren Schnaps tranken und dass meist nicht zu knapp. Wenn man den Laden betrat waren links 5 oder 6 Stehtische aufgestellt, an denen die Bergleute standen und tranken. Rechter Hand war der eigentliche Laden in dem man alles kaufen konnte. Angefangen von Süßigkeiten, Brot, Wurst, Spielzeug, Stoffe, eben alles was man auf den Dorf so zum Leben braucht. Manchmal lästerten die Bergleute über Vater, weil er nur ganz selten mittrank. Aber Mutter war sehr froh darüber. Es gab genügend Frauen in Bielschowitz, die neidvoll auf unsere Familienglück schauten und wahrscheinlich oft genug davon träumten, es auch einmal so zu erleben. Die Bunzol galten als sehr glückliche Familie, die sie auch war. Viele der Bergleute, die hier ein und aus gingen, die meisten unter ihnen waren ungebildet, gaben ihren Lohn nicht der Familie, sondern ließen ihn gleich in dem Dorfladen. Freitags war immer Lohntag und dann sah man häufig wie verzweifelte Frauen versuchten den Männern das wenige Geld abzunehmen. Die Schulden waren in diesen Familien oft so hoch, das sie im Dorfladen keinen Kredit mehr für essen und trinken bekamen. Die letzte Stufe war dann meist, dass sie in die Sozialbaracken ziehen mussten, die am Rande von Bielschowitz standen, weil ihnen auch das Geld für die Miete fehlte. Die in diesen Baracken lebten waren gebranntmarkt, aus diesem Abstieg wieder herauszufinden war sehr, sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Sie wurden als asozial angesehen. Auch unter uns Kindern. Es spielten sich oft schreckliche Szenen ab. Die Männer schlugen Ihre Frauen bis diese wieder verschwunden waren. Ihre harten Fäuste schlugen wie Schmiedehämmer auf sie ein. Da half auch die wöchentliche Beichte der Männer vor Gott, um Vergebung, die sie letztendlich immer von ihren Beichtvater bekamen, den Frauen und ihren Leiden nicht viel. Not und Leid der betroffenen Familien, die bei dem geringen Lohn der Bergleute ohnehin schon in dürftigen Verhältnissen lebten, war unbeschreiblich groß. Aber Vater war Gott sei Dank immer für unsere Familie da. Ich habe nie gesehen, dass er Mutter je geschlagen hat. Aber als Kind interessierten mich diese Schicksale wenig, für mich waren die Süßigkeiten wichtiger. Es war eben so wie es war, wir waren doch glücklich. Unser Leben war schön, sehr schön.
Doch es bleibt nicht mehr lange schön, da der Krieg ausbrach. Im Juni 1914 begann er, er sollte für alle ein großer Krieg werden, er bekam später den Namen „der 1. Weltkrieg“. Weil die ganze Welt sich mehr oder weniger an ihm beteiligte. Es kam die allgemeine Mobilmachung. Die meisten Männer wurden Soldaten. Soldaten kämpfen für einen Herresführer, einen König oder einen Kaiser, denen die wenigsten von ihnen je begegnet sind, ihn nicht einmal kannten. Geschweige das sie wußten um was es für sie hier eigentlich geht. Sie gehorchen aber. Sind es Narren, oder was sind sie, das sie so blind gehorchen können. Viele von ihnen zogen sogar mit Hurra in diesen Krieg. Vater nicht. Für fast alle von ihnen war es ein Hurra auf nimmer wieder sehen.
Für unsere Familie begann der 1. Weltkrieg am 3. August 1914. An dem Tag wurde unser lieber Vater in diesen sinnlosen Krieg eingezogen. Natürlich erinnere ich mich noch, wie Vater mit dem Zug ins Nirgendwo abtransportiert wurde, als wir ihn in Hindenburg am Bahnhof verabschiedeten. Es war sehr traurig. Für mich, damals erst 7 Jahre, war es jedoch noch nicht bewusst, was dies für unsere Familie, für unsere Zukunft bedeuten würde. Wir Kinder waren doch glücklich, in unserer Idylle von Bielschowitz. Die Väter wurden eingezogen, an die Front, die Front war weit weg. Die einzigste Verbindung für uns zur Front, zu unseren Vätern, waren Briefe und Telegramme. Bis zum September wurde Bielschowitz vom Krieg ja noch verschont, ab dann erinnerten die Todesanzeigen der gefallenen Soldaten jeden daran, dass der Tod auch in unserem idyllischen Dorf reiche Ernte halten sollte. Schon am 7. September, als einer der ersten Kriegstoten, fiel unser Vater in Frankreich. Dort liegen seine Gebeine für immer, irgendwo in einem Loch verscharrt. Wenn überhaupt. Fern von seiner Heimat. Fern von uns. Ich weiß noch als wäre es wie heute, als der Postbote kam und das Telegramm vom Kriegsministerium brachte. Sonst war es immer ein freudiges Ereignis, wenn man Post bekam. Aber dies sollte sich im Verlauf des 1. Weltkrieges schnell ändern. Der Postbote hatte immer mehr Telegramme und weniger Briefe auszutragen, je länger der Krieg dauerte. Er brachte mit dieser Nachricht Schmerz und Schrecken in die jeweiligen Familien. In Bielschowitz gab es zum Ende des Krieges keine Familie mehr die nicht ein Opfer zu beklagen hatte. Wie gesagt, uns traf es als erste hier. Mutter weinte wochenlang. Sie sagte immer wieder unter Tränen, Alfons wollte nicht in diesen Krieg, der nicht sein Krieg war. Aber es herrschte ja Kriegsrecht und Wehrdienstverweigerung gab es nicht. Entschloss man sich doch zu diesem Schritt, wurde man, ohne mit der Wimper zu zucken, erschossen. Oder man musste fliehen. Aber wohin sollte Vater fliehen, er hatte eine Familie. Der Krieg hat das Leben eines 32 jähriger Mannes, der in der Blüte seines Lebens stand, einfach so genommen. Und wofür? Und wer fragt jetzt schon oder noch, Alfons wofür bist Du gestorben, was hatte dein Tod für einen Sinn gehabt, was hat er bewirkt? Was hätte dieser Mann noch gutes in seinen Leben leisten können. Der Krieg hat unser Eltern ihrer Liebe beraubt, denn ich glaube sie haben sich sehr geliebt. Der frühe Tod unseres Vaters war nicht nur für Mutter ein riesiger Schmerz, nein, für die Familie fehlte über Nacht der Ernährer und das sollten wir bald zu spüren bekommen. Am Anfang wurden wir noch vom vielen Leuten im Dorf unterstützt. Den Umstand zu verdanken, und das trifft leider zu, dass einige in Bielschowitz zu Beginn des ersten Weltkriegs sich vorübergehend von der weit verbreiteten Kriegseuphorie für Kaiser, Volk und Vaterland anstecken ließen. Die jedoch nicht von langer Dauer sein sollte. Ich bin überzeugt, dass die meisten gar nicht wussten, um was es in diesen Krieg eigentlich ging. Wir Kinder schon gar nicht. Wir waren viel zu dumm, um den tödlichen Ernst zu begreifen. Für uns war Krieg nur ein Wort, mit dem wir nicht viel oder gar nichts anfangen konnten. Wenn überhaupt konnten wir Krieg mit der jährlichen Schlacht gegen die Stare in Verbindung bringen, die versuchten die Kirschen oder Birnen im Garten zu fressen. Hier verbrachten wir oft Stunden damit, sie zu verjagen. Es war aber meist ein aussichtsloser Kampf, da die Stare warten konnten und wir irgendwann schlafen mussten.
Krieg, was ist eigentlich Krieg? Das erste, was ich bei jedem Krieg bezweifle, von dem ich aus den letzten hundert Jahren weiß, ist, dass dort jemals für die Sache derjenigen gekämpft wurde, die in den Krieg zogen. Krieg ist ja nur ein Wort. Es wurde ja auch schon unendlich viel über ihn geschrieben. Aber, oder, auch unendlich wenig. Diese Bücher füllen Regale. Man kann ihn zwar beschreiben, man kann seine Entstehung analysieren, seine grausamen Auswirkungen zeigen, aber begreifen kann man ihn nicht. Denn im Krieg wird jeglicher Verstand der Menschheit außer Kraft gesetzt. Da spielt die Bildung des einzelnen in der Masse, kaum eine oder sogar keine Rolle. Es gibt ihn immer wieder, er kommt immer wieder, er ist immer wieder da, als Krieg. Wie das Unkraut auf den Feldern. Die Menschheit wird wohl nie in der Lage sein, ihn zu verhindern oder in die Geschichte zu Verbannen. In dieser Welt geht es um Macht oder Geld. Der Mensch tut doch wirklich alles um soviel wie möglich davon zu bekommen und schreckt dabei vor Nichts zurück. Der Krieg ist dabei nur die Spitze des Eisberges. Ich glaube dies galt für jeden alten Krieg von gestern, genau wie es für jeden neuen Krieg von heute und morgen gelten wird.
Je länger dieser 1. Weltkrieg dauerte, wir waren ja nicht mehr die einigste Kriegsopferfamilie, ließ die Unterstützung, genauso wie die Kriegseuphorie, immer mehr nach. Es hatte nun jeder mit sich selbst zu tun. Es wurde alles immer knapper. Kaum noch Brot, kaum noch Heizmaterial. Hilde und ich mussten nun von Vater den Kaninchenbestand übernehmen und versorgen. Er hatte ca. 40 Kaninchen. Wer einmal Kaninchen gezüchtet hat, weiß was das für eine schwere Arbeit ist, zumal ich erst 7 Jahre war. Ich musste mit Hilde, die damals auch erst 9 Jahre war, lernen Gras zu mähen, und Heu zu trocknen. Es war wichtig für die Kaninchen neben den täglichen Fressen für einen entsprechenden Wintervorrat zu sorgen. Im Herbst gingen alle auf die abgeernteten Getreide- und Kartoffelfelder und sammelten Ähren und Kartoffeln, um für die Tiere genügend Winterfutter zu haben. Aber ich glaube, Hilde und mir hat es irgendwie Spaß gemacht. Paul war 15 Jahre und arbeitete in der gleichen Grube wie Vater. Er bekam eine Lehrstelle als Bergbauelektriker. Paul war sehr gut in der Schule, deshalb wurde ihm nach Schulabschluss diese Stelle von der Grubenleitung angeboten. Vielleicht aber auch nur aus Mitleid wegen Vater. Wichtiger für uns war aber, dass Paul Deputatsteinkohle bekam. Jetzt konnte unser Küchenherd, der Tag und Nacht, Sommer wie Winter, brannte, nicht mehr ausgehen. Auf Ihn wurde gekocht, hier wurde warmes Wasser zum Waschen bereitet und er spendete, wenn es kalt war, Wärme. Damit brauchten wir auch nicht mehr, wie viele anderen im Dorf, auf den aufgeschütteten Halden nach minderwertiger Kohle suchen. Keine Arbeit auf der Grube hieß, keine Deputatkohle, egal ob Krieg war. Nur wenige im Dorf hatten noch das Geld um die immer teuerer werdende Kohle zu bezahlen. Für die meisten langte es ja kaum noch um sich etwas zu essen zu kaufen. Zu Paul hatte ich nicht den Kontakt den man zu einem Bruder haben sollte. Erstens war der Altersunterschied schon ziemlich groß und bedingt durch seine Lehre war Paul ja auch kaum noch zu hause. Wenn dann meist um zu schlafen. Er hatte, auch verständlich, andere Interessen als wir. Er zog viel mit seinen Kameraden herum und hielt sich viel in diesen Freundeskreis auf. Auch hatte er schon eine Freundin, die Elfriede Nagel. Nagels wohnten zwei Häuser weiter, rechts von uns. Sie war sehr nett. Alle konnten sie gut leiden und sie war im Gegensatz zu Paul oft Gast in unserem Haus. Sie sollte bis zu Pauls frühen Tod seine einzige große Liebe bleiben. An seinen Tod wäre Elfriede fast zerbrochen. Elfriede heiratete späte, drei Jahre nach Pauls frühen Tot, einen gewissen Korus, den ich nicht kenne. Es war aber nur eine Vernunftehe, wie mir Hilde später einmal schrieb. Adelheid war damals 14 Jahre und hatte eine Lehrstelle als Hauswirtschaftsfrau in Hindenburg bekommen. Sie wohnte in der dortigen Hauswirtschaftsschule im Internat. Da das Geld für eine Fahrt nach Hause oft fehlte, konnte sie uns nur noch selten besuchen. Sie war sehr ruhig, arbeitete bei ihren wenigen Besuchen meist im Haus. Im Grunde genommen bemerkte man sie kaum, im Gegensatz zu Hilde und mir. Mutter sagte oft, wir sollen nicht so rumtollen. Aber eins muss man sagen, Adelheid hatte goldene Hände, sie konnte sehr gut nähen und hatte dazu noch einen guten Geschmack. Das war für uns von großem Vorteil. Sie nähte eigentlich für die ganze Familie die Sachen. Vater hatte Ihr zum 12. Geburtstag eine Singer Nähmaschine geschenkt, welche ihr ganzer Stolz war. Sicher hat er damit auch Ihr Talent gefördert. Wenn sie uns besuchte, brachte sie Paul und mir meist eine Hose oder ein Hemd mit. Mutter und Hilde bekamen ein Kleid oder eine Schürze. Dies nähte sie im Internat der Hauswirtschaftsschule. Stoffreste gab es dort zu genüge. Adelheid sagte, dass diese sowieso nur weggeschmissen werden. Leider waren Ihre Besuche nicht so häufig, aber wenn sie kam war die Freude groß. Ich glaube, für Adelheid war es jedes Mal der Lohn für Ihre Arbeit, wen sie unsere Freude und Begeisterung für die mitgebrachten Sachen erleben konnte. Man sah den Stolz in ihren Augen. Es waren nicht nur Sachen schlechthin, nein sie waren sehr modisch. Mutter wurde oft gefragt, wo wir die schönen Sachen her haben. Wenn sie es Adelheid sagte, war sie noch stolzer.
Das zweite Ereignis neben Vaters Tod, was mir dieser September 1914 brachte, war meine Einschulung in die Volksschule von Bielschowitz. Wir waren, glaube ich, so 35 Schüler des Jahrgangs 1907. Für Bielschowitz eine stolze Zahl, zumal es gerade einmal 1700 Einwohner hatte. In diesen Kriegsjahren dürfte sich die Geburtenrate garantiert noch einmal sprunghaft erhöht haben. Fast jeder Heimaturlaub in Bielschowitz endete mit einer Schwangerschaft und der Geburt eines neuen Erdenbürgers. Diese Kinder wurden alle auf einen kurzen Fronturlaub gezeugt. Schnell, zwischen zwei großen, wichtigen Schlachten. Die zweite Schlacht überlebten die meisten Zeuger nicht mehr. Somit waren die meisten der Frauen zum Kriegsende Witwen und ihre Kinder logischerweise Halbwaisen. Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich zumindest die ersten Jahre nicht gern in die Schule gegangen. Mir machte lernen eben am Anfang keinen Spaß. Ich wollte lieber mit Hilde rumtollen. Außerdem mussten die Aufgaben im Haushalt erledigt werden. Aber was soll es, in die Schule gehen war Pflicht, man kam nicht drum herum. Ich will nicht sagen, dass ich ein Musterschüler war, ich war eben Durchschnitt. Mal besser, mal schlechter, so wie ich grade Lust hatte. Ich hatte auch noch das Pech oder Glück, jenachdem wie man es nennen soll, den Lehrer von Paul zu haben. Paul war ja wie schon gesagt ein sehr guter Schüler. Und das hat mir Lehrer Schrull ständig wissen lassen. Bis ich mich daran gewöhnt hatte, hat es mich sehr gestört und geärgert. Aber ich will mich nicht beschweren, dafür haben meine Mitschüler und ich natürlich auch Lehrer Schrull manchen Streich gespielt. Zugute halten muss ich Herrn Schrull, dass er seine Schüler nicht zur Kriegseuphorie erzogen hat. Dies war an deutschen Schulen nicht selbstverständlich, eher die Ausnahme. Gab es unter den Lehrern doch genügend mehr oder weniger fanatische Anhänger für Kaiser, Volk und Vaterland, aber auch genauso leuchtende Ausnahmen, die gerade aus der heutigen Sicht der Geschichte heroisch erscheinen. Wie unser Lehrer Herr Schrull. Ich denke, er versuchte sein bestes, sein Wissen an uns zu vermitteln und in Nachhinein betrachtet blieb relativ viel hängen. So vergingen die Kriegsjahre in Bielschowitz für Hilde und mich sprichwörtlich wie im Fluge. Wir gingen in die Schule. Wir versorgten die Kaninchen und Hühner. Wir unterstützten Mutter im Haushalt. Wir spielten und tollten. An der Front starben die Väter.
Dann kam der 1. November 1918 und der 1. Weltkrieg war zu ende. Wir verstanden als Kinder nicht warum er auf einmal aufgehört hatte. Genauso wenig verstanden wir warum er vor Jahren angefangen hat. Aber wir verstanden die Auswirkung eines Krieges auf alle Menschen, auch in unserem Alter schon sehr genau. Alles atmete auf und hoffte auf Besserung. Aber gebessert hat sich wenig. Der Erste Weltkrieg forderte fast zehn Millionen Todesopfer und etwa 20 Millionen Verwundete. Allzu oft werden in diesen Zusammenhang noch die Opfer vergessen, die durch die weltweit verheerende Epidemie, der sogenannten „Spanischen Grippe“ als unmittelbare Auswirkung des Krieges noch zu beklagen waren. Ich denke vorwiegend ausgelöst durch Unterernährung, mangelnde Hygiene, mangelte medizinische Betreuung und die enormen weltweiten Truppenbewegungen. Die spanische Grippe forderte ca. 20 Millionen Todesopfer.
Also hat die spanische Grippe noch einmal weltweit mehr Opfer gefordert, als der gesamte erste Weltkrieg selbst. Gott sei Dank nicht in Bielschowitz. Viele, auch Mutter, sagten: „Das ist Gottes Gericht!“. Vielleicht hatten sie damit sogar Recht! Im Deutschen Reich leisteten im Kriegsverlauf 13,1 Millionen Mann Militärdienst, davon starben über 2 Millionen. Und so sah die Bilanz dieses Krieges für Bielschowitz aus: Viele Männer zwischen 18 und 40, eigentlich alle, waren tot, in Gefangenschaft oder Kriegskrüppel. Es gab jede Menge Witwen und Kinder die Halbwaise waren. Den wenigen Bauern im Ort wurde im Krieg das Vieh konfisziert, vor allen die Pferde. Ein Pflug ohne Pferd ist nichts mehr wert. Keiner wusste wie er die Felder bestellen sollte. Und die Bilanz dieses Krieges für unsere Familie: Unser lieber Vater war tot, die Bäuche waren weiterhin leer. Mutter war Witwe und wir 3 Kinder Halbwaisen. Das war der Krieg. Außer Leid, Kummer und Entbehrungen hat keiner in unseren Ort einen Vorteil von diesem Krieg gehabt. Gott sei Dank, wir hatten die Kaninchen und Hühner, die uns oft das schlimmste überstehen ließen. Und wir hatten Adelheid, die uns mit Sachen versorgte. Mutter gab ihr bestes um uns durchzubringen. Sie ging in letzter Zeit immer öfter in die Grube, wo sie aushilfsweise als Putzfrau arbeitete und die Büros der Geschäftsleitung reinigte. Es brachte uns ein kleines Zubrot. Die Kohleförderung ging nur noch schleppend voran, weil ganz einfach die Arbeitskräfte fehlten. Es wurden dringend Bergleute gesucht, aber die waren im Krieg gefallen, in Gefangenschaft oder Kriegskrüppel. Neben uns wohnte die Familie Buchwald. Sie hatten 2 Söhne, Max und Franz. Max war so alt wie mein Vater und sein bester Freund gewesen. Er ist Mitte 1918 ebenfalls in Frankreich gefallen. Mutter war oft bei den Buchwalds, einfach um ihr Leid zu teilen oder um einfach zu reden. Der 2. Sohn, Franz, war in amerikanischer Gefangenschaft. Das wichtigste für die Buchwalds war aber, dass er lebte. Mutter sagte uns mal, dass der Franz von den Buchwalds in amerikanischer Gefangenschaft wäre. Aber was amerikanisch oder Amerikaner bedeutete, darauf konnten wir uns damals keinen richtigen Reim machen. Ich glaube meine Mutter wusste es auch nicht so genau. Woher auch? Großbritannien und die Vereinigten Staaten entließen ihre Gefangenen schon im Herbst 1919. Wenn man im Krieg überhaupt von Glück reden kann, so hatte es Franz bei seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft, wie er es später immer wieder betonte. Andere Kriegsgefangene kehrten erst oft nach Jahren, oder gar nicht mehr nach hause zurück. Vor allen die, die in Russland waren. Die Zahl der in Gefangenschaft geratenen Soldaten konnten nie ganz exakt beziffert werden, aber sie beläuft sich auf mindestens sieben Millionen, wahrscheinlich eher acht bis neun Millionen, bei insgesamt rund sechzig Millionen Kriegsteilnehmern weltweit, also über zehn Prozent aller Mobilisierten. Die größten „Gewahrsamsmächte“ waren das Deutsche Reich (wo 2,5 Millionen Gefangene der Entente-Staaten interniert waren, 57 Prozent von ihnen Russen), Russland mit 2,4 Millionen Gefangenen (überwiegend Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee) und Österreich-Ungarn mit 1,9 Millionen (größtenteils Russen). In französischer und britischer Gefangenschaft befanden sich bei Kriegsende 350.000 beziehungsweise 328.000 deutsche Soldaten. Das sind Zahlen die ich im nachhinein rausgefunden habe als ich mich mit der Geschichte des 1. Weltkrieges näher befasste. Franz fing nach seiner Entlassung sofort wieder in der Grube als Bergmann an zu arbeiten. Franz war noch Junggeselle und nicht dazu verurteilt, es zu bleiben. Man merkte es, denn Mutter und er waren jetzt sehr viel zusammen. Zur Silvesterfeier 1919/1920 offenbarten uns beide gemeinsam, dass sie dieses Jahr heiraten werden. Keine so gute Offenbarung für uns Kinder, wir waren jedenfalls nicht so begeistert. Trotz allen heirateten sie 1920, und Mutter bekam von Franz einen Sohn, den sie Alfons nannte. Bestimmt in Erinnerung an Vater. Mein Verhältnis zu Franz war anfangs nicht so besonders. Er konnte niemals Vater ersetzen. In diesem Jahr, ging glaube ich meine Kindheit von Tag zu Tag immer mehr zu ende. Das Leben in unserem Haus und in der Familie hat sich verändert. Ich kann es schlecht beschreiben aber es wurde irgendwie kälter. Obwohl Franz sich um uns bemühte. Aber wer schon mal ein Elternteil durch Tod oder Scheidung verloren hat, wird wissen wie schwer es ist, sich als neuer Partner zu integrieren. Vor allen bei den Kindern. Man wird mit einer Messlatte gemessen, die man schwer erfüllen kann. Hilde, Adelheid und Paul hatten ähnliche Gefühle. Paul hatte seine Lehre mit sehr guten Ergebnis beendet und ist im Laufe des Jahres zu Elfriede gezogen. Mutter hatte nichts dagegen. Da nun Adelheid noch seltener kam, waren nur noch Hilde, ich und Stiefbruder Alfons als Kinder im Hause. 1920 hatte Hilde ihre Schule mit sehr guten Ergebnissen beendet, bekam aber leider keine Lehrstelle. Wer wollte in so harten und unsicheren Zeiten noch Lehrlinge ausbilden, noch dazu ein Mädchen. So musste sie also noch zu hause bleiben und ich war sehr froh darüber. So konnten wir 1 Jahr lang noch viel gemeinsam unternehmen.
Weit ab, sollte dieser Krieg einen weiteren Schicksalsschlag für uns bereithalten, unsere Familie nicht in Ruhe lassen und vor neue Probleme stellen. Die Siegermächte des Krieges beschlossen den Vertrag von Versailles von 1919. Und der hies für Schlesien nichts Gutes ahnen:
Der Vertrag von Versailles trat am 10. 1. 1920 in Kraft und sah für Oberschlesien eine Volksabstimmung vor. In Schlesien hatte am 11. 2. 1919 die „Interalliierte Regierungs- und Plebiszitkommission“ unter dem französischen General Le Rond in Oppeln die Verwaltung des Abstimmungsgebietes übernommen, welches von französischen, italienischen und englischen Truppen besetzt wurde. Im August kam es im Industrierevier zu Polnischen Aufständen. In Bielschowitz musste man diese Entwicklungen mit Sorge beobachten. Auch, dass in den Grenzregionen bei den zahlreichen Übergriffen der Polen auf Deutsche, die Franzosen beide Augen zudrückten, im umgekehrten Fall bei Gegenreaktionen der Deutschen aber hart durchgriffen. Italiener und Engländer hielten sich hingegen strikt neutral. Inzwischen eroberten die Polen mit französischer Hilfe kriegerisch in ihrem Osten weite Teile von Litauen mit Wilna, Weißrussland und der Ukraine über die ihnen zugestandene „Curzon-Linie“ hinaus. In dem Gebiet zwischen „Curzon-Linie“ und der neuen polnischen Ostgrenze gab es 6 Millionen Ukrainer und Weißrussen, 1,4 Millionen andere wie Litauer, aber nur 1,5 Millionen Polen! Auch das wurde in Bielschowitz mit Sorge gesehen. Sollte es im Osten keinen Frieden geben? Am 20. 3. 1921 kam es in Oberschlesien zur Volksabstimmung. Das Abstimmungsergebnis war trotz vorhergegangenen polnischen Terrors ganz eindeutig. Für den Verbleib bei Deutschland wurden 59,6 % Stimmen abgegeben, für Polen waren es 40,4 %! In Bielschowitz wurde das mit Befriedigung aufgenommen. Aber auf alliierter Seite wurde eine Teilung des Abstimmungsgebietes beschlossen. Da man sich auf eine Teilungsgrenze nicht einigen konnte, wurde der Völkerbund angerufen. In der Zwischenzeit begann eine polnische Insurgentenarmee am 3. 5. 1921 den dritten Aufstand. Sie besetzte unter ihrem Führer Albert Korfanty in Oberschlesien den ungefähren von Polen geforderten Teil. Da die französischen Truppen, im Gegensatz zu den italienischen, die Polen nicht aufhielten, stellte sich diesen der deutsche „Selbstschutz Oberschlesien“ entgegen und schlug am 21. 5. 1921 die Polen am Annaberg.
Dieser Sieg half aber nicht viel. Ein Teil Oberschlesiens („Ostoberschlesien“ oder Oberschlesisches Industriegebiet) (mit 90 % der Kohle- und Eisenerzvorkommen und den wirtschaftlich bedeutenden Bergbauregionen) wurde aber doch auf Beschluss des Völkerbundes am 10. Oktober 1921, trotz Volksabstimmung, Polen zugeschlagen. Bielschowitz wurde 1922 polnisch, wir wurden vertrieben und mussten nach Hindenburg umsiedeln. Keiner der Bielschowitzer verstand diese Aktion, denn wer war damals schon in der Lage, die große Politik zu enträtseln, wir Kinder oder Jugendliche schon gar nicht. Es war klar, dass dies nicht ohne Widerstand ablaufen würde. Wer gibt schon sein Heim freiwillig, aufgrund einer politischen Entscheidung, die er weder kannte, geschweige verstand, auf. Diese Aktion war wieder Keimzelle für Hass. Deutsche auf Polen. Polen auf Deutsche. Deutsche auf Franzosen. Franzosen auf Deutsche. Ukraine auf Polen. Litauer auf Polen. Die Ursache lag sicher in dieser blödsinnigen, unsinnigen politischen Entscheidungen des Vertrages von Versailles, die mit einem Federstrich irgendwo in einem sauberen Büro, von wichtigen Politikern, getroffen wurde. Dieser Federstrich besiegelte das Schicksal von hunderttausenden von Menschen und hinterließ nichts als Chaos und Hass und war sicherlich wieder Nährboden für die, die gerne einen neuen Krieg wollten. Er warf dafür, bewusst oder unbewusst, die dazu notwendige Saat aus. Einen Krieg kann man nur mit der Masse des Volkes führen. Hierfür muss man die Massen gewinnen, mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln. Hier wurde ein Mittel von außen geliefert: Hass. Jedenfalls sah ich Bielschowitz nach der Umsiedlung in meinen Leben nie mehr wieder. Aber Bielschowitz hatte mir, trotz aller politischen Wirren, eine wunderschöne Kindheit beschert. Hier sind meine Wurzeln, hier sind meine Erinnerungen an Vater, Mutter, Hilde, Adelheid und Paul zu hause. Und es sind schöne Erinnerungen für mich. Meinen Eltern gelang es, uns eine sehr glückliche Kindheit zu bereiten. Der Wald, Garten, Hof und Felder waren für uns immer eine Art Heiligtum. Es war einfach ein Stück Geborgenheit. Diese Jahre erlebte ich als etwas einzigartiges, ein Abenteuer oder großes Geschenk, so empfinde ich es heute. Die Erlebnisse und Ereignisse während und nach dem 1. Weltkrieg hatten auf meine weitere Entwicklung großen Einfluss, auch wenn ich sie nur als Kind bzw. Jugendlicher erlebte. Sie brannten sich sozusagen in mein Gehirn ein. Kurz vor unserer Umsiedlung, Anfang 1921, beendete ich die Volksschule von Bielschowitz mit eher mäßigem Ergebnis. Eine Lehrstelle bekam ich leider auch nicht. Dafür fand ich im Mai 1921 sofort eine Beschäftigung auf der Wolfgang-Grube, als jugendlicher Bergarbeiter, im Alter von 14 Jahren. Denn wie schon gesagt, Arbeitskräfte waren rar. Hier arbeite ich ungefähr 5 Monate, bis zur endgültigen Umsiedlung nach Hindenburg. Dort wurde ich aber sofort wieder als jugendlicher Bergarbeiter in eine Grube mit gleichen Namen übernommen. Am ersten Arbeitstag, den 9. Mai 1921, versammelten sich um 6.00 Uhr morgens, etwa 15 jugendliche Bergarbeiter am Werkstor, es waren alle Abgänger von meiner Schule. Wir waren alle sehr aufgeregt. Pünktlich um 6.00 Uhr kamen 4 Obersteiger. Wir wurden in 4 Gruppen aufgeteilte, ich kam in die Gruppe von Obersteiger Schröder. Als erstes führte er uns in die Umkleideräume (Kaue, so werden sie von den Bergleuten genannt), mit Weißkaue, Schwarzkaue und Nasskaue. Bevor ihr unter Tage einfahren werdet, begebt ihr euch in die Kaue, um euch umzuziehen. Ihr als Bergleute zieht eure Alltagskleidung an Seilen unter die Decke der Weißkaue. Dann zieht eure Bergmannssachen in der Schwarzkaue an. Zu eurer Ausrüstung gehören Unterwäsche, ein Arbeitshemd, Socken, der Grubenanzug, Sicherheitsschuhe, ein Halstuch, ein Ledergürtel, der Grubenhelm, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsbrille und Staubmaske. Nach dem Umziehen geht in die Lampenstube, um die Grubenlampen abzuholen. Wenn ihr von der Arbeit zurückkommt, geht zuerst in die Schwarzkaue. Dort zieht ihr euch die dreckigen Sachen aus und zieht diese wieder mit Seilen unter die Decke. Duscht und wascht euch mit spezieller Seifen, sie liegt hier, in der Nasskaue. Der Kohlestaub wird euch ganz schmutzig machen. Zum Schluss oder als letztes zieht ihr euch wieder eure Alltagssachen in der Weißkaue an. Obersteiger Schröder zeigte noch jeden seinen persönlichen Seilzug in der Schwarz- und Weißkaue mit entsprechender Nummer. Wenn ihr die Sachen aufgehängt habt, schließt ihr das Schloss ab und hängt euch den Schlüssel um den Hals. Merkt euch die Nummer gut, sonst habt ihr Probleme eure Klamotten wieder zu finden und müsst nackt nach hause. Als er das sagte schmunzelte er leicht. Das war unsere Einweisung für Umkleiden und waschen, kurz und bündig. Danach ging’s in die Kleiderkammer, um unsere Arbeitssachen zu empfangen. Bei mir dauerte es ein bisschen länger, um die passenden Sachen zu finden. Zum damaligen Zeitpunkt war ich noch ein eher etwas kleinerer Bergmann. Weiter ging es ins Personalbüro, wo jeder seine Stechkarte bekam. Sie war schon fertig, weil wir uns ja schon vor längerer Zeit beworben hatten, und da unsere Personalien angeben mussten. Obersteiger Schröder führte uns wieder in die Kaue, zieht euch um, in einer halben Stunde fahren wir ein. Vergesst eure Stechkarte nicht! Jeder zog nun zum ersten Mal seine Bergmannskluft an. Wir mussten uns alle zum ersten Mal im Leben vor fremden nackt ausziehen. Irgendwie war es allen peinlich, aber keiner wollte es sich anmerken lassen. Man tat so als ob es etwas Selbstverständliches wäre. Jetzt musste man seinen persönlichen Bügel mit dem Seilzug nach unten befördern, seine Sachen daran aufhängen und wieder nach oben ziehen. Danach das Schloss abschließen und sich den Schlüssel umhängen. Ich dachte mir noch, nicht schlecht gelöst. Hier muss ein Dieb schon mit Leiter kommen. Wir gingen alle, laut über unsere ersten Erlebnisse als Bergarbeiter erzählend zum Förderschacht, der Einfahrt zum Schacht. Obersteiger Schröder wartete schon. Für euch das wichtigste, hier stecht ihr eure Karte in die Stechuhr, und steckt sie in den Stechkasten. Ja nicht vergessen. Denn so weiß man sofort wer unter Tage ist. Und das kann wichtig sein, falls mal ein Unglück passiert. Es gibt 2 Stollen. Einer in 340, einer in 640 Tiefe. Wir fahren jetzt in Stollen 2, also auf 640 Meter. Die Sprache unter Tage ist für jeden Kumpeldeutsch. Die Bergleute nennen sich untereinander Kumpel. „Glück Auf“, dies ist der Gruß der Bergleute. Falls ihr das noch nicht wisst. Alle stempelten und steckten die Karten in den Stechkasten. Wir gingen in den Förderkorb, mit einem mulmigen Gefühl. Jeder sagte „Glück Auf.“ Schröder schloss die Tür zum Förderkorb, der sich sofort in Bewegung setzte. Er wurde immer schneller. Mit rasender Geschwindigkeit ging es senkrecht auf 640 m. Der Förderkorb war ringsherum offen, eigentlich nur ein Stahlgerüst mit Stahlboden in Draht gehüllt, welcher an einem riesen langen Stahlseil hing, vom Förderturm aus gesteuert wurde. Bei der Fahrt nach unten tropfte Wasser auf unseren Körper. Es war das Grundwasser, welches hier überall aus den Wänden tropfte. Vater hatte zwar oft von der Grube erzählt, aber wenn man es selbst erlebt ist es doch ganz anders. Auf der Fahrt nach unter passierte man Stollen 1, man nahm es durch einen kurzen Lichtblitz war. Der Förderkorb verlangsamt sich und mit einem Klingeln hielt er in Stollen 2. Wir waren 640 m unter der Erde. Der Förderschacht ging noch etwa 30 m tiefer. Hier konnte sich das Grundwasser sammeln. Es wurde mit riesigen Pumpen abgesaugt. Die mussten immer funktionieren, sonst könnte es hier unten etwas feucht werden. Obersteiger Schröder öffnete den Förderkorb und wir gingen in eine riesige unterirdische Halle. So groß hatte ich es mir hier unten nicht vorgestellt. Es sah aus wie auf einen Bahnhof, überall waren Gleise, und darauf fuhren kleine Elektrozüge von Siemens, Lokomotiven mit Loren. Alle Gleise, egal wo sie herkamen endeten jedoch an diesen Förderschacht. Unser Flöz, wo wir arbeiten werden um Kohle zu fördern, befindet sich etwa 8 km von hier. Wir werden jetzt im Hauptstollen dorthin fahren. Links und rechts gehen die Flöze vom Hauptstollen ab in denen Kohle gefördert wird oder wurde. Die toten Flöze sind mit einem Holzkreuz und einem Totenkopf gekennzeichnet. Geht niemals dort hinein, denn dort haben sich giftige Gase gebildet. Das könnte euer letzter Gang sein, sagte Schröder. Wir stiegen in einen Transportzug. Es saßen jeweils 2 nebeneinander. Der Zug bestand aus einer kleinen E-Lok und 5 Wagen. Vor und hinten saß je ein Zugführer. Der Hauptstollen war wie ein durchgeschnittenes großes Rohr, alle 2 Meter durch bogenförmige Stahlträger gesichert, die so konstruiert waren, dass sie sich bei einem Bergrutsch ineinander schoben, sie funktionierten wie Gleitschienen. In dem Hauptstollen herrschte ein ziemlich starker Windzug, für die Belüftung äußerst wichtig. Der Hauptstollen wurde alle 500 Meter durch riesige Stahltore (Brandschutztore) unterbrochen, diese war zur Brandsicherung installiert. Der Zug musste hier immer 2-mal halten, zum öffnen und schließen der Tore. Dafür hatte jeder Zug 2 Zugführer. Es war schon enorm zu sehen, was der Mensch hier in Laufe der Jahre gebuttelt hat. Der Zug braucht gut eine Stunde bis zum Flöz, wo wir ab jetzt arbeiten sollten. Hier hatte Obersteiger Schröder die Verantwortung. Und es war sprichwörtlich eine riesen Verantwortung, denn er war nicht nur für den Ablauf der Kohleförderung zuständig, nein auch für die Einhaltung der gesamten Sicherheit. Und die ist für alle Bergleute hier unten Lebenswichtig. Er kontrollierte die Aufstellung der Stempel, änderte sie zur Not, achtete auf das richtige Luftgemisch. Er teilte die Bergleute zur Arbeit ein und achtete auf deren richtige Ausführung. Für diesen Posten brauch man viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Unter den Bergleuten herrschte ein raues, aber sehr kameradschaftliches Verhältnis. Zumindest unter Tage konnte sich einer auf den anderen bedingungslos verlassen. Sie waren ja alle aufeinander angewiesen. Fehler konnten hier katastrophale Auswirkungen haben. Wir gehörten jetzt zu ihnen. Schröder führte uns noch 200 Meter in dem Flöz hinein bis zur eigentlichen Kohleförderung. Der Flöz war mit Holzstempel gesichert, die im Abstand von ca. 1 Meter aufgestellt waren. Unsere Aufgabe war die gehauene Kohle vom Flöz in den Hauptstollen zu transportierte. Hier wurde sie in einen Zug mit Loren verladen. An der Kohleförderung angekommen, zeigte uns Schröder kurz, wie diese funktionierte. Eine sehr schwarze, staubige und anstrengende Angelegenheit. Nach kurzer Zeit waren wir kaum noch von der Kohle zu unterscheiden, denn sofort setzte sich deren Staub an unseren schweißgebadeten Körber ab. Außerdem mussten wir die Holzstempel in den Flöz tragen. Eine Arbeit die wir oft in gebückter Haltung verrichteten. Hinzu kann, dass das Luftgemisch dünn und alles sehr staubig war. Die Züge mit den Loren brachten meist die Holzstempel mit und fuhren, gefüllt mit Kohle wieder weg, zum Förderturm. Hier ging’s mit Kohle nach oben und leer oder mit Holzstempeln oder anderen Dingen wieder nach unten. 14.00 Uhr war Feierabend, und wir fuhren in umgekehrter Richtung wieder aus der Grube heraus. Als ich den Förderturm an diesem 9. Mai 1921 verlassen hatte, sah ich die Welt mit anderen Augen. Wie schön war doch die Sonne. Alle sahen Schwarz vom Kohlendreck aus. Wir gingen in die Kaue, zogen uns aus und duschten. Es hat keinen mehr gestört, dass er nackt war. Wir waren alle zu kaputt, um uns noch zu beobachten. Nach der Dusche wechselten wir die Sachen am Seilzug mit Bügel, und verließen alle geschafft so gegen 16.00 Uhr die Grube. Das sollte nun mein Arbeitsalltag werden, an den ich mich erstaunlich schnell gewöhnte. Die harte Arbeit machte mir nicht viel aus. Schlimmer war, dass mir das Tageslicht fehlte. Auch musste ich mich erst an die Rattenplage gewöhnen, die unter Tage herrschte. Diese Tiere fühlten sich hier pudelwohl und vermehrten sich in rasender Geschwindigkeit. Essbare Sachen konnte man auf keinen Fall offen liegen lassen, sie waren in Minutenschnelle weg. Die Bergleute hatten aber eine effektive Methode entwickelt, um diese Rattenplage zumindestens in Grenzen zu halten. Eine Kohlelore stand immer etwas abseits. In ihr wurden Ratten gehalten. Dick und fett gefüttert. Hatten sie sich richtig vermehrt, wurde die Fütterung eingestellt. Irgendwann fingen die Ratten an sich gegenseitig zu fressen. Die letzten drei oder vier wurden dann frei gelassen. Sie fraßen nun mit vorliebe ihre Artgenossen. Es war effektiver als die Giftköter. Die Lore wurde in einem ständigen Kreislauf wieder zur Rattenaufzucht bestückt, für die nächste Generation von Kannibalen. Hilde wartete immer auf mich, wenn ich nach hause kann. Ich musste ihr jeden Tag einen Arbeitsbericht liefern. Ich glaube, irgendwann kannte sie sich dadurch besser in der Grube aus, als ich selbst. Staunend stellte sie immer öfter fest, wie ihr kleiner Bruder sich zu einem kräftigen Burschen entwickelte. Sie konnte im wahrsten Sinne des Wortes zusehen wie ich im Laufe der Zeit, ein richtiges Muskelpaket wurde. Bedingt durch die harte und gefährliche Arbeit unter Tage. Als Kumpel verrichtete ich ja jetzt täglich diese schwere Arbeit. Hilde und mich zog es nachmittags immer öfter in den Park neben der Kirche. Es war ja der Anlaufpunkt der hiesigen Dorfjugend. Jetzt gehörten wir auch hier dazu, denn wir waren keine Kinder mehr. Man stand einfach herum, knetschte, lachte und war eben froh unter anderen jugendlichen Freunden zu sein. Fast alle hier kannten sich ja schon ihr Leben lang. Hier lernte ich Willy Pudlo näher kennen, es entwickelte sich zwischen uns eine Freundschaft. Ich glaube aber, er hat auch ein Auge auf Hilde, mit der er in die gleiche Klasse gegangen war, geworfen. Hilde fand es ganz amüsant. Aber nicht nur Willi hatte ein Auge auf Hilde geworfen, auch Günter Bialas, er spielte immer Harmonika, und war der Musikus in unserer Runde, deshalb erinnere ich mich noch so gut an ihn. Ich würde mal sagen, dass sich Hilde zu einem wunderschönen Mädchen entwickelt hat, sie war 16, nicht zu groß, sehr gute Figur und im Gesicht gut anzuschauen. Außerdem war sie intelligent und immer sehr lustig. Durch die Sachen von Adelheid war sie auch immer sehr modisch gekleidet. Diesen Unterschied sah man schon gegenüber den anderen Mädchen. Ich glaube sie schielten immer etwas neidisch auf Hilde, da sie kaum die Möglichkeit hatten oder haben werden, solche Sachen je zu tragen. Erstens weil ihnen das Geld fehlte und zweitens weil diese nicht zu beschaffen waren. Ihnen eine Adelheid fehlte. Zu hause hatten wir nicht mehr so viel zu tun, weil Franz die Kaninchen und Hühner jetzt versorgte und auch unsere anderen Aufgaben im Haushalt größtenteils übernommen hatte. Dadurch bedingt konnten wir uns sehr viel im Park neben der Kirche aufhalten. Gesprächsstoff Nummer 1 war natürlich die sich anbahnende Zwangsumsiedlung. Alle Jugendlichen waren darüber sehr erbost, und es wurden viele Pläne geschmiedet, um etwas dagegen zu unternehmen. Schließlich beschlossen wir alle gemeinsam den „Selbstschutz Oberschlesien“ beizutreten. Der „Selbstschutz Oberschlesien“ stellte sich mutig den Polen entgegen, um unsere Heimat zu verteidigen. Deren Wegnahme noch zu verhindern. Hilde, Willy und ich nahmen Kontakt zum „Selbstschutz Oberschlesien“ auf. Wir fuhren an meinem ersten freien Tag, in Ihre Zentrale nach Hindenburg. Hier wurden wir sehr freundlich empfangen und unser Beschluss wurde unter Beifall der anwesenden Mitglieder begrüßt. Wir wurden mit Fragen, warum, weshalb, wie viele regelrecht bombardiert. Anschließend gingen wir zum ersten Male in unserem Leben in ein Kino und sahen uns einen Film an. Es ging um einen in den Karpaten lebenden Grafen Orlok, Orlok war ein Vampir, der nachts herumwanderte und Blut von anderen Menschen trank. Der Film hieß glaube ich: „Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens“. Er war so spannend, dass Hilde vor Angst bald in die Hosen gemacht hätte. Wir gingen nach dem Film auch das erste Mal in ein Cafe um unsere aufgebauten Spannungen abzureagieren. Hätten uns über den Film fast tot gelacht. Bezahlt haben wir wohl um die 100.000 RM je Kinokarte, der Kaffee war nicht viel „billiger“. Ein Leib Brot kostete zur damaligen Zeit um die 500.000 RM. Hilde sagte einmal zu mir: „Wenn das so weiter geht, braucht man bald eine Schubkarre um das Geld zu transportieren. In die Hosentaschen passt es schon lange nicht mehr“. In Deutschland herrschte die Inflation, die die Menschen zusätzlich beutelte. Man musste immer aufpassen, dass man sein Lohn irgendwie unter die Massen brachte, am nächsten Tag konnte er schon nichts mehr wert sein. Dann hätte man umsonst gearbeitet. Wir hatten Gott sei Dank Mutter, sie ging sofort mit unseren Geld einkaufen, wenn wir von der Arbeit kamen. Sie kaufte Sachwerte, die konnten nicht verfallen, dass Geld jedoch sehr schnell. Wer dies nicht konnte, aus welchen Grund auch immer, konnte über Nacht sein Hab und Gut verlieren. War ruiniert. Es war eine total verrückte Zeit, wo man über Nacht Millionär werden konnte, für die Million aber, wenn überhaupt, nur ein oder zwei Brote bekam. Kino und Cafe gehörten ab jetzt zu jeder Fahrt nach Hindenburg als Pflichtprogramm dazu, zumal es diese Art Abwechslung in Bielschowitz nicht gab, noch nie gegeben hat. Es war für mich, gerade mal 14, eine unvergleichlich schöne Zeit. Trotz aller politischen Spannungen. Schon 2 Tage nach unserem Besuch beim Selbstschutz Oberschlesien kam ein Herr Beneck des Selbstschutzes aus Hindenburg zu uns und machte aus uns Mitglieder dieser Organisation. Wir Jugendlichen, 12 Jungs und 13 Mädchen, gründeten an diesem Tag den „Selbstschutz Bielschowitz“. Er bestand aber nur noch für 5 Monate. Hilde, Willy und ich wurden zu Kontaktpersonen des „Selbstschutz Bielschowitz“ gewählt. Unsere Aufgabe bestand darin, die Verbindung nach Hindenburg zu halten. Wir fuhren jetzt öfters zu dritt, in meiner Freizeit, nach Hindenburg. In der Zentrale fanden politische Foren statt. Es wurde die sich anbahnende Entwicklung diskutiert. Richtlinien wurden erlassen. Meist sinnlose. Denn die politische Entwicklung, die auf uns alle wie eine Lawine herabstürzte, war nicht mehr aufzuhalten. Sie überholte uns ständig. Mir machte diese politische Arbeit jedoch viel Spaß und zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass ich ein guter Redner und Agitator war. Dieses Talent blieb auch anderen nicht verborgen und sollte mir auf den spätern Weg zu einer politische Kariere von Nutzen sein. Die Zentrale sollte nach dem Umzug nach Hindenburg, zumindest für einige Zeit, meine politische Heimat werden. Das aus Hindenburg mitgebrachte Wissen, musste ich immer in Bielschowitz an die Jugendlichen weitervermitteln. Genauso wie die Filmberichte. Ich glaube zweiteres kam bei der Jugend meist besser an. Trotzdem war die Entwicklung in Oberschlesien irgendwie traurig, weil sie nicht mehr aufzuhalten war. Wir hatten eingendlich nie Probleme mit Polen, die ja auch in Bielschowitz lebten und arbeiteten. Sie hatten auch keine Probleme mit Deutschen gehabt. Wir lebten bis jetzt friedlich zusammen und das, soweit ich weiß, schon über Jahrhunderte. Mit polnischen Kindern zu spielen war genau so selbstverständlich für uns, wie mit deutschen zu spielen. Im Gegenteil, sie lernten spielerisch Deutsch und wir von ihnen Polnisch. Viele Polen waren auch mit dieser Entwicklung nicht einverstanden. Lebten sie doch genau so friedlich und Glücklich in Bielschowitz wie wir. Man sieht dies auch an dem Ergebnis der Volksabstimmung. Viele Polen stimmten für einen Verbleib zu Deutschland. Sie fühlten sich nicht als Ausländer. Außerdem bestand, bedingt durch die gemeinsame Arbeit im Bergbau, zwischen vielen deutschen und polnischen Familien eine enge Freundschaft. Die Nationalität, denke ich, spielte bis zu dieser Zeit keine entscheidende Rolle. Alle waren Oberschlesier und dies seit Jahrhunderten. Und trotzdem kam es zu dieser Entwicklung. Sie entstand nicht hier, sie wurde von außen eingeschleppt, wie ein tödliches Grippevirus. Es konnte sich keiner diesem Virus entziehen, man wurde von ihm angesteckt. Das Zusammenleben veränderte sich. Wir Deutschen sahen die Polen jetzt misstrauisch an, und die Polen uns Deutsche. Viele Freundschaften zerbrachen an diesem Konflikt. Nur wenige haben ihn unbeschadet überstanden. Für fünf Monate war Bielschowitz noch unser Zuhause, unsere Heimat, dann zogen wir mit Sack und Pack nach Hindenburg, in die Einsiedelstraße 10. Bielschowitz wurde auf einmal Ausland für uns. Nichts war mehr so wie es einmal war. Der Preis für den Größenwahnsinn einiger wenigen. Doch die bauten sich von dem Verkauf ihrer todbringenden Kanonen Luxus Villen auf Hügeln und sollen bald als „Hart wie Krupp Stahl“ gefeiert werden. Andere bauten sich Schlösser von diesen „ihren“ blutgetränktem Kriegsgeldgewinnen. Unsere Häuser in der Einsiedelstr. 10 waren jedoch zwei oder dreistöckige Klickerbauten. Durch die Mitte dieser Häuser ging ein riesen langer Flur mit 2 Wasserhähnen. Links und rechts davon waren die Zimmer angeordnet. Auch sie waren hier, wie in Bielschowitz, das Eigentum der Grube. Die Straße war etwa 2 km lang, vollgepflastert mit diesen Häusern und leicht ansteigend. Sie endete in einen Wald. Er war eine aufgeforstete Halde. Hinter dem Wald war ein kleiner Bach, er war die neue Grenze zum Ausland, zu Polen. Vor nicht all zu langer Zeit war für uns die Grenze zu Polen noch weit, weit weg, jetzt haben wir sie quasi vor der Haustür. Das deutsche Reich mit seinen Grenzen beginnt zu schrumpfen, so wie es ein Apfel im Winter tut. Und der Winter hat für Deutschland erst begonnen. Der Wald wurde der neue Treffpunkt von uns Jugendlichen. Wir bauten uns hier einen Tisch mit ein paar Bänken und fanden es schön. Aber er war kein Ersatz für unseren alten Treffpunkt in Bielschowitz, den es nicht mehr gab. Unsere Familie bekam eine vier Zimmerwohnung in der Einsiedelstraße 10 zugewiesen. Links vom langen Flur Küche und gute Stube, rechts Elternschlafzimmer und Kinderzimmer. In dem sehr kleinen Hof befanden sich für je zwei Mietparteien eine Toilette und ein Schuppen in dem die Kohle für den Küchenherd gelagert wurde. Bei so mancher Familie führten diese Zustände zu heftigen Streitigkeiten. In Bielschowitz wäre so etwas undenkbar gewesen. Der Herd brannte, wie in unserem Haus in Bielschowitz, ebenfalls Tag und Nacht und erfüllte auch hier die gleichen Funktionen. Deputatkohle bekamen wir sofort, weil ich in Hindenburg eine Anstellung als Jugendlicher Bergarbeiter in der Wolfgang-Grube (gleicher Name wie die in Bielschowitz) bekam. Genauso wie Franz. Gegenüber zog Willi Pudlo mit seiner Familie ein. Seine Mutter, und 3 Geschwister, Kurt 6 Jahre, Paul 9 Jahre und Lisa 14 Jahre. Der Vater war im Krieg gefallen. Willi war 16 Jahre und arbeitete mit mir jetzt in der gleichen Grube unter dem Kommando von Obersteiger Schijuk. Der Arbeitsablauf in der Grube war der gleiche wie in Bielschowitz. Ich glaube er ist in allen Gruben dieser Erde gleich. Nur der Obersteiger und die Bergarbeiterkollegen waren andere. So vergingen die Jahre 1922 und 1923 in unserem neuen Zuhause mit Inflation, Kino- und Cafebesuchen und der Arbeit im Bergbau. Bei einem der vielen Besuche in der Zentrale des Selbstschutzes erfuhr ich durch Zufall, dass Paul ebenfalls Mitglied dieser Organisation sei. Er hatte sogar an bewaffneten Verteitigungskämpfen am Annaberg teilgenommen. Das wusste ich bis dahin nicht. Hilde und die Eltern auch nicht. War Paul doch mit Elfriede nach Gleiwitz gezogen, so dass kaum noch Kontakt zu ihm aufkam. Während der Verteitigungskämpfe am Annaberg hat er sich als geschickter und mutiger Anführer einen Namen gemacht. Es machte einen als jungen Spund doch irgendwie stolz, wenn man gefragt wird: „Wie heißt Du, Bunzol, ist der Paul Bunzol mit dir verwand und ich antworten konnte, „nee Paul ist mein Bruder.“ Grüß ihn von mir, war dann meist die Antwort, verbunden mit einem Schlag auf den Rücken. Die Grüße konnte ich aber nie ausrichten. Erstens habe ich mir selten die Namen gemerkt, und Zweitens sah ich Paul nur noch wenige Mal in meinen Leben. Das erste mal, es war kurz vor meinem Einsatz in Küstrin. Etwa im September 1923 wurde der „Selbstschutz Oberschlesien“ aufgelöst und ich wurde zur schwarzen Reichswehr geworben. Ein jugendlicher Held könne ich werden, sagte man mir! Gerade als Jugendlicher ist man dem Rausch des Neuen, des Ungewissen, des Abenteuers verfallen. Wer träumt nicht davon? Man will die Gefahren nicht erkennen, sind sie doch zu verlockend.
Als ich mit Paul darüber sprach, riet er mir trotz meiner erst 16 Jahre es zu tun. Mir gefiel der „falsche“ Ratschlag meines Bruders zum damaligen Zeitpunkt recht gut. Stand doch eine Entscheidung in meinem jungen Gehirn noch auf der Kippe. Sein Rat hat mir gefehlt. Er war letztendlich der Auslöser es zu tun. Um ihn nachzueifern? So zu werden wie er? Wie bei den Bewaffneten Verteitigungskämpfen am Annaberg? Mutter und Hilde waren strickt dagegen. Auch sauer auf Paul. Hilde fragte mich noch, ob ich einen Vogel hätte. Überlege einmal, wie alt du bist. Überlege einmal, was dir da alles passieren kann, Alfred, das ist kein Spiel! Aber ich war damals, trotz vieler Warnungen, vielleicht auch weil ich in der Pubertät war und dadurch stur, beflügelt durch Pauls Worte, unbelehrbar. Es war die Sehnsucht nach Abenteuer oder man wollte als Jugendlicher ganz einfach mal raus aus seiner Haut. Als Jugendlicher denkt man schnell, man verwirklicht sich einen Traum. Der Traum sich aber genau so schnell zum Albtraum entwickeln kann, schneller als man es sich vorstellen kann. War für den Beitritt zum Selbstschutz, Bielschowitz und unsere Heimat der Auslöser! So kann ich außer Abenteuerlust für den Eintritt in die schwarze Reichswehr keinen vernünftigen Grund für mich erkennen. In nachhinein fällt es mir schwer eine Erklärung für diesen Schritt zu deuten. Ich hakte ihn ab unter „Fehler, die man nur einmal im Leben macht.“ Willi kam nicht mit, er wollte zwar, aber der Einfluss von Hilde, sie waren mittlerweile ein Paar geworden, auf ihn war schon stark genug, um es zu verhindern. Gott sei Dank! Bis zu meinem Abgang zur schwarzen Reichswehr hat sich am Tagesablauf in Hindenburg nicht mehr viel geändert. Außer das wir in der Wolfgang-Grube in Schichten arbeiteten. Von 6.00 – 14.00 Uhr Frühschicht, 14.00 – 22.00 Uhr Spätschicht und von 22.00 – 6.00 Uhr Nachtschicht. Sonst verbrachten wir den Tag im Wald, in der Zentrale oder wir gingen einfach ins Kino oder ins Cafe. Wie schon gesagt, eher durch Zufall nahm ich im Oktober 1923 am niedergeschlagenen Küstriner Putschxi der Schwarzen Reichswehr teil. Aber das war mir alles zum damaligen Zeitpunkt völlig unbekannt. Auch die 7 anderen Hindenburger Jugendlichen, die im September mit mir zusammen im Auto nach Küstrin gefahren wurden, hatten von den politischen Motiven die hinter dem Putsch standen, nicht die geringste Ahnung. Woher sollten wir dieses Wissen auch haben. Für uns war der Putsch nichts Aufregendes. In Grunde genommen haben wir, außer ein paar kleinen Aufregungen, von der ganzen Sache nichts mitbekommen. Wir waren vor Küstrin untergebracht und mussten am 3. Oktober unsere Waffen wieder abgeben, die wir kurzzuvor, bei unserer Ankunft, erhalten hatten. Damit war der Putsch vorbei, ohne dass er für uns überhaupt richtig begonnen hatte. Nach der Entwaffnung sprach ein Feldwebel, sein Name war Voß, mit jedem, ob wir nicht zur Arbeitsgemeinschaft Rossbach nach Mecklenburg wollten. Die meisten sagten zu, ich auch, denn ich war zu stolz, um nach dieser kurzen Kampfepisode gleich wieder nach hause zu fahren. Voß redete irgendetwas über, er hätte von uns auch nichts anderes erwarte und der Kampf wird weitergehen. So kam ich, mit noch 8 anderen, als Freiarbeiter auf einen „Gutshof irgendwo bei Alt Schwerin“. Nordöstlich vom Plauer See in Mecklenburg gelegen. Hier sollte ich, am Anfang noch unbewusst, die Gelegenheit erhalten 2 Jahre und 2 Monate lang eine Keimzelle des Faschismus zu studieren. Feldwebel Voß wurde unser Arbeitsgruppenleiter. Er wohnte in einem nahe gelegenen Dorf, war dort verheiratet und hatte einen Sohn und eine Tochter. Feldwebel Voß, EK2 Träger des 1. Weltkrieges, war von Kopf bis Fuß Soldat und auf Krieg eingestellt. Sollte dieser Mensch mal keine „Feinde“ mehr haben, so machte er sie sich eben. Irgendwo fand dieser Mensch immer welche. Und wir sollten zu seinem willigen Fußvolk heranwachsen. Seine kleinen Pappsoldaten werden. Das war sicher auch der Hintergedanke zur Bildung solcher Arbeitsgemeinschaften, denn die Bildung von paramilitärischen Organisationen war verboten wurden. Man ließ sich etwas einfallen, um für die Zukunft zu Planen. Die wirtschaftliche Lage war schlecht, Arbeit gab es wenig, und so köderte man genug williges Fußvolk um es zu beeinflussen. Wir, 9 Freiarbeiter, wurden in einen umgebauten Stall auf dem Gutshof einquartiert. Es war sehr spontan, aber die Gegend war herrlich, viel Wald und der herrliche Plauer See. Man konnte viel wandern und baden, wenn man nicht auf dem Feld oder im Stall arbeiteten musste. Und noch einen kleinen Vorteil hatte das Quartier in Alt Schwerin, zumindest für mich, der Gutsherr hatte einige Bücher hier eingelagert. Er dachte bestimmt, die können sowieso nicht lesen, die Bauerntrampel. Trotzdem fragte ich ihn, ob ich seine Bücher lesen dürfte, und er sagte „wenn die Arbeit nicht darunter leide, habe er nichts dagegen.“ Und so las ich das erste Mal in meinen Leben richtig viel. Es war zwar viel Schund dabei, aber auch einige Raritäten von Bebel, Rosa Luxenburg und über den Spartakusaufstand während der Römerzeit. So hat er ungewollt meine Bewusstsein mit Fragen konfrontiert, die ich mir bis zum lesen dieser Bücher nie gestellt hätte. Die Arbeit auf dem Feld und im Stall war zwar hart, aber durch meine Kaninchen- und Hühnererfahrungen hatte ich einen Vorteil gegenüber den anderen, die alle noch nie auf dem Feld arbeiteten, geschweige etwas mit Tieren zu tun hatten. Und da war noch etwas, der wichtigste Grund, der mich hat hier so lange festgehalten. Die Tochter von Feldwebel Voß. Sie arbeitete in der Küche des Gutshofes und wir hatten sofort ein Auge füreinander. Ich fühlte mich sofort zu ihr hingezogen und spürte auch keine Abneigung ihrerseits. Sie war zwar schon 17 Jahre, und hieß Bärbel. Zu jeder Essenszeit sahen wir uns und jeder hatte für den anderen ein Lächeln übrig. „Ohh, die macht mich fertig!“, dachte ich mir. Nicht nur ich hatte ein Auge auf sie, alle hier waren von ihr begeistert. Ihr Gesicht war nahezu perfekt. Sie hatte kurzes mittelblondes Haar, ihr Gesicht war wohl geformt, aus dem lustige blaue Augen schauten. Der Kopf war nicht zu dick und nicht zu dünn, die Anordnung von Mund, Nasse, Ohren, alles stimmte bis aufs I-Tüpfelchen. Wenn sie lächelte, zeigte sie ihre schönen weißen Zähne. Die Schürze, die sie meist trug, lag immer eng an ihren wohlgeformten Körber. Ihre Brüste waren deutlich zu erkennen. Wenn wir uns zum Essen trafen, suchten wir beide die Nähe. Berührten wir uns zufällig, hatte ich das Gefühl, dass Stromstöße durch meinen Körper fahren. Komisch wir berührten uns sehr oft. Alle wollten sie, aber nur ich bekam sie. Wir kamen langsam ins Gespräch, sie sagte mir, sie sei 17. Irgendwann fragte ich sie erst einmal nach ihrem Namen. Ich könne sie Bärbel nennen, meinte sie. Stück für Stück entstand eine richtige Jugendliebe zwischen uns. Am Anfang trafen wir uns immer heimlich am See und gingen spazieren. Vor allem ihr Vater durfte nichts davon wissen. Ich musste ihr vom Bergbau, von Hindenburg, von Hilde, von Vater und Mutter und meinen Freunden erzählen. Ich erzählte ihr von den Kinobesuchen und dem Cafe. Sie war ein williger Zuhörer und ich ein guter Erzähler. War sie doch in ihrem bisherigen Leben noch nie in einem Kino, geschweige in einem Cafe, gewesen. Ihre einzigste Abwechslung waren die Spaziergänge am See, oder im Wald, oder die Arbeit auf dem Gut. Sie erzählte mir auch von Ihrer Familie, die Ihr Vater wie eine Kaserne führte, wo sie die Soldaten sind und er der General. Alles ging streng nach militärischen Regeln zu und wehe man verstieß dagegen. Die Zeit wo sie auf dem Gutshof arbeitet, ist die reinste Erholung. Sie hatte Angst vor Ihren Vater. Alle zu hause hatten Angst und waren froh, wenn er weg war, besonders die Mutter, die er oft schlug. Wann immer wir uns die kommenden Monate trafen, es war für uns nie langweilig oder kurzlebig. Wir konnten das nächste Mal kaum erwarten. Es reifte in uns ein außerordentliches aber unstillbares Liebesverlangen heran, welches sich im Frühjahr 1924 entlud. Sie zog mich auf eine Wiese am Seeufer, setzte mich auf eine Bank und bedeutete mir, sie zu lieben. Ich zögerte einen Moment, dann tat ich es. Sie beugte sich zu mir, dass sich unsere Wangen berührten. Ihr Atem wurde immer schneller. Die Haut glühte, genau wie meine. Sie schloss ihre Augen und das war der Moment um sie zu küssen. Meine Lippen berührten ihren Mund. Ich merkte, dass sie ihre Lippen ein wenig öffnete. Ich merke wie sie innerlich zu glühen anfing und ihre Haut sich veränderte. Sie wollte es, ich wollte es, wir wollten es. Es war für sie das erste Mal und es war für mich das erste Mal. Bärbel stöhnte, nein sie schrie das Glück, die Freude, die Lust aus sich heraus, ich auch. Nur gut, dass wir am See waren und uns keiner hören konnte. Ein unvergesslicher Moment der Erkenntnis und viele Augenblicke reinen Glücks. Als ob alles um uns herum vor Liebesglück seufzte, die Natur, die Menschen, die Tiere, die Bäume, der Himmel, wir haben einfach mitgeseufzt. Jedoch wurde es nur ein kurzes Seufzen. Unsere Liebesspiele brauchten wir beiden ab jetzt wie ein Drogenabhängiger seine Droge. Bekommt er sie nicht, stellen sich Entzugserscheinungen ein. So war es zwischen Bärbel und mir. Trafen wir uns, genossen wir sie ausgiebig in allen Varianten, so oft es unsere Kraft zuließ. Keiner wollte je wieder darauf verzichten. Die Zeit bis zum nächsten Treffen verging für uns unendlich langsam. Wir verlangten einander und es wurde uns nie langweilig. Selbst Regen und Kälte hielten uns nicht ab. Keiner von uns beiden konnte im Voraus ahnen, dass so etwas Schönes und Intensives zwischen uns möglich ist. Diese intensiven Gefühle der Liebe konnte ich später nie mehr so spüren. Zwischen uns stimmte in jeder Beziehung die Chemie, sie war nur auf uns beide abgestimmt. Wenn Feldwebel Voß einmal in seinen beschiessenen Leben etwas gut gemacht hat, dann war es seine Tochter Bärbel, wofür ich ihm heute noch dankbar bin. Aber nur dafür. Voß sollte später im 3. Reich, wie so viele aus der Arbeitsgemeinschaft Roßbach, eine Kariere in der SS beginnen, gerade er brachte viele notwendige Voraussetzungen dafür mit. Er redete ständig zu uns, dass an allem nur die Juden schuld haben. Die Juden sind der Untergang von Deutschland, waren seine ständigen Worte. Wenn ich ihn dann fragte, wo Juden in dieser Gegend sind, die ihm schaden, oder welche anderen Juden es sind, wurde er unsicher und reagierte sehr böse. Ich kenne christliche, deutsche und polnische Familien, keine jüdischen. Juden kenne ich nur aus dem Geschichtsunterricht. Ich kenne keine Juden, sagte ich ihm. Höchstens die Ladenbesitzer in Bielschowitz, aber da weiß ich auch nicht genau, ob es welche sind. Zumindest habe ich es irgendwo mal gehört. Aber sie gaben uns als Kinder manches Stück Schokolade ohne uns dabei zu schaden. Auch wüsste ich nicht, dass ein Jude mir meinen Vater nahm. Dieser Satz war in den Augen von Voß schon ein halber Verrat am Vaterland. Oder was meinen sie dazu Feldwebel Voß? Und ich war mit ihm noch nicht fertig. Schon oft wurde in der Geschichte der Menschheit, meist in wirtschaftlich schwieriger Situation nach einem Sündenbock gesucht. Er von oben nach unten geschaffen und so die eigene Unfähigkeit oder was weiß ich zu vertuschen. Ihm dem Volk so als Fraß vorzusetzen. Meist waren es die Juden, die an allem Schuld sind, aber es gibt auch genug andere Beispiele in der Geschichte! Geändert hat sich dadurch aber nie etwas! Das war zuviel für ihn. Wo in diesen Diskussionen mit ihm meine Argumente herkamen, weiß ich nicht mehr, vielleicht durch die Liebe zu seiner Tochter. Er konnte darauf nichts sagen, weil ihm die Argumente fehlten, oder er ganz einfach zu blöd war. Aber ich merkte bei solchen oder ähnlichen Diskussionen schon, dass er mich nicht leiden konnte, vielleicht sogar hasste. Widerspruch von unten war ihm fremd, den bekam er von den anderen Freiarbeitern nicht. Die lachten höchsten über die Diskussionen zwischen Voß und mir, aber auch nur wenn er es nicht sah. Auch schimpfte er ständig über die Polen, die Deutschland beraubt haben und dafür büßen werden. Auch hier sagte ich ihm, dass es solche und solche Polen gibt. Ich mit keinen Polen jemals ein Problem hatte, im Gegenteil, die die ich kenne wollten diese Entwicklung in Oberschlesien auch nicht. Dies soll aber nicht heißen, dass ich diese Entwicklung Widerstandslos billige. Deswegen ging ich ja zur Reichswehr, jedenfalls glaubte ich es damals noch. Die Diskussionen mit mir überforderten Voß und er konnte sie nur mit Gebrüll und einen gewissen Hass gegen mich beenden. Aber ich hatte Spaß daran, ihn zu kitzeln. Konnte ich ihn, für das was er Bärbel ständig antat, auf diese Art ein bisschen ärgern. Alle auf dem Gut bekamen langsam die Beziehung zwischen Bärbel und mir mit. Aber Gott sei Dank, nicht Voß. Ich war ja auch nur wegen ihr noch hier, sonst hätte ich längst die Zelte abgebaut. 1925, ich war im Mai 18 Jahre alt geworden, sie war 20, beschlossen wir zu heiraten. Wie unsere Wohnung einmal aussehen wird, wie wir glücklich leben werden, was wir alles unternehmen werden und können. Alles haben wir uns erträumt, alles haben wir uns ausgemahlt. Noch nie ist mir eine Entscheidung so leicht gefallen. Bärbel zu heiraten. Ich habe Mutter und Hilde von Bärbel und mir geschrieben, auch von unseren Hochzeitsplänen. Sie wünschten uns viel Glück und freuten sich schon darauf Bärbel kennen zu lernen. Bärbel sich natürlich auch auf sie. Wir schmiedeten gemeinsame Pläne, wenn wir am See lagen und die Sterne beobachteten, vor allem den, nach Hindenburg zu ziehen, um dort unsere Familie zu gründen. Sie wollte ganz einfach raus hier, und freute sich schon riesig. Ende Oktober sagten wir es ihren Eltern. Es war ein unverzeihlicher Fehler von uns. Er läutete das sofortige Ende unserer Beziehung ein. In nachhinein weiß ich, wir hätten abhauen müssen. Aber wer kann schon mit so etwas rechnen? Voß rastete vollkommen aus, und schrie Sie an: „Ich werde dich abkommandieren!“ Danach schmiss er mich, bei sich zu Hause, raus. Ich möchte nicht wissen, was sich dann dort abspielte. Aber ich konnte nichts tun. Bärbel kam nie wieder aufs Gut zur Arbeit, und zu Hause war sie auch nicht mehr. Er hatte seine Worte „Ich werde dich abkommandieren!“ wahr gemacht. Er hatte die Möglichkeiten und vor allem die nötige Unterstützung in der schwarzen Reichswehr, um so etwas durchzuziehen. Er hat sie garantiert auf ein Gut in Pommern oder Masureen „abkommandiert.“ Das schlimme war, ich hatte ihr die Adresse von Hindenburg nicht gegeben. Wir hatten an so vieles gedacht, an das einfachste aber nicht. So konnte sie mir niemals mitteilen wo sie war. Ihre Mutter konnte mir über ihren Verbleib auch keine Auskunft geben, da sie es ganz einfach nicht wusste. Es tut ihr so leid, sagte sie unter Tränen zu mir. Ich hatte mir euer Glück so gewünscht. Weder auf dem Gut, noch sonst wo wusste jemand etwas über Ihr Verschwinden, oder wollte es nicht wissen. Niemals sollte ich wieder ein Lebenszeichen von meiner Jugendliebe Bärbel erhalten, obwohl ich nie aufgab sie zu suchen. Sie war meine erste Liebe. Sie bleibt unvergessen und wenn ich ehrlich bin, bin ich auch heute noch davon besessen. Egal, Bärbel, wo du jetzt bist, ich hoffe dir geht es gut. Es ist ohne dich nicht mehr so wie früher, weil du und ich nicht mehr ein Paar sind. Unsere Zeit ist vorbei, doch ich weiß tief in deinem und meinem Herz sind wir immer noch eins. Damals war ich zu jung, allein und mit der Suche nach ihr überfordert. Mecklenburg war nicht die Stadt, war nicht Hindenburg, hier herrschten noch eigene Gesetze. Alles war von jetzt auf gleich vorbei. Wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, könnte ich es kaum glauben. Mit gebrochenem Herzen kehrte ich im Dezember 1925 in mein Elternhaus nach Hindenburg zurück.