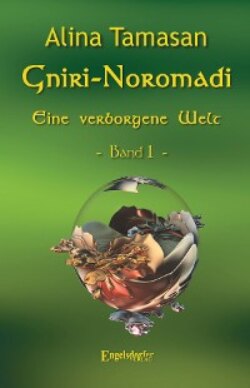Читать книгу Eine verborgene Welt - Alina Tamasan - Страница 5
Auf der Wiese (Rì-thìnia-tuth haas)
ОглавлениеSo sehr sie sich ihre langen spitzen bekrallten Finger auch schrubbte, die braunen Verfärbungen gingen einfach nicht ab. Finilya betrachtete skeptisch ihre sehnigen Hände. Dabei dachte sie an ihre Mutter Irukye, die der Ansicht war, dass nur eine saubere Frau eine gute Frau war. Sie konnte wirklich nichts dafür. Sie arbeitete nun einmal jeden Tag mit Erde, und das, so hatte ihr auch die ortsansässige Heilerin gesagt, sei normal: ‚Die Haut erhält die Farbe dessen, womit du arbeitest.‘
„Ah, was mühe ich mich ab? Es hat doch sowieso keinen Sinn“, murmelte die junge Frau in der Singsangsprache ihres Volkes, einer Spezies von Naturwesen, die sich Gniri nennt. Sie wischte ihre Finger am trockenen Moos ab und fuhr sich durch das Haar. Die schwer definierbare Farbe ihres Haars mit seinen verschieden farbigen Strähnen – auch wieder so etwas, das eine hübsche Gnirifrau im heiratsfähigen Alter nicht haben durfte. Gerade erst vor zwei Tagen hatte ihre Mutter sie dazu überreden wollen, sie sich zu färben. Woher diese schlammige Haarfarbe stammte, das hatte Irukye ihr eisern verschwiegen.
„Finilya, wo bleibst du denn?“ Die junge Frau zuckte zusammen und sah für einen kurzen Moment in ihr erschrockenes Gesicht, das von der Wasserfläche des irdenen Kruges widergespiegelt wurde. Mit einer beiläufigen Bewegung schüttete sie das gebrauchte Wasser, das sie in einer Holzschale für sich abgeschöpft hatte, aus dem Fenster. Draußen machte es laut platsch. Sie richtete kurz ihre großen spitzen Ohren auf und horchte. Als die Stimmen der Beschwerde auslieben, nickte sie und eilte zur Feuerstelle, wo sie sich neben ihrem Vater und ihren zehn Geschwistern niederließ. Inmitten der knisternden Flammen brodelte Suppe in einem Kessel. Aufeinander gestapelte Holzschalen lagen auf der Erde. Finilya verteilte sie schnell. Ihre Mutter fuhrwerkte in einer Ecke des Raums herum, die im Dunklen lag. Aber das machte der alten Frau nichts, auch in ihrem Alter hatte sie noch Augen wie ein Luchs.
„Die Suppe ist fertig“, murmelte sie und trat mit einer Kelle an den Kessel. Sofort hielten ihr alle Familienmitglieder ihre Schalen hin. Irukye befüllte sie nach einem bestimmten System: Zuerst kam ihr Mann an die Reihe, er war das Oberhaupt der Familie, dann waren die Kinder dran, zuerst die Kleinsten. Finilya half, sie zu versorgen. Sie verteilte einen hellen mehligen Brei aus einem Tiegel, den sie von Irukye erhielt.
„Schau, was für ein schönes Mädchen du geworden bist“, lobte ihr Vater Rìa sie stolz.
„Schön?“ Irukye hob skeptisch eine Augenbraue, „wohl eher schön faul, willst du sagen. Eine Tagträumerin ist sie, aber …“, das runzlige Gesicht der alten Frau bekam eine freundlichere Note, „eine Tagträumerin, die einem brauchbaren Mann den Kopf verdreht hat!“ Sie lächelte und leckte sich verschwörerisch über die langen spitzen Zähne. Finilya schüttelte seufzend den Kopf.
„Mama? Was ist da drin?“ Der kleine Pindra war soeben dabei, es heraus zu finden. Irukye konnte gerade noch verhindern, dass er den glühend heißen Kessel anfasste.
„Lass das!“, fuhr sie ihn an und gab ihm eine Backpfeife, worauf der Kleine herzzerreißend zu weinen anfing.
„Naa, nicht weinen“, Finilya nahm ihn in den Schoß und strich sanft über seine nassen runden Wangen, „es gibt lecker Essen!“
„Von wegen Essen! Wieder diese dünne Wurzelsuppe, die wir schon gestern und vorgestern hatten“, hörte sie ihre Schwester Mèfai sagen.
„Sei froh, dass wir etwas haben“, mahnte Finilya ruhig, „andere haben noch nicht einmal das! Außerdem haben wir heute reichlich Zutaten, der Nachbar war sehr freigiebig!“ Rìa seufzte leise, sagte aber nichts. Er war der Ernährer der Familie und was hatte er ihr gebracht? Nichts als Armut, andererseits – so sinnierte der Alte, während er sich durch das graue borstige Haar strich – hatte er seiner Familie, die zunächst noch heimatlos gewesen war, eine Bleibe organisiert: das Geäst einer gesunden jungen Buche, die seine große Familie zwar nur dürftig, aber noch bereitwillig ernährte und beherbergte. Er runzelte die Stirn und seufzte leise. Er war der Heilerin Pythera, die Anführerin des Volkes, zu dem sie gehörten, noch immer dankbar, dass sie ihn, seine Frau und die damals drei Kinder bereitwillig aufgenommen hatte.
‚Drei Kinder …‘, gedankenverloren schweifte sein Blick über seine Sprösslinge und blieb an dem kleinen Pindra hängen, dem Jüngsten. ‚Man sagt, Mutter Natur regle, wie viele Kinder, wann zur Welt kommen. Eine Weile lang wollte ich glauben, dass sie es gut mit uns meint, wenn Irukye wieder schwanger wird, aber …‘, sein Blick wanderte zu der eingefallenen Gestalt seiner Frau, ‚irgendwie verstehe ich sie nicht, die Mutter. Wohlhabende Familien klagen oft über zu wenig Kinder und wir …‘ Der alte Mann senkte betrübt den Kopf. ‚Aber‘, sinnierte er weiter und ein Lächeln erhellte seine Gesichtszüge, ‚ich würde mich schrecklich allein fühlen, ohne sie …‘
Finilya schien seine Gedanken erraten zu haben, denn sie nickte ihm aufmunternd zu. Ihren kleinen Bruder auf dem Schoß haltend, wartete sie geduldig, bis auch Irukye Platz genommen und sich bedient hatte. Finilyas Mutter löste etwas Brei in ihrer Suppe auf, setzte sich die Schale an die Lippen und begann loszuschlürfen. Wann immer ein Stück Wurzel in die Nähe ihrer Zunge schwamm, schnellte diese hervor, umfasste es wie der Frosch eine Fliege und zog es in ihren Mund hinein. Ihr Schlürfen war indes für die anderen das Zeichen, ebenfalls mit dem Essen zu beginnen. Rìa vernahm mit genügsamer Zufriedenheit, wie sich seine Familie schmatzend und schlürfend über die Mahlzeit her machte. Irukye sah ihn stirnrunzelnd an und schob ihm die Schale hin. ‚Iss‘, sagte ihr Blick. Rìa nickte, schob sich langsam einen Bissen Brei in den Mund und leckte sich die dunklen Krallen. Dann spülte er etwas Suppe hinterher. Seine Frau nickte zufrieden und wandte ihre Aufmerksamkeit Finilya zu. ‚Ein Abbild ihres Vaters‘, schoss es ihr durch den Kopf und sie beobachtete, wie ihre Tochter den kleinen Pindra mit mundgerechten Häppchen fütterte, die er gurrend verspeiste.
„Iss was, Kind“, ermahnte Irukye Finilya laut. „Der Kleine muss langsam lernen, selbst zu essen.“
„Ja, Mama.“ Als wollte sie beweisen, dass sie eine brave Tochter sei, nahm sie einen kleinen Schluck von der Wurzelsuppe. Die alte Gniri gab ein entrüstetes Fauchen von sich.
„Nicht nur das, auch von dem Riàt1, iss mehr davon, du bist eh schon so dünn, brauchst mehr Fleisch auf die Rippen, wenn du deinem Kerl den Kopf weiter verdrehen willst!“ Finilya hatte keinen Hunger. Sie hatte eigentlich nie Hunger, nur ab und an Appetit auf bestimmte kleine Genüsse, die sie sich gönnte, wenn sich die Gelegenheit bot – eine kleine Beere hier, eine Nuss dort, am allerliebsten aß sie Feigen, aber die gab es hier nicht. Sie war nur ein einziges Mal in den Genuss dieser Rarität gekommen.
Als vor einiger Zeit Retasso zu Besuch da gewesen war, hatte er welche aus seiner Heimat mitgebracht. Getrocknet schmeckten sie herrlich süß. Finilya liebte Süßes. Bei dem Gedanken an die Köstlichkeit leckte sie sich mit ihrer spitzen langen Zunge genüsslich über die Lippen. Dann schob sie Pindra erneut einen Happen in den Mund und hielt ihm die Schale zum Trinken hin. Irukye bedachte ihre Tochter mit einem strengen Blick.
„Wenn’s sein muss, mache ich es!“, zischte sie und deutete auf Finilyas Portion. Finilya löste widerwillig etwas von dem breiigen Riàt in ihrer Suppe auf und setzte die Schale an die Lippen. Sie schlürfte langsam und kaute bedächtig an den Wurzelstücken, die sie flink mit der Zunge herausfischte. Irukye nickte zufrieden. Als die Mahlzeit beendet war, erhob sich ihre Tochter und nahm ihren kleinen Bruder auf den Rücken.
„Das geht nicht!“, entrüstete sich Irukye. „Du gehst nicht raus, es wird bald dunkel. Außerdem ist er viel zu schwer für dich, gib ihn mir!“ Ohne Widerworte reichte Finilya ihrer Mutter den Kleinen. Seine murmeligen dunkelblauen Augen begannen vor Freude zu glänzen.
„Mama“, gluckste er und streckte seine haarigen Ärmchen nach ihr aus. Kaum, dass sie ihn zu fassen bekommen hatte, krallte sich der Kleine in ihrem dichten Rückenhaar fest. Mit seinen kräftigen Beinchen umklammerte er ihren ebenso behaarten Bauch.
„Was ist denn das?“, rief die Gniri beim Anblick seiner Klauen bestürzt aus, „wir müssen dir die Krallen schneiden! Finilya, warum hast du das nicht getan?!“ Sie sah ihre Tochter groß an.
„Warum muss ich das immer machen?“, brummte diese entrüstet, „er hält nie still, und ich will ihm nicht jedes Mal ins Fleisch schneiden. Du bist kräftiger, das hast du selbst gesagt.“ Finilya bemühte sich, dem strengen Blick ihrer Mutter standzuhalten. Und tatsächlich, wie schon oft vorher, gab Irukye einen einlenkenden Laut von sich und wandte sich anderen Aufgaben zu. Die junge Frau atmete erleichtert auf und blickte versonnen durch das Fenster ihrer Behausung, die auf einem in den Baumstamm eingelassenen Holzfundament ruhte. Sie wollte gerade hinaushüpfen und wie ein Äffchen über Äste und Stamm nach unten klettern, als sie von hinten jemand am Schopf packte. Sie drehte sich um und blickte in das sanfte Augenpaar ihres Vaters, der freundlich, aber bestimmt den Kopf schüttelte.
„Hör bitte auf deine Mutter“, ermahnte er sie leise. Dann zog er sie hinter sich her, bis sie wieder am Feuer saßen. „Ich weiß, wo du hin willst“, brummte er leise. Finilya senkte verlegen den Blick und knetete nervös an ihren langen Fingern.
„Rangiolf ist ein guter Mann, ein Barde mit hohem Ansehen, was deiner Mutter sehr gefällt, aber du bist für eine Ehe auf jeden Fall noch viel zu jung!“ Die Gniri erwiderte nichts darauf. Was wollte sie ihm auch widersprechen? Er hatte ja recht! Sie sah stirnrunzelnd an sich herunter. Sie war ein nacktes Kind, genau wie ihre Geschwister. Einen bunten Rock, wie ihre Mutter, würde sie erst tragen, wenn sie verheiratet war – ja, wenn sie verheiratet war. Irgendwann musste auch eine junge Frau mal heiraten, nicht wahr? Oder würde sie ewig ein Kind bleiben?
Sie mochte es, abends bei ihrem Vater zu sitzen und den Geschichten aus seiner Jugend zu lauschen oder mit ihm über die Arbeiten des nächsten Tages zu beratschlagen. Wenn er sie dann so liebevoll ansah und ihr sanft durch das Haar strich, fühlte sie sich sehr wohl. Es war doch ganz gut, noch ein wenig länger bei der Familie zu bleiben, anstatt sich in einen Mann zu verlieben, den sie sowieso nie haben würde, weil Rìa ihnen keine Mitgift mitgeben konnte! Herzklopfen hin oder her – eins war klar: Sie konnten sich eine Hochzeit, geschweige denn eine Ehe nicht leisten. Andererseits liebte sie den etwas älteren Rangiolf – und das war keine Jungmädchenschwärmerei, wie viele Leute munkelten, sondern ein Argument für sie, welches immer alle Zweifel beiseite fegte, für einige Zeit jedenfalls. So träumte sie auch diesmal, während sie gedankenverloren Rìas knorrige Hand streichelte.
„Ich glaube, du hörst mir nicht zu.“ Lächelnd blickte er sie an.
„Ich kenne deine Argumente, Papa“, erwiderte die junge Frau. „Hast du dir heute schon das Haar gekämmt?“, geschickt wechselte sie das Thema. Der alte Gniri schüttelte den Kopf. Finilya holte seinen Kamm und fuhr ihm damit vorsichtig durchs dichte borstige Haar. Von Moosfasern über Blätter, bis hin zu kleinem Getier, es gab fast nichts, was sich im Laufe eines oder mehrerer Tage nicht darin ansammelte. Seine Tochter bearbeitete Rìas Haar so lange, bis es sauber war. Irukye, die den Boden fegte und die Kinder anwies, sich bettfertig zu machen, schaute verstohlen zu ihnen hinüber.
„So, Papa, fertig“, sagte Finilya und zupfte Rìa das Haar zurecht. „Mama, möchtest du auch?“ Die Gniri winkte mit dem Kamm.
„Ich habe doch meinen eigenen Kamm“, erwiderte Irukye mit einem stolzen Unterton in der Stimme, „außerdem muss mir jemand Pindra abnehmen, sonst geht das nicht! Er muss sowieso ins Bett … Mèfai“, schrie sie in den Schlafraum hinein, „nimm den Kleinen, er muss ins Bett! Wenn er unruhig wird, gib ihm die Brust, ja?“ Finilyas jüngere Schwester kam angerannt und beäugte stirnrunzelnd das kleine haarige Bündel, das an Irukyes Rücken hing.
„Aber, Mama, ich habe doch gar keine Milch, geschweige denn etwas, woran er saugen kann!“
„Fürs Nuckeln reicht’s“, erwiderte ihre Mutter und fuhr mit der Hand sanft über Mèfais drei Brüste, die zwar noch nicht ausgewachsen, aber auch nicht mehr so klein waren, dass sie für solche Zwecke nicht hätten benutzt werden können. Mèfai stieß ein entrüstetes Fauchen aus.
„Warum immer ich? Finilya hat viel größere. Daran kann er saugen!“
„Finilya kämmt mich jetzt, nun gib keine Widerworte, nimm ihn!“ Mit gekonntem Griff packte Irukye ihren Sohn und gab ihn Mèfai. Der Kleine begann erwartungsvoll vor sich hin zu schmatzen. Das Mädchen nahm ihn und trug ihn in den Schlafraum.
„Na, komm“, hörte Finilya Mèfai flüstern, „ich weiß doch, was du willst.“ Sie lächelte Irukye wissend an. Diese leckte sich verschwörerisch über die Lippen und zwinkerte Finilya zu. Dann griff sie in die große Tasche ihrer braunen Schürze und holte einen kleinen, alten schwarzen Kamm hervor.
„Aus Eichenholz“, erklärte sie stolz und reichte ihn Finilya.
„Ich bin müde.“ Rìa gähnte. „Macht ihr beiden nur, ich geh ins Bett.“ Er schlurfte zu den anderen in den Schlafraum. Finilya begann ihre Mutter geduldig zu kämmen.
„Immer noch so dicht wie eh und je“, sagte sie leise.
„Ah, hör auf mir zu schmeicheln, Kind!“ Die Stimme der Alten klang mit einem Mal müde und gar nicht mehr so streng, wie man es von ihr gewohnt war. „Ich werde alt, das ist eben so. Aber du bist ein wunderschönes Kind geworden, nur essen musst du mehr, sonst fällst du mir vom Fleisch … Dieser Rangiolf, der ist gut für dich, gut genährt! Der kann dich füttern! Wenn du es schaffst, ihn zu heiraten, ohne dass wir ihm eine Mitgift geben müssen, bist du eine gemachte Frau, hohes Ansehen wird er dir bringen! Du musst ihn umgarnen, ihm schmeicheln, dann erbarmt sich vielleicht seine Familie. Außerdem munkelt man, dass Pythera ihn mag und ihn deswegen ausbildet! Vielleicht spendet sie dir was für die Heirat. Überleg dir das mit der Haarfarbe noch mal.“
„Mama! Ich werde mir dieses Zeug nicht in die Haare schmieren. Es ist sowieso schon widerspenstig, damit kleistere ich es mir total zu!“
„Ich kämme dich dann. Die Reste kriegen wir raus. Meine Freundin Safra schwört darauf!“, erbot sich ihre Mutter wie bereits in vergangenen Gesprächen.
„Nein!“ Finilyas Antwort duldete keine Widerworte mehr.
„Na gut, na gut, muss ja nicht sein, ich zwinge dich nicht.“ Damit war das Gespräch beendet.
Finilya kämmte ihrer Mutter noch das Rückenhaar und ließ sich anschließend von Irukye kämmen. Dann betraten sie gemeinsam den Schlafraum. Während sich Irukye im Gewimmel der kleinen und großen Körper, die sich auf der überdimensionalen Liege aneinandergekuschelt hatten, zu ihrem Mann gesellte, wählte Finilya einen Platz bei ihrer Schwester Mèfai. Leises Schmatzen verriet, dass Pindra immer noch an deren Brüsten nuckelte. Es dauerte nicht lange, da spürte sie einen kleinen Stich in ihren Rücken.
„Psst, hey …“
„Was ist?“ Finilya sah ihre Schwester fragend an.
„Kannst du ihn mal nuckeln lassen? An meinen saugt er schon so lange, du weißt ja, wie es mit seinen Zähnen ist.“
„Gib ihn her.“ Sie schob ihrem Bruder eine ihrer prallen Brüste ins Mäulchen. Einige Augenblicke später bildete sich ein milchiger Film um die Mundwinkel des kleinen Jungen.
„Hast du etwa Milch?“, fragte ihre Schwester verwundert.
„Ähm, ja“, antwortete Finilya wahrheitsgemäß, um dann hinzuzufügen: „Manchmal lasse ich das Mädchen unseres Nachbarn saugen. Die Kleine macht das so gut, dass ich mittlerweile etwas produziere.“
„Und das sagst du mir nicht?!“, fuhr Mèfai sie an.
„Ich habe das heute erst festgestellt“, wehrte sich die junge Gniri, „ehe du noch was sagst, ich habe eben Mama gekämmt.“
„Ist ja gut.“ Mèfai machte eine wegwerfende Geste. „Ich schlafe jetzt, hoffentlich hat er bald genug.“
„Ah“, kicherte Finilya liebevoll, „der hat wohl nie genug. Er ist zwar der kleinste, aber auch der kräftigste von uns allen.“ Finilya drehte sich zum Fenster und erblickte den Mond, der sein fahles Licht über ihr Antlitz ergoss, sie strich Pindra gedankenverloren durchs Haar. Der gurrte friedlich.
Im Haus war es nun totenstill. So schien es jedenfalls, denn eigentlich herrschte auch jetzt noch rege Betriebsamkeit. Es war nicht mehr das Tappen der breiten Gnirifüße und auch die Vögel waren im Schlaf verstummt, aber der Wind sang nach wie vor seine Melodie und das Holz der Buche knackte dann und wann, wie um allen, die noch horchten, zu sagen: ‚Mir geht es gut, ich wachse und gedeihe!‘ Plötzlich richtete Finilya ihre großen tellerförmigen Ohren auf. – Da! Da war doch was! Es hob sich von Pindras Gurren und Schmatzen deutlich ab. „Krr, krr“, dazwischen eilig dahingeflüsterte Worte. Finilya erkannte die Stimme ihres Vaters. Er schien Irukye etwas ins Ohr zu flüstern, etwas … Sie hörte es und errötete sogleich vom Scheitel bis zur Sohle. Ihre Mutter antwortete mit einem hohen Laut, der Finilya wie Öl in die Gehörgänge tropfte. Sie spürte, wie sich eine elektrisierende Hitze ihres Körpers bemächtigte und zuckte verlegen zusammen. Pindra machte all das nicht das Geringste aus, er war an ihrer Brust saugend, eingeschlafen. Finilya löste ihn sanft von ihrem Körper und schob ihn zu Mèfai, damit er schön warm lag. Dann drehte sie sich wieder dem Mond zu und wartete, derweil die Hitze in ihr arbeitete …
‚Irgendwann müssen sie ja mal fertig sein‘, ging es ihr durch den Kopf, ‚und endlich schlafen.‘
Rangiolf kratzte sich am Rücken und runzelte die Stirn. Was da an Heilsteinen auf dem Boden in Reih und Glied noch versammelt war, konnte nicht mehr als viel bezeichnet werden.
„Es ist zum Verrücktwerden“, grummelte er vor sich hin. „Da schaffst du dir welche an, es vergeht eine lange Zeit und keiner braucht sie. Dann, wenn Hiara, die Ràktsia2, wieder hier vorbeikommt und mir welche anbietet, nehme ich sie nicht, weil ich denke: Es herrscht ja kein Bedarf! Just dann, wenn sie wieder fort ist, kommen sie alle an: ‚Rangiolf, ich habe Kopfschmerzen, Rangiolf ich habe mir die Hand verbrannt, Rangiolf hier, Rangiolf da …‘“ Der junge Gniri fuhr sich durch das dichte braune Haar. Dann wanderte sein Blick zu dem ledernen Beutel mit den Raupen, der neben den Steinen lag und seine Miene wurde wieder ein wenig heiterer.
‚Wann will sie wieder vorbeikommen? Ah ja, morgen … Lange hält sich die Ware ja nicht, die ich ihr als Tausch anbiete. Sie braucht die Raupen, dringend. Ein Bussard hätte Junge gekriegt, sagte sie, und müsse nun gefüttert werden … Ja, Raupen gibt es viele in diesem Jahr. Ich habe etliche gefunden, dafür gibt es sicher viele Heilsteine‘, sinnierte er und lehnte sich nun etwas entspannter zurück. Ohne es zu merken, nestelte er an der Steinkette, die er am Hals trug. Ein Lächeln umspielte seine Lippen und er gurrte bei dem Gedanken, der ihn gerade anfuhr, zufrieden auf.
„Ja“, rief er leise, während sein Blick zum Fenster wanderte, „es hat schon seine Vorteile, ein Barde zu sein. Ich habe mein eigenes Zimmer, kann kommen und gehen, wann ich will, ohne dass es jemand mitbekommt … Hoffentlich kommt sie!“ Es klopfte an der Tür und Rangiolf fuhr erschrocken zusammen.
„Wer ist da?“, fragte er ungewollt angespannt.
„Das Essen ist fertig“, hörte er seine Mutter Yhsa. „Komm jetzt! Steine zählen kannst du später.“ Rangiolf erhob sich stirnrunzelnd.
‚Woher weiß sie, was ich mache?‘, fragte er sich verdutzt. ‚Manchmal ist sie mir direkt unheimlich. Andererseits ist es keine Kunst, das vorherzusehen, ich habe nun mal damit zu tun.‘ Eine Melodie pfeifend betrat er den Raum, in dessen Mitte, in einem Steinkreis, ein Feuer munter prasselte.
„Endlich bequemt sich der Herr zum Essen, wir haben gewartet“, schalt ihn die Mutter mit erhobenem Zeigefinger. Das tat sie immer und es ging ihm ungemein auf die Nerven.
‚Als gönne sie mir mein Zimmer und meinen Bardenstatus nicht, weil jemand, der den Weg des Heilers geht, angeblich keine Familie gründen kann, denn er reist ja viel, ist sozusagen eine wichtige Person!‘, kam es dem jungen Gniri in den Sinn, als er in die Gesichter seiner zahlreichen Familienmitglieder blickte. Während einige seiner Geschwister gelangweilt an den Krallen ihrer breiten Füße herumzupften, betrachteten ihn andere mit Neid. Aus Yhsas Augen sprach dagegen unverhohlene Abscheu.
‚Wie konntest du es wagen, mich so zu enttäuschen und Barde zu werden?‘, fragte wie so oft ihr stechender Blick. ‚Du weißt, dass ich mir für dich eine Ehe gewünscht habe!‘ Rangiolf atmete geräuschvoll aus, gesellte sich zu ihnen und begann zu essen. Er mied den Blick auf seinen Vater Gabra.
„Na, na, mein Junge“, hörte er ihn sagen, „brauchst nicht so geknickt zu sein. Hiara kommt doch morgen und bringt dir Heilsteine.“ Stolz schwang in seinen Worten mit. Yhsa räusperte sich umständlich. Rangiolf sank noch mehr in sich zusammen. Sein Bruder Brafar versetzte ihm einen Stoß in die Rippen.
„Lass das!“, fuhr Rangiolf ihn an.
„Lass den Unsinn“, setzte Gabra hinterher.
„Papakind“, blaffte Brafar. „Glaubst wohl, du bist was Besonderes, was? Hast dein eigenes Zimmer, für deine blöden Steine, während wir uns im Schlafraum zusammendrängen müssen.“
„Tu nicht so, als wolltest du alleine schlafen“, antwortete Rangiolf knapp.
„Schluss jetzt!“, mahnte Yhsa, „esst jetzt oder es setzt was!“ Gabra schüttelte seufzend den Kopf. Er verstand das einfach nicht: Sein armer Junge bekam sämtliche Sticheleien ab und nur, weil er einen Weg beschritten hatte, den kein anderer vor ihm gegangen war. Sein Blick wanderte zu Brafar. ‚Nicht, dass ich ihm den Weg des Heilers nicht gönne‘, grübelte der alte Gniri, während er sich nachdenklich hinter seinem Ohr kratzte, ‚aber er hat einfach kein Talent! Wenn Rangiolf nicht heiratet, muss Brafar eine Familie gründen, ob er will oder nicht! Und das ist auch das einzig richtige für ihn – Rangiolf ist anders. Er ist etwas Besonderes!‘ Als hätte Rangiolf die Gedanken seines Vaters gehört, schüttelte er unmerklich den Kopf. Er schlang den Rest seiner Mahlzeit hinunter, erhob sich und verließ den Raum wie ein geprügelter Hund. Als sich die Tür seines Zimmers hinter ihm schloss, atmete er erleichtert auf. Erst jetzt merkte er, dass er am ganzen Körper zitterte. Er torkelte zu seiner Liege und ließ sich darauf nieder.
„Eine Liege ganz für mich allein“, murmelte er müde, „als wäre das so ein Vorzug …“ Der große Schlafraum drängte sich ihm als Bild vor sein inneres Auge. Dort saßen sie vor dem Schlafengehen noch beisammen und kämmten sich die Haare, dann umarmten sie sich und schliefen so gemeinsam ein. „Mich kämmt nur Finilya. Wenn sie nicht wäre …“ Der junge Gniri spürte, wie ihm eine Träne über die Wange kullerte und er erinnerte sich an Pytheras Worte, als er damals seine Ausbildung bei ihr antrat:
„Der Weg des Heilers ist ein ehrbarer Weg mit vielen Herausforderungen, die du im Dienste des Volkes und der Allgemeinheit bewältigen wirst. Dieser Weg macht jedoch einsam. Denke an einen hohen Berg. Unten, zu seinem Fuße, da wandern noch viele Leute mit dir. Je höher du steigst, desto weniger werden es sein. Irgendwann stellst du fest, dass du ganz alleine bist. – Früher einmal, als die Welten der Menschen und der Naturwesen noch vereint waren, gab es noch viele von uns. In den Zeiten sammelten sich Barden, Ovaten und Druiden an heiligen Orten, die teilweise heute noch existieren. Ich wünsche dir, dass du eines Tages an einen solchen Ort gelangst. Möge das deinem Herzen Frieden bringen.“ Pythera hatte mit einer seltsamen Melancholie in der Stimme gesprochen. Wenn er es genau betrachtete, war eindeutig, dass sie sich sehr einsam fühlte.
„Sie hat keinen Mann“, sagte Rangiolf nachdenklich, „geschweige denn Kinder. Ja, sie hat überhaupt keine Familie, nur diese Schwester. Ob es das Schicksal eines Barden, Ovaten und Druiden ist, für immer allein zu sein? Ob das anders war, bevor die Welten auseinanderbrachen?“
Menschen kannte der junge Gniri nur vom Sehen, wenn sie auf ihren Wegen durch den Wald liefen. Retasso, ein älterer Ovate, der manchmal zu Besuch kam, hatte ihm erklärt, dass sie das SPAZIEREN GEHEN nannten. Andere gingen JOGGEN, das heißt, sie rannten durch den Wald. So mancher aus ihrem Volk hatte sich nach dem Grund ihres Handelns gefragt, aber keine plausible Antwort dafür gefunden.
„SPA-ZIEREN GÄHN … DSCHOGKEN“, stammelte Rangiolf unbeholfen und schüttelte missmutig den Kopf. Dann hielt er inne. Retasso hatte gesagt, die Sprache der Menschen, die in der Nähe seines Volks leben, heißt DOITSCHI und sie leben in DOITSCHILAND. Rangiolf ließ die Worte innerlich nachwirken. „Seltsame Gestalten, diese Menschen“, murmelte er nach einer Weile, „so groß wie Pythera, ja teilweise noch viel größer, mit viel zu kurzen Armen. Man sagt, eine Menschenhand fühle sich wie Pudding an, irgendwie weich, und ihre kleinen Ohren, kein Wunder, dass sie so laut reden. Wenn man so taub ist, geht es eben nicht anders. Und diese winzigen Füße, die stecken sie in diese Dinger, die … wie nannte Retasso sie?“ Rangiolf zupfte sich nachdenklich am Ohr. „SCHUHE.“ Er sah auf seine breiten Gnirifüße und wackelte mit seinen 20 Zehen. „Dafür gibt es keine SCHUHE, die wären alle zu klein.“ Er betrachtete seine kräftigen dunklen Krallen und nickte. „Irgendwann gehe ich meinen Freund Sutia besuchen. Der wohnt in einem PARRK.“ So seltsam Rangiolf die Menschen auch fand, so neugierig war er darauf, sie einmal aus nächster Nähe zu betrachten.
„Man sagt, im PARRK lassen die Menschen die Bäume stehen und pflegen die Natur, nicht wie hier bei uns, wo sie kommen und sich Holz nehmen, uns heimatlos machen, damit sie es im Winter warm haben. Dort sind auch viele Wege, wo sie SPA-ZIRRN und Gras, wo sie sitzen und sich ausruhen … Rrrr“, gurrte er bei dem Gedanken und strich sich aufgeregt über die Borsten seiner Unterarme. „Was Finilya wohl dazu sagen würde? Menschen sind sicher nicht ihr Ding.“ Der Gniri seufzte leise. „Am liebsten würde ich sie sofort heiraten“, er strich über den Stoff seines hellen Lendenschurzes. Wie stolz er war, ihn zu tragen! Es zeigte, dass er im heiratsfähigen Alter war und sich eine Frau suchen durfte und auch musste, denn das tat jeder junge Gniri!
„Aber ihre Eltern können die Mitgift nicht zahlen und das würde meiner Mutter gar nicht gefallen, denn Finilya ist arm. Wo würden wir leben? Ihre Familie hat keinen Platz, unsere hat keinen Platz, und dann bin ich ja Barde. Bald erhalte ich meine Ovatenweihe und werde reisen müssen. Ob Finilya mit mir reist? Heimatlos und ohne Hab und Gut?“ Rangiolf kuschelte sich unter seine warme Moosdecke und schloss die Augen. „Ich muss mich ausruhen“, flüsterte er, „bis alle schlafen. Ich hoffe, sie kommt. – Ich komme ganz bestimmt!“ Mit diesen Worten auf den Lippen schlief er ein.
Als alle eingeschlafen waren, erhob sich Finilya sacht und huschte durch das Fenster nach draußen. Indem sie sich mit ihren spitzen kräftigen Krallen an der Rinde festhielt, kletterte sie kopfüber am Stamm der Buche entlang. Der Waldboden roch nach nasser Erde, feuchtem Moos und dem zarten Blattgrün des Frühlings. Finilya liebte diesen Duft und sog ihn tief ein. Sie richtete sich auf, blickte zum fast vollen Mond, der mit seinem blassen Licht ihren Weg erhellte und lächelte. Schnell wie der Wind und leise wie ein Panther hastete sie weiter, ihrem Ziel entgegen.
Es war ihm, als hätte jemand neben ihm gestanden und ihn sanft an der Schulter gerüttelt, denn Rangiolf war mit einem Mal hellwach. Stirnrunzelnd betrachtete er die Decke seines Zimmers. Das Gefühl, jemand anderes, unsichtbares sei im Raum, entschwand ihm jedoch wie ein flüchtiger Traum. Mit einem Gefühl der Vorfreude warf er die Decke beiseite und erhob sich. Er schlüpfte lautlos durch das Fenster, jagte flink über Äste und Zweige und stand mit einem Satz auf dem Boden. Dann rannte er los, rannte so schnell ihn die kräftigen Beine trugen. Vor Freude jauchzend genoss er den Wind, der durch sein dichtes Haar wehte, das Klirren seiner auf und ab hüpfenden Steinkette klang ihm wie Festmusik. Bald erreichte er eine duftende Wiese mit bunten Blumen und saftigem Gras, mitten im Wald. Jetzt, im Frühling, war sie besonders schön. Er lief hinein und warf sich in das weiche, noch zarte Grün. Sein Herz klopfte wild in seiner Brust und ein Lächeln umspielte seine dünnen Lippen. Eine Weile lag er so da und genoss, wie es im Verborgenen der Wiese zirpte und raschelte. Dann runzelte er ungeduldig die Stirn!
„Hoffentlich kommt sie“, murmelte er leise. „Ich sollte mir das Warten erleichtern.“ Er schaute sich um und entdeckte unmittelbar vor seiner Nase eine weiche Löwenzahnblüte. Voller Faszination betrachtete er die langen zarten gelben Fasern.
„Was machst du da?“, hörte er plötzlich eine helle Stimme hinter seinem Rücken. Rangiolf wandte sich um und blickte in das schimmernde Augenpaar einer nackten, kaum dem Kindesalter entwachsenen Gestalt mit strähnigem verschiedenfarbigem Haar.
„Finilya!“, rief er freudig aus. Mit einem Satz war er auf den Beinen. „Wie schön, wie schön, du hast es geschafft zu kommen.“ Sie fielen einander in die Arme und genossen den anderen.
„Ja, es war nicht einfach heute“, seufzte die Gniri leise, derweil sie mit den Fingern ihrer linken Hand durch sein dichtes Haar wanderte und mit der anderen seinen Rücken streichelte.
„Ah“, gurrte Rangiolf, „hatten sie heute Abend wieder zu tun?“ Er sah sie neckisch an, sie nickte scheu. „Na, macht nichts, nicht wahr?“, setzte er hinterher, „wir haben ja uns!“ Er spürte ihr aufgeregt pochendes Herz an seiner Brust, umschlang ihre Taille ein wenig fester und zog sie mit sich in das weiche Gras. Finilya entfuhr ein leiser Schrei. Dann strahlte sie über das ganze Gesicht und sah ihren Gefährten mit einer Mischung aus Neugier und Scheu an.
„Ich frage mich, was meine Geschwister machen, die unmittelbar neben ihnen liegen“, krächzte sie verlegen, „das muss doch …“, sie zupfte verlegen an dem Pinsel seiner linken Ohrenspitze.
„Ich weiß es nicht“, gestand Rangiolf. Leichte Trauer schwang nun in seiner Stimme mit. „Ich habe doch mein eigenes Zimmer“, fügte er entschuldigend hinzu. „Was ich aber weiß, ist, dass wir hier ganz viel Zeit haben, es auszuprobieren“, schob er aufgeregt hinterher.
„Was auszuprobieren?“
„Na das, was deine Eltern so tun“, schmunzelte Rangiolf, „weißt du denn, was es ist?“
„So genau habe ich das nicht beobachtet“, gab die junge Gniri kleinlaut zu, „aber“, sie schob sich zu ihm heran, „wir könnten es versuchen.“
„Ja … versuchen“, erwiderte Rangiolf mit einem seltsamen Glanz in den Augen und leckte sich mit seiner spitzen Zunge über die Lippen. Finilya betrachtete seinen drahtigen Körper mit den kleinen dunklen Brustwarzen und dem runden festen nach unten behaarter werdenden Bauch und kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe. Dann, als ob ihr ein Geistesblitz gekommen wäre, schob sie ihren Kopf sanft in die Kuhle zwischen seinen Schultern und dem Nacken. Rangiolf spürte etwas Feuchtes seine helle schlammfarbene Haut berühren. Es arbeitete sich in kleinen kreisenden Zügen an seinem Hals entlang, bis es hinter seinem Ohr direkt vor dem Haaransatz Halt machte. Diese Art der Liebkosung kannte er nur zu gut. In der plötzlichen Erinnerung an seine Kinderzeit, seufzte er leise auf und gab sich Finilyas Zuwendung leise gurrend hin.
„Oh, wie ich das vermisst habe“, sagte er, als Finilya hingebungsvoll sein großes Ohr abzulecken begann. „Rrr“, schob genüsslich hinterher. „Meine Mutter hat das früher immer mit mir gemacht, aber heute …“, er hielt inne und die Worte, die er soeben noch hatte sagen wollen, lösten sich in seiner Kehle auf.
„Heute macht sie es nicht mehr, ich weiß“, hörte er seine Gefährtin flüstern. Dann fuhr sie mit ihrer langen, flinken Zunge über seine hohen Wangen hinunter zu den Lachfältchen bis hin zu seinen Lippen, die er in Erwartung eines Kusses spitzte.
„Zeig mir, was Küssen ist“, hauchte Finilya und hielt inne. „Sag mir, weißt du es?“ Ihre dunklen Augen ruhten neugierig auf seinem Antlitz.
„Ich habe es noch nie gemacht“, gestand er und blickte verlegen zur Seite. „Ich habe aber gehört, dass …“
„Was hast du gehört?“, unterbrach die junge Gniri ihn voller Aufregung, „zeig es mir!“
„Also gut. Das kennst du sicher“, er begann sanft über ihre Wangen und dann über Ober- und Unterlippe zu lecken. „Meine Mutter machte das immer, wenn ich mich bekleckert hatte oder sie mich beruhigen wollte.“ Finilya nickte. „Aber, das ist nicht Küssen“, schob Rangiolf hinterher. Er spürte, wie sein Herz zu klopfen begann. „Es ist das!“ Er gab ihr einen leichten Kuss auf den Mund. Dann schob er seine lange Zunge wie eine Schlange zwischen ihre weichen Lippen in ihren Mund. Finilya spürte, wie er sie langsam vor und zurückschob, vor und zurück. Es war ein wiegendes Auf und Ab. Dann gesellte sich ihr zartes Organ dazu und sie begannen einen gemeinsamen Tanz in weichem Rieb.
„Krrr“, entfuhr es leise Rangiolfs Kehle. Finilya fuhr zusammen. Hätte ihr Gefährte seine Hand auf ihr Herz gelegt, wäre ihm ihre Freude deutlicher aufgefallen. So spürte er sie nur an ihren immer neckischer werdenden Liebkosungen. Ihre Küsse wurden stürmischer und blieben doch sanft und unaufdringlich. Es war ein Geben und Nehmen auf Geheiß winziger Bewegungen, nicht berechnet, nicht einstudiert, nicht mit dem Verstand analysiert. Finilya gab einen hohen Laut von sich, und Rangiolf musste unwillkürlich lachen.
„Was denn?“, fragte sie verwundert.
„Ich hab dich erwischt“, grinste er und tippte ihr gegen die Nasenspitze, „du hast genauso gemacht wie meine Mutter. Das ist bisweilen so laut, dass ich es sogar von meinem Zimmer aus hören kann.“ Er lachte über das ganze Gesicht. Finilya sah ihn verwundert an.
„Na, dieser Laut eben, dieser ‚Prrrii‘“, Rangiolf hüstelte verlegen. Finilya legte sich die Hand auf den Mund und wurde rot. Dann begann auch sie herzhaft zu lachen. – Plötzlich wurde sie still und sah ihn unverwandt an, als wollte sie fragen: ‚Und jetzt?‘ Auch Rangiolf wurde ganz still. ‚Ich denke‘, antwortete sein Blick, derweil er ihr über den haarigen Hintern strich, ‚ich erkunde dich noch ein wenig. Darf ich?‘ Als hätte sie seine Gedanken gehört, nickte sie lächelnd. Dann legte sie sich auf den Rücken, streckte die Arme von sich und sah ihn erwartungsvoll an. Sanft beugte er sich über sie und besah sich unschlüssig ihre langen schmalen Brüste, die im fahlen Mondlicht matt glänzten. Finilya kicherte leise auf. Der Gniri zuckte verlegen zusammen.
„Die sind so …“, flüsterte Rangiolf, „so schön voll und prall, nicht so wie …“ Er hielt inne.
„Ich habe noch keine Kinder“, antwortete Finilya knapp, „deswegen.“
„Aber hast du Milch? Dein Nachbar meinte neulich, du würdest seine Kleine säugen.“ Finilya nickte und Rangiolfs Augen begannen zu glänzen. Die Gniri legte den Arm um seinen Hals und zog ihn sanft auf sich.
„Komm“, sagte sie. Dann schob sie ihm sanft eine ihrer Brüste in den Mund. Sie fühlte sich weich und warm an und wenn er daran sog, kam etwas Milch heraus, dicke Milch, die wie Sahne schmeckte und so unglaublich lecker war, dass er zufrieden zu gurren begann.
„Wenn ich könnte“, lachte Finilya, derweil sie ihm aufmunternd durchs Haar fuhr, „würde ich selbst daran saugen, aber leider komme ich nicht heran.“ Rangiolf hätte sich beinahe verschluckt, so laut musste er lachen.
„Das würde ich nur allzu gerne sehen“, gluckste er, während er sich mit seiner flinken Zunge den Milchbart ableckte. Dann wurde er plötzlich ernst.
„Was hast du?“, fragte Finilya verwundert.
„Ich … hm“, begann Rangiolf zögernd, „ich habe es dir bisher noch nie gesagt, aber …“ Die Gniri spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg.
„… ich dich auch“, antwortete sie an seiner statt.
„Ja?“ Rangiolfs Züge hellten sich augenblicklich wieder auf. Er schmiegte sich an sie und seufzte leise auf. „Aber, es ist leider nicht so einfach“, erklärte er traurig.
„Ich weiß“, antwortete sie knapp, derweil sie gedankenverloren die Borsten an seinem Rücken streichelte. „Wissen deine Eltern davon?“ Rangiolf schüttelte den Kopf.
„Ich habe es keinem gesagt“, seufzte er. „Meinem Vater sage ich nichts, weil er der Ansicht ist, dass einem Gniri, der den Weg des Heilers geht, Hochzeit und Familie hinderlich sind, denn er reist viel.“
„Aber so viel reist du doch gar nicht“, fragte Finilya verwundert.
„Noch nicht. Ich, hm, ich erhalte bald meine Ovatenweihe. Schon als Barde hätte ich mehr unterwegs sein müssen, du weißt ja, Barden sind nicht nur Ärzte, sondern verteilen auch Neuigkeiten, singen und beschwingen die Zuhörer, schlichten Streitigkeiten. Ich mache das auch, aber mehr in der Umgebung, nicht länger als eine Tagesreise entfernt. Als Ovate geht es um mehr.“
„Um was mehr? Was meinst du?“
„Menschen“, antwortete der Gniri. „Pythera hat es mir erklärt und ich kann sagen, es fühlt sich stimmig an. Du kennst doch die Geschichte vom Bruch der Welten. Jedes Kind kennt sie. Damals, als die Großen unter uns meinten, dass es nicht anders ginge, woben sie den Schleier des Vergessens, der fortan über alle Menschen fiel.“
„Deswegen haben die Menschen unsere Existenz vergessen und Mutter Natur behandeln sie wie ein lebloses Ding, das man sich untertan macht“, führte Finilya seine Aussage weiter.
„Genau. Wer aber ahnte, dass mit der Erinnerung der Menschen an unsere Welt auch unser Kontakt zu denen vergeht, aus denen alle Arten und Völker entstanden sind, unsere Ur-Ahnen?“
„Die Ur-Ahnen, ja“, seufzte Finilya, „man sagt, sie seien wunderschön, aber ich habe noch nie einen gesehen. Man sagt, sie seien ins Jenseits gegangen. Also …“, die Gniri stockte und sah ihn mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen an, „wenn wir die Ur-Ahnen wieder sehen könnten, hätten wir auch wieder Zugang zu unserer aller Ahnen.“ Rangiolf staunte.
„Wer hat dir das alles erzählt?“, fragte er verwundert.
„Niemand“, antwortete Finilya, „ich habe die Geschichte von meiner Mutter gehört und mir ein paar Gedanken dazu gemacht.“
„‚Ein paar ist gut! Ein paar viele. Aber …“
„Du fühlst dich verpflichtet, zu den Menschen zu gehen.“
„Ich habe doch keine Ahnung von ‚Welten zusammenführen‘ und so. In meiner Macht steht so was sicher nicht. Aber nur allzu gerne würde ich Menschen sehen, von ganz Nahem, verstehst du? Vielleicht erschließt sich mir dann mehr?“ Rangiolf richtete sich auf und sah seine Gefährtin erwartungsvoll an.
„Womit wir wieder beim Punkt ‚Familie‘ wären. Es passt einfach nicht in dieses Bild, nicht wahr? Ich passe nicht in dieses Bild, denn ich bin nur eine arme Frau, ohne Ansehen und ohne Ressourcen. Also willst du mich verlassen?“ In Finilyas Augen glänzten die Tränen.
„Oh, nein, nein“, beeilte sich Rangiolf zu versichern. Er strich ihr das Nass von den Wangen und nahm sie in den Arm. „Nein, gerade das nicht, Finilya. Meiner Mutter würde die Hochzeit mit dir nicht gefallen. Gleichzeitig ärgert sie sich darüber, dass ich diesen Weg gehe. Aber sie will eine Frau an meiner Seite und die kriegt sie, egal was sie dazu sagt! Wir finden eine Lösung, etwas … hm“, der Gniri stockte und fuhr sich über das spitze Kinn, „etwas Neues, was noch nie jemand gemacht hat!“
„Und was wäre das?“, fragte Finilya patziger als sie es beabsichtigt hatte.
„Dich und den Weg des Heilers“, kam es von Rangiolf wie aus der Pistole geschossen.
„Wie wollen wir das anstellen? Als Heiler bist du ein Reisender, also kannst du nicht hierbleiben. Hierzubleiben und eine Familie zu gründen, das funktioniert auch nicht, nicht mit so jemandem Mittellosem wie mir. Meine Mutter mag dich, am liebsten sähe sie dich als Ehemann. Eine Hochzeit, die von beiden Familien gut geheißen wird, kann sie sich aber abschminken. Und für meinen Vater bin ich seine kleine Gniri, die er lieber neben sich am Feuer sieht, als draußen bei dir. Manchmal sehne ich mich nach dem Feuer, aber ich sehne mich auch immer mehr nach dir.“
„Ich auch, ja, ich auch und deswegen“, versicherte der junge Gniri noch einmal, „werden wir eine Lösung finden, die beides beinhaltet.“ Fürs Erste beschlossen sie, die Sache auf sich beruhen zu lassen und die gemeinsame Zeit auf der Wiese zu genießen. Allzu lange durften sie aber nicht mehr beieinander verweilen, denn der nächste Tag würde arbeitsreich und anstrengend werden. Bevor sie Abschied von einander nahmen, versprachen sie sich, sich über einen möglichen neuen Weg Gedanken zu machen.
„Wenn wir uns das nächste Mal sehen“, sagte Rangiolf zum Abschied, „haben wir die Lösung.“
„Woher weißt du das?“
„Ich fühle es.“ Sie umarmten und küssten sich noch einmal, bevor sie sich trennten.
Der Morgen graute, und Finilya graute es, ihre warme Liege zu verlassen, aber es ging nun einmal nicht anders. Wie alle anderen schob sie sich einen süßen Happen Riàt in den Mund und ging nach draußen. Nur Irukye blieb noch zu Hause, um Pindra zu säugen und aufzuräumen.
Als die kühle Morgenluft ihr Gesicht berührte, fühlte sie sich sogleich frisch und munter. Sie atmete tief ein, blickte durch die Bäume zum Horizont, wo die rote Sonnenkugel ihren täglichen Weg begann und folgte, gemeinsam mit ihren Geschwistern, ihrem Vater, der immer bestimmte, was, wo, wann und wie zu tun war.
Sie stapften querfeldein durch den Wald und kamen bald zu einer lichten Stelle. Überall lagen zersägte Baumstümpfe. Erst am Tag zuvor mussten Menschen hier gewesen sein, die in Fahrzeugen saßen, denn der Boden war von eigenartigen Spuren übersät: breit und rillenförmig waren sie und hatten ein heilloses Durcheinander hinterlassen.
„Hütet euch vor den stinkenden Riesen“, ermahnte Rìa seine Kinder und zeigte auf die Spuren. „Sie sind groß und laut, und wenn sie kommen, ist nichts mehr vor ihnen sicher. Kommt ihr einem unter die Räder, ist es aus, denn sie sehen uns nicht!“ Finilya runzelte die Stirn.
„Du willst hier Bäume pflanzen, was?“, fragte sie ihren Vater. Rìa nickte. „Aber wofür? Nur, damit sie wiederkommen und alles wieder zertrampeln oder zersägen? Wir sollten irgendwo hin, wo es sich noch lohnt, was einzupflanzen, meinst du nicht?“ In letzter Zeit widersprach ihm seine Tochter ziemlich häufig. Was war nur los mit ihr? Rìa seufzte und sah sie müde an.
„Du weißt, dass es unsere Aufgabe ist, den Wald zu erhalten, auch wenn die Chancen, dass hier noch was wächst, noch so gering sind“, antwortete er ruhig aber bestimmt.
„Ja, Papa, aber schau hier, siehst du dieses Ding?“ Die Gniri deutete auf ein Schild, das am Wegesrand stand.
„Ja, eins von den Dingen der Menschen. Keine Ahnung, was sie mit diesen kalten, viereckigen Dingern wollen.“ Rìa zuckte verärgert mit den Achseln.
„Da steht was geschrieben“, sagte Finilya ruhig.
„Ja, und?“ Rìa riss langsam der Geduldsfaden. „Meinst du, das interessiert mich?!“ Finilya verdrehte die Augen und blickte sich um. Keines ihrer Geschwister war gewillt, Partei für sie zu ergreifen. Sie fühlte ihr Herz in der Brust hämmern und hatte Angst. Dann nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und sagte:
„Es sollte dich aber interessieren, denn schau“, sie zeigte auf ein groß geschriebenes Wort. „Da steht NUTZWALD.“ Rìa klappte seinen Mund auf – und wieder zu.
„Du kannst das lesen?“, fragte er erstaunt und sah seine Tochter mit großen Augen an. Finilya spürte, wie ihr das Blut in Kopf und Ohren schoss.
„Ja, etwas“, flüsterte sie und scharrte nervös auf dem Boden herum.
„Wer hat dir das beigebracht?“ Rìa sah sie streng an.
„Pythera – sie brachte mir bei, die SCHILDS zu lesen.“
„Schilds?“
„Diese viereckigen Dinger, das sind SCHILDS.“ Finilya erwartete von ihrem Vater nun eine Schimpftirade sondergleichen, aber die blieb aus.
„Was ist NUTZWALD?“, fragte er stattdessen und schaute sie an.
„Die …“, Finilya zitterte am ganzen Körper und schluckte trocken.
„Sag nicht, du hast dich so sehr vor meiner Ablehnung gefürchtet, dass du es mir deshalb verheimlicht hast“, warf ihr Vater enttäuscht ein. „Du weißt doch, dass du mit allem zu mir kommen kannst, mein Kind.“ Er trat auf seine Tochter zu und legte ihr sanft die Hand auf die Schulter.
„Ja, aber, hm – Menschenzeug ist schlecht, sagst du immer, damit darf man sich nicht beschäftigen, sagst du immer.“
„Du darfst nicht zu den Menschen gehen, das sage ich immer“, antwortete Rìa väterlich. Dabei merkte er nicht, wie sich Finilya noch mehr verkrampfte. „So etwas, Tochter, darfst du mir ruhig sagen, das ist für uns nämlich wichtig. Und nun ziere dich nicht und erkläre deinem alten Vater, was ein NUTZWALD ist, falls du das ebenfalls weißt.“
„Das ist ein Ort, wo Menschen Bäume pflanzen“, brachte sie schließlich hervor, „aber nicht, um der Mutter zu helfen, sondern um sie abzuholzen, wenn sie reif sind. Es sind Gebiete, wo eine Baumsorte in Reih und Glied gepflanzt wird, sodass sie schnell und gerade wächst. Die Menschen kommen im Moment nur her, um den Rest der alten Bäume abzuholzen, damit Platz ist für einen neuen NUTZWALD.“
„Verstehe“, antwortete Rìa und trat einen Schritt zurück. Sein Blick wurde seltsam matt. Auf einmal sah er sehr alt aus: ein gebeugter Gniri mit hängenden Schultern und zerfurchter Stirn. Er blickte auf seine alten Hände und seufzte. „Lasst uns woanders hingehen“, sagte er schließlich und sah Finilya auffordernd an. Die Gniri fühlte sich schrecklich. Nicht nur, dass sie ihren Vater durch ihre Erklärung traurig gemacht hatte, nein, da war noch diese Entscheidung, die in ihrem Herzen herangereift war, nämlich mit Rangiolf zu ziehen – dahin zu gehen, wohin er gehen wollte: zu den Menschen. ‚Seine Ovatenweihe‘, dachte sie, während sie ihre Familie zu einem Platz führte, der für Baumsämlinge geeignet schien, ‚findet ganz sicher heute Nacht statt! Pythera sagte gestern, sie würde an diesem Vollmond stattfinden.‘ Sie runzelte die Stirn. ‚Sag deinen Eltern Bescheid …‘, hat sie mir gesagt. ‚Sie sind ebenso wie du eingeladen. Sie müssen Bescheid wissen – über alles!‘ Ob sie mit „alles“ wohl auch ihre Beziehung zu Rangiolf meinte? Und ihren gerade gefassten Entschluss?
Eine Hand packte ihn an der Schulter und rüttelte ihn sanft.
„Aufstehen, du Schlafmütze“, hörte Rangiolf eine Stimme von weit her.
„O, nein“, der Gniri klappte ein Lid hoch. „Ist es schon Morgen?“
„Der Morgen graut schon“, trällerte Gabra, „und weißt du, was heute noch ist, mein Junge?“
„Heute ist Regen angesagt?“
„Nein, du Dummerle, Vollmond! Du bekommst heute deine Ovatenweihe, hast du das vergessen?“ Rangiolf saß auf einmal kerzengerade im Bett.
„Ja“, rief er aus, „Vollmond!“
„Ja! Die letzten Nächte war er ja schon schön rund, unser Mond, aber heute, heute ist er kugelrund!“, freute sich sein Vater.
„Hat dir Pythera denn gesagt, dass die Weihe heute stattfindet?“, fragte Rangiolf skeptisch. „Ich meine, wie viele volle Monde habe ich schon hinter mir, und da ist gar nichts passiert! Sie meint schon seit einer halben Ewigkeit, dass ich bei Vollmond meine Weihe erhalten werde, und wann war das bisher??? Gar nicht! Also, wofür die Aufruhr?“
„Nein, mein Junge. Heute ist es anders, ich fühle es! Meine Borsten jucken, das will was heißen!“, lachte sein Vater und blickte ihn selig an.
„Papaaa“, maulte sein Sohn, „komm’ mir nicht schon wieder mit dieser Borstenjuckgeschichte.“ Einerseits wollte Rangiolf nicht daran glauben, andererseits hatte die Vergangenheit wiederholt gezeigt, dass Gabras Borsten immer dann juckten, wenn etwas Besonderes bevorstand.
„Also, mein Junge“, fuhr sein Vater fort und leckte sich aufgeregt die Lippen, „bevor du weiter Raupen sammelst und dich mit Hiara, der Ràktsia triffst, gehst du zu Pythera und fragst sie.“ Rangiolf verdrehte die Augen.
„Ja, Papa“, gab er nach.
„Und dann kommst du gleich und sagst mir Bescheid, ja?“
„Ja, Papa.“
„Damit du keine Zeit verlierst, habe ich dir das Essen gleich mitgebracht. Hier!“ Gabra holte einen großen Klumpen saftig-süßen Riàts hervor, den er hinter seinem Rücken versteckt gehalten hatte und hielt ihn Rangiolf hin. Der Gniri blickte auf das weiße triefende Etwas in Gabras schartiger Hand und runzelte die Stirn.
„Sag mir nicht, dass du es stibitzt hast, als Yhsa nicht hingeschaut hat“, murrte er und sah seinen Vater stirnrunzelnd an. Dieser kicherte und leckte sich schelmisch über die Lippen. „Papaaa“, beschwerte sich Rangiolf, „du weißt doch, dass das immer auf mich zurückfällt. Mama wird mich heute wieder fertig machen deswegen.“ Kaum, dass er seinem Unmut Luft gemacht hatte, griff er sich die Hälfte und schob sie sich in den Mund. „Der Rest ist für dich“, sagte er kauend.
„Nein, mein Junge, alles für dich, du musst doch stark sein heute Abend.“
„Iss“, gab Rangiolf unmissverständlich zu verstehen.
„Na gut“, gab sein Vater mit glänzenden Augen nach.
„Gabraaa!“ Yhsas Aufschrei hallte durch das ganze Haus.
„Geh jetzt, ich werde schon mit ihr fertig, und vergiss nicht, mir Bescheid zu sagen, ja?“
„Aber …“
„Los jetzt!“, befahl sein Vater. Murrend erhob sich der Gniri von seinem Lager, derweil er sich die klebrigen Finger leckte. Dann band er sich eilig seinen Gürtel um die Hüfte, an dem mehrere kleine Beutel befestigt waren, und verschwand durchs Fenster nach draußen.
Kühle Morgenluft schlug ihm entgegen. Hinter sich hörte er seine aufgebrachte Mutter lauthals zetern, was Gabra einfiele, einen so großen Happen zu klauen und diesem kleinen Taugenichts von Sohn in den Rachen zu schieben, aber das alles kümmerte ihn nun nicht mehr. Er hielt für einen Augenblick inne, um die aufgehende Sonne zu begrüßen und rannte los, direkt auf Pytheras Eichenhain zu.
Der Baum, vor dem er stand, war weder besonders groß, noch außergewöhnlich schön. Die Wohnstatt, die in seiner Krone eingebettet lag, war einfach und bescheiden. Kaum einer hätte bei deren Anblick vermutet, dass dort die Heilerin Pythera wohnte, eine weise Druidin, die zugleich das Oberhaupt des Iàtranür Ìrimaar3 war. Manch einer spottete im Verborgenen darüber, dass sie nicht standesgemäß wohne und verkommen sei, aber Rangiolf gefiel der rustikale Stil ihrer Behausung ebenso sehr wie er deren Bewohnerin achtete und ehrte. – Er kletterte behände empor und klopfte an die Tür.
„Herrin“, rief er laut, „bist du da?“ Er legte sein großes spitzes Ohr an die Tür und lauschte.
„Habe ich dir nicht gesagt, du sollst deine Lauscher nicht überall hin strecken?“, hörte er eine helle Stimme von drinnen lachend fragen. Rangiolf zuckte zusammen und nahm Haltung an. ‚Woher sie das nur wieder weiß?‘, fragte er sich achselzuckend.
„Na, ich kenne dich doch“, reagierte die Stimme, als hätte sie seine Gedanken gelesen. Die Tür ging knarrend auf. Rangiolf kratzte sich verlegen an den Borsten seiner Arme. Da kam ihm Gabras Juckgeschichte wieder in den Sinn. Er blickte auf und direkt in ein bernsteinfarbenes Augenpaar, das liebevoll auf ihn herab sah.
„Worauf wartest du? Komm rein“, sagte die Gniri, packte ihn sanft an der Hand und zog ihn in die Behausung. Zwei kleine runde Löcher dienten als Fenster und erhellten spärlich den Raum. Er war Wohn-, Ess- und Schlafzimmer zugleich und mit allerlei Dingen voll gestellt, von denen manche Rangiolf vertraut, andere dagegen fremd waren. So konnte er zum Beispiel nicht oft genug den großen, hellen Stein bestaunen, der wie eine Lampe von der Decke hing und bei Nacht den ganzen Raum in warmes Licht tauchte, oder die Feuerstelle, die inmitten des Raumes viel Platz beanspruchte und dazu benutzt wurde, um so manches geheimnisvolle Gebräu herzustellen oder sich zu wärmen. Zig kleinere und größere bauchige Flaschen standen in Reih und Glied auf einem Holzregal, das unter seiner Last zusammenzubrechen drohte. Rangiolfs Blick blieb daran haften und wie so oft krauste er die Stirn.
„Keine Sorge“, lachte Pythera und strich sich durch das hellbraune Haar. Der Gniri schüttelte ratlos den Kopf und nahm neben ihr auf der Liege Platz.
„Du, du“, begann er stockend jene Diskussion, die er schon während der ersten Tage seiner Ausbildung mit ihr entfacht hatte, „woher weißt du immer, was ich denke? Das ist doch nicht normal!“ Pythera grinste breit und leckte sich schelmisch die Lippen. „Ich, ich …“, führte sie seine Rede fort.
„Es ist einfach so, finde dich damit ab. Deswegen bist du doch nicht zu mir gekommen, oder?“
„Ähm, nein“, murmelte er verlegen, während er nachdenklich sein Kinn rieb. „Was war es noch mal? Ah ja, die Weihe, die Ovatenweihe. Die soll an Vollmond sein. Mein Vater will wissen, ob es heute ist, denn seine Borsten jucken.“ Ohne es zu merken, kratzte er sich wieder an seinen eigenen.
„Ja, die ist heute“, die Gniri nickte, „aber das solltest du doch am Besten wissen, oder?“ Sie sah ihn erwartungsvoll an. Rangiolf wurde rot.
„Ähm … ja“, flüsterte er. Trotzdem verstand er nicht, warum gerade er es wissen sollte, wo doch die letzten Monde seit der Ankündigung ereignislos verstrichen waren.
„Heute Nacht, wenn der Mond ganz oben steht, kommst du her. Bring deine Eltern mit.“
„Meine Eltern?!“, rief der Gniri bestürzt.
„Ja, was ist so schlimm daran?“ Er spürte, wie ihm heiß und kalt wurde und senkte verlegen den Blick. Gleichzeitig arbeitete sein Verstand fieberhaft an der richtigen Wortwahl einer Antwort. „Wenn … also wenn …“
„Rangiolf, schau mich an.“ Der Gniri seufzte und blickte auf. Dabei sah er wie ein Häufchen Elend aus.
„Sag mir, was du auf dem Herzen hast.“
„Meinen Vater wird es freuen mitzukommen, aber meine Mutter nicht, sie will das alles hier nicht.“
„Was noch?“
„Wenn er kommt und mir zuschaut, dann wird er wieder seine Faxen machen. Also dieses Mich-stolz-anschauen und dabei die Hände reiben und tanzen und was weiß ich alles. Denn ich bin ja sein besonderer Sohn … also, lieber nicht, ja? Bitte, lass mich alleine kommen.“
„Es ist aber notwendig, dass deine Eltern dabei sind“, antwortete Pythera knapp.
„Warum?“, fragte Rangiolf verwundert.
„Weil …“, die Heilerin stockte, und ihr Blick wurde auf einmal sehr nachdenklich.
„Weil?“, hakte der Gniri nach.
„Das wirst du dann sehen. Und nun schau, dass du raus kommst, die Raupen warten! Die, die du da in deinem Beutel hast, reichen bestimmt nicht aus, um Hiara zufrieden zu stellen, oder?“ Rangiolf atmete geräuschvoll aus. Er war nicht zufrieden mit Pytheras Antwort. Sie machte immer Andeutungen, die seine Neugier entfachten, nur, um ihm dann zu sagen, er solle sich um seinen eigenen Kram kümmern. Warum tat sie das? Er sah sie trotzig an und suchte in ihrer Miene nach einer Antwort.
‚Alles zu seiner Zeit‘, sagten ihre bernsteinfarbenen Augen, die in einem zeitlosen Antlitz ruhten, das gleichzeitig unendlich alt zu sein schien. So oft hatte Rangiolf sie fragen wollen, wie alt sie denn eigentlich sei, aber er hatte sich nie getraut, denn solche Fragen galten als unhöflich. – Er erhob sich und verabschiedete sich mit einem stummen Kopfnicken. Dann trat er ins Freie und kletterte hinunter auf den Waldboden.
„Sooo“, grunzte er und schob einen leisen Schmatzlaut hinterher, „nun schauen wir mal, was die Raupen machen, wie viele ich wohl noch brauche?“ Er öffnete den Beutel, der links an seinem Gürtel hing, und stellte zufrieden fest, dass sich der Inhalt noch rege bewegte. „Jaaa, das Futter, das ich euch gegeben habe, schmeckt euch, was?“, lächelte Rangiolf. „Aber, ihr seid mir noch viel zu Wenige. Hiara kommt heute, wenn die Sonne hoch steht, also muss ich noch ein paar finden, denn die Steine …“, er schnürte den Beutel zu und öffnete den auf der rechten Seite, „sind zu wenige, der Bedarf ist hoch.“
Wie von einer Tarantel gestochen sauste er los. Er hüpfte geschickt über umgefallene Baumstämme und schob sich durch schmale Durchgänge in dornigem Gestrüpp. Dabei wanderten seine hellblauen Augen suchend die Umgebung ab. Im Laufen sah er sich die Blätter der Bäume, das feuchte Moos und die Samen von Buchen an – überall konnte eine Raupe kriechen! Dann entdeckte er etwas und blieb abrupt stehen: Eine Nuss!
„Oh“, staunte Rangiolf, „eine Walnuss. Normalerweise findet man die hier nicht …“ Er kratzte sich am Ohr und drehte das runde Gebilde in seinen bekrallten Fingern hin und her. Dann hielt er inne. Irgendetwas hatte mit scharfen Werkzeugen ein Loch hinein gefräst. Er linste hinein, konnte aber nichts erkennen. Dann richtete er sein Ohr auf, schüttelte die Nuss und horchte. Was konnte nur darin hausen? Rangiolf runzelte die Stirn. Ganz behutsam schob er die lange dünne Kralle seines kleinen Fingers in das Loch. Kaum, dass er drinnen war, spürte er schon einen Widerstand.
„Hab ich dich“, rief er, „wie kriege ich dich nur heraus ohne dich zu durchbohren?“ Er begutachtete noch einmal das Loch. Es war viel zu klein. „Vielleicht die Schale zerstören?“ Er zog seine Kralle heraus und drückte die Nuss so lange in der Faust, bis die Schale ächzend auseinander brach. Was nun in seiner hellen schlammfarbenen Handfläche lag, fand er wunderschön: Es war die größte und dickste grüne Raupe, die er je gesehen hatte. Man denke, in einer Walnuss, wie eigenartig! Er pustete sie an und stellte zufrieden fest, dass sie sich bewegte. „Ich frage mich nur, wovon du dich ernährt hast, die Nuss war hohl. Na ja, keine Zeit, darüber nachzugrübeln, du wirst mir viele Steine einbringen!“
Er lief wieder los. Jetzt hielt er nur noch nach Nüssen Ausschau, aber seine Suche blieb ergebnislos! Als die Sonne schon hoch am Himmel stand, musste er sich murrend eingestehen, dass er seine ganze Zeit damit vergeudet hatte, nach besonders dicken Raupen zu suchen, obwohl es auf Baum und Boden von anderen nur so wimmelte. Auf dem Weg zu Hiara sammelte er noch einige ein. Dann bestieg er die Krone des höchsten Baums im Wald, kletterte bis in den letzten Wipfel und wartete dort. Eine sanfte Brise kam auf und wiegte sanft die Spitze des Mitteltriebs, an den er sich klammerte.
„Komm schon“, rief der Gniri leise, „hier oben ist kein Ort für einen wie mich. Besäße ich Flügel, wäre es was anderes und … hm, selbst dann nicht. Ich liebe nun mal die Erde und den dicken, stabilen Ast eines Baums, das Geschaukel macht einen ja vollkommen …“ Er konnte seinen Satz nicht mehr beenden. Hiara war da.
Als Bodenbewohner bekam man selten solche Wesen zu sehen, geschweige denn, dass sich mit einem von ihnen ein Gespräch ergab, denn sie lebten hoch in den Lüften bei den Vögeln. Er aber, als Barde und Putzmann, der Blatt und Boden von Schädlingen befreite, hatte häufig Kontakt zu ihr, denn sie schätzte seine Raupen.
„Ich hoffe, deine Vögel mögen sie“, sagte Rangiolf und hielt ihr den geöffneten Beutel hin. Hiara, die von Weitem leicht mit einer hellen Wolke verwechselt werden konnte, schwebte näher heran. Ihre großen silbernen Augen wanderten interessiert über den Inhalt und ihr rundes milchig weißes Gesicht formte sich zu einem zufriedenen Lächeln.
„Ja“, antwortete sie. Ihre Stimme klang wie der Wind. Dann formte sich aus ihrem Wolkenkörper ein Arm mit einer zartgliedrigen Hand.
„Die!“ Sie zeigte auf die dicke Raupe, die sich auf dem weichen Lager, das die anderen bildeten, genüsslich hin und her räkelte. „Die ist was Besonderes, selten anzutreffen und für Vögel äußerst schmackhaft.“ Nun sah sie den Gniri an und ihm war, als blicke sie in sein Herz. „Mach’ dir keine Sorgen, alles löst sich. Sieh die Raupe als Zeichen. Du bist was Besonderes, Finilya ist was Besonderes, eure Ehe ist besiegelt.“
„Du musst schön sein für die Zeremonie“, Irukye kämmte Rìa vorsichtig das Haar. „Das macht einen guten Eindruck! Und wenn Pythera sieht, was für ein ordentlicher Mann du bist, wird sie vielleicht auch etwas für Rangiolfs und Finilyas Hochzeit spenden.“ Der alte Gniri schüttelte den Kopf.
„Hochzeit, du immer mit deiner Hochzeit. Du weißt genau, dass Finilya noch viel zu jung ist. Außerdem: Was will ein reisender Ovate mit einer Frau?“
„Was will er nicht mit einer Frau?“, gab Irukye zurück. „Hat uns Pythera zu Rangiolfs Ovatenweihe eingeladen oder nicht, he? Das will was heißen! Und überhaupt, Ovaten müssen nicht reisen, nicht wahr, Finilya?“ Sie sah zu ihrer Tochter, die sich ebenfalls das Haar kämmte. Die Gniri zuckte erschrocken zusammen und sie erinnerte sich an die Worte der Heilerin, ihnen Bescheid zu geben – über alles! Was wusste Pythera über ihren und Rangiolfs Weg, was Finilya selbst nicht wusste oder nur ahnte?
‚Alles‘, kam ihr in den Sinn, ‚sie kann hellsehen, das ist einfach so.‘
„Finilya?“ Irukye riss sie aus ihren Gedanken und sah sie groß an.
„Also“, hüstelte die Gniri zögerlich, „komm, Mama, setz dich bitte einen Augenblick zu Rìa, ja?“
„Ich muss noch deinen Vater zu Ende kämmen.“
„Bitte, Mama.“ Irukye hielt inne. Ihre Tochter setzte sich neben sie und ergriff ihre Hand. „Du hast recht. Pythera wird vermutlich etwas drehen, sodass wir heiraten können. Rangiolfs Eltern werden ihre Entscheidung achten müssen. Aber Ovaten, Mama, die reisen viel. Das bedeutet einerseits, dass Rìa keine Mitgift entrichten muss, andererseits aber auch, dass ich euch mit Rangiolf verlassen muss.“ Während sich Irukye noch unschlüssig war, ob sie nun mit Freude oder Trauer reagieren sollte, stand Rìa die Enttäuschung deutlich ins Gesicht geschrieben.
„Ich weiß, dass du enttäuscht bist, Papa, aber Rangiolf ist ein guter Mann, er wird auf mich aufpassen.“
„Ja“, murmelte der Alte und senkte den Blick. „Genauso wie ich es damals Irukye versprochen habe.“ Er sah sie mit müden Augen traurig an.
„Oh“, rief Rangiolf auf einmal bestürzt, „ich wollte doch meinem Vater Bescheid sagen, wegen der Weihe! Das habe ich ganz vergessen, er wartet schon seit heute Morgen!“
„Dann gebe ich dir die Steine und du kannst schnell zu ihm“, antwortete die Ràktsia und zog einen Beutel aus ihrem Wolkenkleid. „Schau“, sagte sie bekräftigend, „ich habe eine gute Mischung für dich zusammengestellt.“ Sie hielt Rangiolf den geöffneten Beutel hin.
„Das sind genau die Richtigen, für jedes Wehwehchen. Ich danke dir. Wann kommst du wieder?“
„Wenn Retasso kommt“, antwortete Hiara.
„Retasso?“ Rangiolfs Miene verriet aufrichtiges Erstaunen. „Kommt er uns etwa besuchen?“ Hiara nickte lächelnd und verabschiedete sich.
„Hey, warte“, rief ihr der Gniri hinterher. „Wann kommt er denn?“
„Bald“, hörte er sie noch antworten, ehe sie in den Wolken verschwand. Rangiolf starrte noch eine Weile ins Leere, dann besann er sich, kletterte den Baum hinab und eilte zu Gabra. – Der saß vor ihrem Heim auf einem Stein und blickte versonnen in die sonnenbeschienenen Kronen der Bäume.
„Bin da, bin da“, keuchte Rangiolf und blieb vor ihm stehen, „tut mir leid, ich hatte ganz vergessen …“
„Ist schon in Ordnung.“ Gabra machte eine wegwerfende Handbewegung und seufzte leise. „Ich sehe schon, deine Raupen waren dir wichtiger als dein alter Herr, hm?“ Er sah seinen Sohn forschend an.
„Also, Papa, die gute Nachricht ist“, begann Rangiolf sogleich, um Gabra aufzumuntern, „deine Borsten haben dich nicht getäuscht, heute Nacht, wenn der Mond hoch am Himmel steht, ist die Weihe. Pythera sagt, ich soll euch beide mitbringen.“
„Ehrlich? Das hat sie gesagt?“ Gabras Augen wurden groß und rund. Erstaunen und Freude paarten sich darin. „Das muss ich Yhsa sagen!“ Er erhob sich und war schon dabei, den Stamm der Eiche hochzuklettern, als ihn sein Sohn zurück hielt.
„Warte!“ Gabra drehte sich um und sah Rangiolf an. Nackte Angst sprach aus seinem Blick.
„Weißt du, mein Junge“, lächelte sein Vater, „ich lebe mit meinem Weib nun schon länger zusammen als du und ich kann dir sagen: Sie ist stolz auf dich, auch wenn sie es nicht zugibt! Und nun lass mich zu ihr gehen und ihr die gute Nachricht überbringen, und du …“, er sah seinen Sohn eindringlich an, „solltest uns mal über die holde Dame aufklären, wegen der du dich so häufig nachts aus dem Hause schleichst.“
„Ähm … ich …“
„Nein, keine Ausreden, mein Junge. Ich rede jetzt mit deiner Mutter und hole ich sie herunter, und du klärst uns auf, wie und was du zu tun gedenkst.“ Rangiolf spürte, wie ihm schwindlig wurde. Er ließ sich auf den Stein sinken, auf dem eben noch sein Vater gesessen hatte und blickte nun seinerseits gedankenverloren in die Kronen der Bäume. Kaum, dass er sich sammeln und eine Aussage zurechtlegen konnte, standen die beiden schon bei ihm. – Yhsa schrie nicht, noch sagte sie etwas. Stattdessen sah sie Rangiolf mit verschränkten Armen an. Ihre Miene war ernst, aber nicht aufgebracht, stellte der Gniri erleichtert fest. Er räusperte sich umständlich.
„Sie heißt Finilya“, sagte er schließlich langsam, „und ist die Tochter von Rìa und Irukye. Also nicht gerade das, was du dir, Mama, unter einer idealen Ehefrau vorstellst, denn es fehlen ihnen die Ressourcen. Aber ich liebe sie, und ich möchte sie heiraten.“ Während er die Worte aussprach, sah er seine Eltern aufmerksam an. Beide wollten dazwischenreden. „Hört mir zu“, fuhr Rangiolf unvermittelt fort. „Ich werde meine Ovatenweihe erhalten, wie es dir am Herzen liegt, Papa. Und ich werde reisen, wie es ein Ovate tut – aber mit meiner Frau Finilya.“ Eigentlich wusste er gar nicht, ob Finilya mit seiner Entscheidung einverstanden war. Das Gefühl der Zuversicht in seinem Herzen machte ihm jedoch Mut, diese Worte auszusprechen. „Wir werden euch nicht zur Last fallen. Also müsst ihr von Rìa keine Mitgift verlangen, denn er kann sie euch nicht geben. Hiara sagte heute, die Ehe sei besiegelt, und ich möchte ihr glauben. Ich möchte auch, dass ihr heute Nacht zur Weihe erscheint.“ Er sah Yhsa an. Diese rieb sich nervös ihre Hände und blickte zur Seite. Dann nickte sie.
Während Irukye aufgeregt auf der Kralle ihres Zeigefingers herumkaute, rieb sich Rìa nervös die Hände. Finilya zupfte an ihrem weichen Haar herum. Pythera stand bei ihnen und im Gegensatz zu ihrem sonst schlichten Aufzug, trug sie nun ihr Baumgewand, wie es die Leute ihres Volkes nannten. Es war ein festliches Gewand aus einem dunkelgrünen und braunen Material, verziert mit Eichenblättern, Rindenteilen und Wurzelwerk, die niemals vergingen. Die Gniri erzählten sich, dass sie es einst, als die Bäume noch gesprächiger und beweglicher waren, von einer mächtigen Eiche geschenkt bekommen hatte. Wann und wo das gewesen sein soll, darüber spekulierten sie mehr als über den Namen dieses holden Baumes, der ihr angeblich einst diese hohe Ehre erwiesen hatte.
Finilya konnte sich daran nicht satt sehen. Wenn Pythera dieses Gewand trug, glich sie einem Falter, der Mimikry betreibt: Sie verschmolz nicht nur mit ihrer Umgebung, sondern auch mit dem Kleid selbst. Sie wurde unsichtbar – und blieb doch sichtbar. Die Gniri trat näher an sie heran und betrachtete die langen schlanken Eichenblätter, die in ihr Kleid eingearbeitet waren. Sie waren frisch und grün und so zart, dass sie einfach nicht an deren Unvergänglichkeit glauben mochte. Dann sah sie an sich herunter und seufzte leise. Ihre eigene kindlich anmutende Nacktheit war eines solchen Anlasses wirklich nicht würdig, aber sie war nun einmal noch nicht verheiratet. Als hätte Pythera ihre Gedanken erraten, griff sie in eine der vielen verborgenen Taschen ihres Gewandes und holte eine kleine Kette hervor. Wie das Kleid selbst bestand sie aus feinem Wurzelwerk und vielen Eichenblättern. In der Mitte prangte als Anhänger eine wunderschöne goldgelbe Eichel.
„Hier“, sagte sie und hängte sie der jungen Gniri um.
„Danke“, flüsterte Finilya gerührt. – Als Rangiolf mit seinen Eltern kam und sah, dass nicht nur die Heilerin auf sie wartete, blieb er abrupt stehen, sodass Gabra in ihn hineinlief. Yhsa blieb verwirrt stehen.
„Finilya …“, flüsterte der junge Mann fast unhörbar. ‚Wer hat ihre Eltern eingeladen?‘, fragte er sich erschrocken.
„So was habe ich mir schon fast gedacht“, brummte Gabra und kratzte sich seine Armborsten, „schau nur, Yhsa, das sind ihre Eltern.“ Er deutete auf Rìa und Irukye. „Ich glaube“, er leckte sich schmunzelnd die Lippen, „die Auserwählte Rangiolfs ist auch die Auserwählte der Heilerin. Sie will, dass die beiden heiraten.“ Er kicherte leise hinter vorgehaltener Hand. „Also, mein Junge, mach dich auf deine Weihe und auf ein Hochzeitsarrangement gefasst, und du, Yhsa, auch!“ Nun lachte er meckernd.
„Siehst du? Siehst du? Sagte ich doch!“ Sie kniff ihrem Mann sanft in die Seite. Rìa lächelte spitzbübisch, derweil er die Ankömmlinge neugierig musterte. Dann wanderte sein Blick ebenfalls zur Heilerin.
„Du bist … eine Spitzbübin!“, rief er ihr zu.
„Ich weiß“, grinste sie, „ich weiß! Darf ich vorstellen?“, Pythera trat zwischen die beiden Parteien, „Gabra, Rangiolfs Vater und Rìa, Finilyas Vater. Dann Yhsa, Rangiolfs Mutter und Irukye, Finilyas Mutter. Ich habe euch eingeladen, um der Weihe Rangiolfs beizuwohnen und das Arrangement der Ehe zwischen eurem Sohn und eurer Tochter mit einem Handschlag zu besiegeln.“ Endlose Minuten herrschte Totenstille. Rangiolf schluckte trocken. Hilfesuchend sah er zunächst Finilya und dann Pythera an. Die Augen der Heilerin glänzten voller Zuversicht. Gabra und Rìa sahen sich in die Augen und nickten einander zu – und dann kam die lang ersehnte Geste, welche die Ehe offiziell bestätigte.
„Auf Grund besonderer Umstände sollen die Ressourcen gestiftet werden“, fuhr Pythera fort, „von Rangiolfs Familie, mir selbst und denen, die freigiebige Gemüter sind und etwas dazugeben möchten, damit es ein schönes Hochzeitsfest wird. Dafür, Rìa, gibst du deine Tochter in die Obhut dieses jungen Mannes“, sie zeigte auf Rangiolf, „und du, Gabra, gibst deinen Sohn in die kundigen Hände dieser jungen Frau“, sie wies auf Finilya. „Nach der Eheschließung möge sich das Paar entscheiden zu gehen oder bei uns zu bleiben. Ihr beide …“, sie sah nun die Väter an, „erklärt euch bereit, alles in eurer Macht stehende zu tun, damit sie, im Falle ihres Hierbleibens, nicht heimatlos werden, denn das verdient niemand … Ressourcen hin oder her.“ Die Männer besiegelten Pytheras Bedingungen mit einem Handschlag.
„Und nun lasst uns zum Zeremonienplatz gehen.“ Sie ging voraus und alle folgten ihr.
„Warum hast du mir nicht gesagt, dass Pythera dich und deine Eltern eingeladen hat?“, fragte Rangiolf als sie außer Hörweite waren.
„Warum hast du mir nicht gesagt, dass du deine Eltern mitbringst?“, stellte Finilya die Gegenfrage.
„Weil ich nicht wusste, dass du kommst!“, antwortete er etwas patziger als er es beabsichtigt hatte.
„Pytheras Wege sind oft unergründlich“, schmunzelte Finilya und kniff ihm sanft in die Wange, „aber nun wird alles gut, du wirst Ovate und die Ehe ist besiegelt!“
„Die Ehe ist besiegelt“, wiederholte Rangiolf mechanisch, „genau so hat es Hiara gesagt, die Ràktsia.“
„Welche Ràktsia?“
„Ah, nicht wichtig!“
„Wir sind da!“, hörten sie Pythera. Finilya blickte auf und musste unwillkürlich lachen. Auch ihr Gefährte konnte seine Überraschung nicht verbergen. Sie standen auf jener Wiese, auf der sie sich nachts heimlich getroffen hatten.
„Hier war das also“, grinste Gabra, der die Reaktion der beiden bemerkt hatte.
„Ja, hier haben wir die Baumsämlinge gepflanzt“, ergänzte Rìa, „nachdem klar war, dass sie im NUTZWALD nicht gut aufgehoben sind.“ Pythera hörte es und lächelte.
„Dann ist dies genau der richtige Ort für deine Weihe, Rangiolf“, sagte sie und trat in die Mitte des Platzes. „Komm! Finilya, du auch. Rìa, du stellst dich vier Schritte hinter Rangiolf in den Norden und du Gabra, stellst dich hinter Finilya in den Süden. Yhsa, stelle dich bitte vier Schritte in westlicher und du, Irukye, in östlicher Richtung auf.“ Nun bildeten alle einen Kreis mit Pythera, Rangiolf und Finilya als dessen Zentrum. Pythera wandte sich an Rangiolf und Finilya.
„Eure Hochzeit“, begann sie und legte jedem von ihnen eine Hand auf die Schulter, „werden wir noch feiern – mit einer gebührenden Zeremonie. Betrachtet Rangiolfs Ovatenweihe nicht nur als das, was sie ist, sondern zugleich als einen Bund, der uns alle eint. Rangiolf und Finilya: Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr beide eure Heimat niemals vergesst, egal wie weit ihr euch entfernen möget. Dieser Bund ist zugleich ein Bund mit eurer Heimat. Sollte es euch nach langen Reisen je wieder verlangen hierher zurückzukehren, so tut es! Zaudert nicht!“
„Lange Reisen!“, wiederholte Rangiolf leise. Er nahm die Hände seiner Zukünftigen und als sich ihre Blicke trafen, erkannte er, dass auch sie ihre Entscheidung längst gefällt hatte, die Entscheidung, ihm überall hin zu folgen! – Die Heilerin beugte sich zu Finilya herab und trennte die goldene Eichel von der Kette, die sie trug. Sie hielt sie in die Höhe, sodass alle Anwesenden sie sehen konnten und sagte:
„Wà-is dhàt | ai maat aat.“ Nun drehte sie sich nach Norden zu Gabra und fügte hinzu: „Ir-kà wuegioth sa p̣ài.“ Der Gniri verbeugte sich und wiederholte:
„Ir sa pài.“ Die Heilerin wandte sich nach Süden und sah Rìa an.
„Ir-kà hìgioth sa matheri.“ Finilyas Vater machte es Gabra nach.
„Ir sa matheri“, wiederholte er und verbeugte sich ebenfalls. Schließlich sah Pythera Irukye an, die im Osten stand.
„Ir-kà sàgioth sa fàtheri.“
„Ir sa fàtheri“, Irukye verbeugte sich. Als Letztes war Yhsa dran.
„Ir-kà sàgioth sa wóiàt.”
„Ir sa wóiàt“, die alte Frau verbeugte sich ebenfalls.
„Nachdem wir nun den Segen aller vier Himmelsrichtungen, aller vier Elemente und somit der Mutter haben“, rief die Heilerin laut, „möge die Eichel ein Symbol unserer aller Verbindung sein und ein Zeichen eures Bunds der Ehe. Dich, Rangiolf“, sie sah ihn freundlich an, „soll sie in dein Ovatenleben begleiten – Ai sookth haath báis-mechint | moos aath ràhtsa.“ Nun holte sie einen aus feinem, aber äußerst beständigem Wurzelwerk gearbeiteten Stirnreif hervor, legte die Eichel in die mittige Vertiefung und setzte ihn dem jungen Mann auf das Haupt. Finilya sah ihm dabei tief in die Augen und seufzte ergriffen auf.