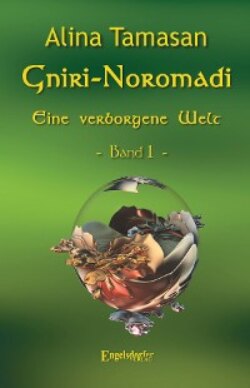Читать книгу Eine verborgene Welt - Alina Tamasan - Страница 7
In der Psychiatrie (Giri-ù thra-ha)
ОглавлениеIhre Eltern waren nicht zu Hause, und das war auch gut so. Keiner sollte sie in diesem aufgelösten Zustand sehen, das würde nur unangenehme Fragen nach sich ziehen. – Im Frühjahr war sie 20 geworden, sie hatte das Abitur in der Tasche und wartete auf einen Studienplatz in Biologie, also war sie eine gute Tochter. Oder?
Noromadi saß auf dem Bett und sah in den Spiegel gegenüber. Große schwarze Augen blickten sie aus einem kleinen runden Gesicht mit hohen Wangenknochen an. Ihre Haut war dunkel, das pechschwarze Haar fiel in dicken, widerspenstigen Locken über ihre schmalen Schultern. Manchmal, so schien es ihr, fühlte sich ihr Schopf an, als bestünde er aus lauter Borsten, die sich kaum bändigen ließen. Sie sah auf ihre Hände, die klein und schmal waren wie sie selbst, aber auch irgendwie spitz, fand sie – fast wie Pinzetten. Noromadi fand ihr Aussehen unnatürlich, einfach nicht normal!
Sie zweifelte an sich und fragte sich zum wiederholten Mal, wie so jemand wie sie, die Tochter dieser Eltern sein konnte? Ihr Vater war großgewachsen und blond, ihre Mutter etwas kleiner, sie hatte hellbraunes, leicht rötlich schimmerndes Haar. Es waren ganz normale ehrbare Menschen mit einem gut bezahlten Job, einem Eigenheim und kleinen Garten. Was also hatte jemand wie sie bei solchen Menschen zu suchen? Tränen sammelten sich langsam in ihren dunklen Augen.
„Ich muss es jemandem erzählen“, flüsterte sie mit heiserer Stimme, „sonst platze ich! Aber wem? Wem soll ich es sagen? Nicht, dass sie mich wieder in die Psychiatrie stecken, wie damals, als ich mich umbringen wollte. Dabei hatte ich doch nur diesen Engel gesehen, der war so wunderschön. Ich wollte zu ihm, fort von diesem schrecklichen Ort auf der Erde, fort von diesen normalen Menschen …“ Die junge Frau stockte und rieb sich aufgeregt die kleinen, spitzen Hände. „Noromadi, lass den Unsinn, du musst zur Vernunft kommen“, ermahnte sie sich. Sie wischte sich die Tränen von den Wangen und dachte angestrengt nach. „Martin! Martin wird mich verstehen. Er ist doch mein Freund. Er liebt mich. Er wird mir zuhören und mich in den Arm nehmen, mich unterstützen … – Halt, stopp! Ist Martin wirklich der richtige?“ Martin war seit zwei Jahren ihr Partner: ein großer schlanker Mann mit dunkelbraunem kurzem Haar und wachen grauen Augen. Er studierte Informatik und war auf gewisse Weise brillant! Binnen kürzester Zeit konnte sein scharfer Verstand eine Fülle komplexer Zusammenhänge erfassen und zusammenfügen. Ein waschechter Naturwissenschaftler eben. In seiner Welt gab es nichts, was nicht logisch erklärbar wäre. Alles, was er erlebte, konnte er beweisen und begründen. Noromadi sah bei sich das Problem, weil sie das nicht konnte.
„Nicht mit dem, was ich erlebt habe. Das ist einfach nicht begründbar, nicht beweisbar, außer mir, sieht es ja keiner“, schluchzte sie. Trotzdem erhob sie sich, wankte zitternd zum Telefon und wählte Martins Nummer. Am anderen Ende klingelte es: ein Mal, zwei Mal … die junge Frau spürte, wie ihr das Herz bis in den Hals klopfte.
‚Er ist bestimmt nicht zu Hause‘, dachte sie und wollte schon auflegen, als sich Martin meldete.
„Hallo Schatz“, hörte sie ihn sagen, „ich bin gerade zur Türe rein und wollte dich anrufen, ob du Lust hast, mit mir einen Kaffee zu trinken. Es ist so herrliches Wetter.“ Die kleine Frau strich sich nervös eine Haarsträhne aus dem Gesicht und schluckte die Verzweiflung hinunter.
„Das ist schön“, bemühte sie sich, in einem heiteren Ton zu antworten, „der Sommeranfang lässt grüßen!“ Eigentlich hatte sie gar keine Lust, ihr Thema mit ihm an einem öffentlichen Ort zu besprechen. Andererseits, wo sollten sie hin? Hier, in ihrem Zimmer, wollte sie nicht reden, und die kleine Studentenbude, in der er wohnte, schien ihr auch nicht geeignet zu sein. Wenn sie es recht bedachte, gab es für solche Gespräche überhaupt keinen rechten Ort – und auch keine rechte Zeit.
‚Vielleicht beruhige ich mich auf dem Weg, dann behalte ich es einfach für mich‘, schoss es ihr durch den Kopf, ehe Martin sie aus den Gedanken rief.
„Also! Möchtest du?“, hörte sie ihn ungeduldig nachhaken.
„Ähm … ja, gerne.“
„Dann treffen wir uns in einer halben Stunde in unserem Lieblingscafé. Ich spendier dir auch ein Eis, wenn du möchtest.“
„Ja, gerne … bis dann“, antwortete sie und legte auf.
‚Noromadi, du dummes Ding‘, schimpfte sie sich, ‚du musst den Mund halten. Diese Dinge sind nicht für seine Ohren bestimmt. Er wird dich für verrückt halten. – Aber irgendwem muss ich es doch erzählen.‘
„Ach, ich schau mal!“, sagte sie sich laut und verließ das Haus. Es war in der Tat ein schöner Tag. Die Sonne schien schon ziemlich warm und nur ein paar harmlose Schleierwolken zogen über den Himmel. Die Vögel zwitscherten und es duftete nach frischem Gras und fruchtbarer Erde. Es war zweifelsohne ein Segen, dass ihr Haus so nah am Wald lag. Noromadi blickte sehnsuchtsvoll zur kleinen Allee, die in das grüne Reich führte. Schon als Kind hatte es sie in den Wald gezogen. Er gab ihr ein Gefühl der Sicherheit, das sie sonst vermisste.
„Nein, jetzt nicht!“, ermahnte sie sich. Sie drehte dem Wald den Rücken zu und stapfte entschlossenen Schrittes zu der einzigen Haltestelle des kleinen Ortes. Der Bus kam pünktlich und sie stieg ein. Im Inneren war es heiß und stickig, zum Glück fuhren nur wenige Fahrgäste mit, dicht gedrängte Menschenmassen machten ihr Angst. Nach einigen Minuten stieg sie erleichtert aus und sog tief die frische Luft ein.
‚Nicht so rein wie bei uns draußen, aber für eine Stadt ganz in Ordnung‘, dachte sie, während sie dem Café entgegenhastete. Sie fühlte sich schon viel ruhiger, doch sobald sie an das Ereignis dachte, das sie seit Tagen beschäftigte, überfielen sie sofort heftige Emotionen und Zweifel nagten in ihr. Sie spürte mehr denn je den Druck, diese Gefühle mit jemandem zu teilen. Von Weitem schon sah sie Martin an einem Tisch vor dem Café sitzen und Cappuccino schlürfen. Als sie auf ihn zukam, erhob er sich von seinem Stuhl, umarmte sie herzlich und gab ihr einen kurzen Kuss auf den Mund.
„Da bist du ja!“, sagte er erfreut. „Ich dachte schon, du bist unterwegs verschollen!“ Dann sah er ihr in die Augen und stutzte. „Was ist? Hast du geweint?“ Noromadi betrachtete gedankenverloren das bunte Wechselspiel seiner Aura – Farben, die nur sie sah. „Noromadi, ich rede mit dir, was ist los?“ Martin rüttelte sie leicht, sie schrak aus ihren Gedanken und sah ihn mit großen Augen an. „Ich hab doch schon am Telefon gemerkt, dass etwas nicht mit dir stimmt. Was ist passiert?“
„Ich … ich …“, stammelte sie und schon rannen ihr wieder Tränen über die Wangen, „ich muss dir was erzählen.“ Sie bestellte sich einen Kaffee und trank in kleinen hastigen Schlucken, derweil Martin gespannt wartete. Sie war hin und her gerissen, sollte sie es ihm sagen oder nicht? Doch nun konnte sie nicht mehr zurück. Sie atmete tief ein und begann:
„Ehrlich gesagt, habe ich ein wenig Angst, es dir zu erzählen.“
„Aber warum?“, fragte der junge Mann perplex.
„Weil du mich dann sicher für verrückt hältst.“ Martins Augen verengten sich, ein unbehagliches Gefühl beschlich ihn. Irgendetwas war an dieser Frau, das er nicht verstand. Etwas Unheimliches ging von ihr aus. Trotzdem, es konnte doch unmöglich etwas geben, was sie ihm aus Angst verheimlichte. War es ein anderer Mann?
„Nein, nein, kein anderer Mann“, sagte sie und rieb sich zerstreut die Schläfen. Martin erschrak. Hatte sie etwa seine Gedanken gelesen?
„Was ist es dann?“, fragte er unsicher. Noromadi seufzte.
„Bitte, halte mich nicht für verrückt, und … erzähl es niemandem, ja?“ Sie sah ihn eindringlich an. „Versprich es mir!“
„Ja, ja, okay, ich verspreche es“, antwortete Martin unsicher und neugierig zugleich.
„Wahrscheinlich hast du in deinen Naturwissenschaften schon herausgefunden, dass es Dinge gibt, die man nicht erklären kann, zumindest nicht mit dem logischen Verstand.“ Martin fürchtete, dass dieses Gespräch wieder auf ihre Halluzinationen abzielte und wollte schon aufspringen, aber er hielt sich zurück, er wollte ihre Geschichte hören.
„Ich“, sie schluckte, „ich kann deine Aura sehen. Ich weiß, dass du im Moment sehr aufgewühlt bist und andere Energiefelder sehe ich auch. Das ist keine Einbildung, so wahr ich hier vor dir sitze! – Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Oder besser: Ich habe mich damit abgefunden. Aber das, was ich im Wald erlebt habe, das sprengt alles!“ Ihre Stimme zitterte und in ihren Augen funkelte die Angst.
„Was hast du im Wald erlebt?“, fragte Martin mit einer Mischung aus Neugier und Mitleid. Noromadi sah auf, sie gewahrte seine Skepsis.
„Bitte, Martin, so glaube mir doch!“, flehte sie. „Ich habe Kontakt zu sehr hellen Lichtwesen. Sie bestehen aus buntem Licht und ich … ich nenne sie Engel, weil sie sehr freundlich sind und mir wertvolle Ratschläge erteilen.“ Ihr Freund runzelte die Stirn. „Normalerweise höre ich ihre Stimmen in meinem Kopf und nehme sie als innere Bilder wahr. Aber als ich neulich im Wald war, da ist mir ein solches Wesen erschienen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich es leibhaftig vor mir gesehen und nicht nur im Kopf. Du hättest das sehen sollen: diese Farben, dieses Licht und diese unglaublich warme und volltönende Stimme. In dem Moment fühlte ich mich wie im Himmel – sicher und geborgen. Das Wesen stellte sich vor und erzählte mir die unglaublichste Geschichte meines Lebens!“
„Wie lange geht das schon, dass du so was siehst?“ Martin vermied es geflissentlich, das Wort wieder zu benutzen.
„Ah, schon lange“, Noromadi machte eine wegwerfende Handbewegung, „ich wollte es eigentlich niemandem erzählen, aber es war so schön, zu schön, um es für mich zu behalten. Und außerdem … na ja, es ist ja nicht nur das, vor allem ist es die Geschichte, die mir der Engel erzählte. Seitdem ich die kenne, war ich nicht mehr im Wald!“
„Was für eine Geschichte war das denn?“
„Er erzählte mir vom Weltenbruch. Er sagte, früher hätte es eine Welt gegeben, in der jeder Jeden sehen konnte. Da sahen wir Menschen die Lichtwesen und Wesen der Natur. Und dann, sagte er, wäre die Welt wie ein Kuchen in drei Teile zerborsten, und deshalb gäbe es nun drei voneinander getrennte Welten: die der Menschen, die der Naturwesen und die geistige Welt der Lichtwesen. Wir Menschen hätten mit der Zeit vergessen, dass es die Welten der anderen gibt, deswegen sähen wir sie nicht mehr. Damit gehe es uns nicht gut, und auch die Naturwesen litten darunter, dass sie den Kontakt zu den Lichtwesen und uns verloren haben. Das alles bekommt natürlich auch der Erde nicht, denn alles, was eigentlich zusammengehört, ist entzweigebrochen. Dann erzählte mir der Engel von einer Prophezeiung. Nämlich, dass eines Tages ein Mischwesen erscheine, das zum Einen aus dem Naturvolk und zum Anderen aus dem Volk der Menschen stamme, und das diese Welten vereine. Dabei sah er mich ganz eindringlich an, weißt du? Ganz so, als sollte ich das sein! Ich zitterte am ganzen Körper. Aber er strich mir durchs Haar und sagte: ‚Es ist ganz wichtig, dass du dich nicht fürchtest, mein Kind.‘“ Noromadi wollte fortfahren und erklären, was der Engel ihr von diesem fremden Volk geweissagt hatte, aber sie schluckte die Worte hinunter, Martins Aura gefiel ihr gar nicht.
„Du glaubst also, du bist diese Auserwählte?“, er sah sie skeptisch an.
„Ich … ich“, stammelte sie, „ich weiß es nicht. Ich meine, es ist etwas Spezielles, solche Dinge zu sehen, und es ist umso unheimlicher, auf einmal da mit hineingezogen zu werden. Ich weiß es nicht … Sieh mich doch mal an, Martin, und dann sieh dich an. Ich bin dir nicht geheuer, zu Recht, denn ich bin nicht von dieser Welt.“ Sie schluchzte und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Die Leute an den Nachbartischen starrten herüber, das war dem jungen Mann sichtlich unangenehm.
„Na, komm schon“, flüsterte er, „hör auf zu weinen.“
„Ach“, schluchzte sie, „vielleicht hast du recht, vielleicht ist dieser ganze Kram der reinste Psycho-Unsinn. Am liebsten würde ich alles stehen und liegen lassen und mich verkrümeln. Irgendetwas fände sich schon …“
„Für was?“, bohrte Martin nach. „Sag nicht, du möchtest dich mal wieder umbringen!“, setzte er mit einem leisen Anflug von Panik hinzu. „Hat dir das eine Mal nicht gereicht? Musst du wieder damit anfangen? Warum, in Herrgottsnamen, beschäftigst du dich nicht wie andere Frauen mit normalen Dingen, Partys, Kino und was weiß ich alles?!“
„Ich kann doch nichts dafür!“, schluchzte Noromadi hilflos. „Ich will das doch gar nicht. Ich will normal sein, so wie du und die anderen Frauen, wie meine Eltern und wie alle Menschen.“
„Gut!“ Martin beruhigte sich und legte seinen Arm um sie. „Versprich mir, dass du nie wieder an solchen Unsinn denkst, hast du verstanden?“ Er sah sie eindringlich an. „Ich liebe dich, hörst du? Und ich will dich nicht an irgendwelche Psychoklempner verlieren, die dich wegsperren und mit Medikamenten vollpumpen, bis du nur noch ein Schatten deiner Selbst bist!“
„Du erzählst es niemandem, ja? Versprich es mir!“
„Okay, okay, ich verspreche es! Und nun wisch dir die Tränen aus dem Gesicht und setz dich wieder gerade hin, wir werden hier noch zum Gespött der Leute. Du trinkst jetzt deinen Kaffee aus, gehst nach Hause und legst dich etwas schlafen. Hast du verstanden?“ Noromadi nickte ergeben. Insgeheim fühlte sie sich jedoch wie ein kleines Kind zurechtgewiesen und verraten. Nicht nur, dass er sie nicht ernst nahm, er hielt sie wirklich für verrückt. – War sie es? Wut keimte in ihr auf, aber sie sagte nichts, sondern tat, wie ihr geheißen. Bei der Verabschiedung umarmte sie ihn matt, sein Kuss fühlte sich kalt und herzlos an.
Auf dem Weg zur Haltestelle fragte sie sich, ob Martin wirklich der Richtige für sie war. Bisher hatte sie ihn immer als eine Art „Realitätsanker“ gesehen, der sie am Boden der Tatsachen hielt und ihr aufzeigte, wie „Normal-Sein“ funktionierte. Natürlich wollte sie normal sein, aber es ließ sich immer weniger leugnen, dass sie es nun einmal nicht war.
‚Er braucht eine Frau, die so ist wie er. Eine, für die nur der Verstand zählt, eine strebsame junge Naturwissenschaftlerin aus gutem Hause, die Manieren hat und weiß, was sich gehört. Mit ihr kann er sich dann über die logischen Zusammenhänge der Welt unterhalten und eineinhalb Kinder zeugen.‘ Noromadi schüttelte den Kopf. ‚Sei nicht so gehässig‘, fuhr sie sich an. ‚Hättest du dir einen Typen geangelt, der so ist wie du, meine Güte, dann wärt ihr beide irgendwo im rosafarbenen Nirwana verschwunden. Also sei froh, dass du Martin hast!‘ – Sie seufzte und stieg in den Bus. Als sie zu Hause ankam, war sie froh darüber, dass ihre Eltern noch nicht da waren. Sie ging auf ihr Zimmer und legte sich ins Bett. ‚Ich muss aufhören zu denken‘, dachte sie, ehe sie in einen unruhigen Schlaf fiel.
Doktor August betreute Noromadi seit sie vor gut drei Jahren aus der geschlossenen Anstalt entlassen worden war und sie besuchte seine Sprechstunde wöchentlich. Die vielen Sitzungen hatten zu dem gewünschten Ergebnis geführt. Mit Stolz blickte der Psychiater auf seine Patientin, die nach dem gelungenen Schulabschluss nun aufs Studium wartete. Sie mochte zwar nicht überragend gescheit sein, aber sie hatte sich durchgebissen und war zu einer durch und durch integrierten jungen Frau geworden. Was ihm ihre Eltern kürzlich über sie berichtet hatten, konnte daher kaum möglich sein. Als Freund der Familie lag ihm das Schicksal des Mädchens sehr am Herzen.
Als Noromadi den Raum betrat, bemühte er sich, seine innere Erregung nicht anmerken zu lassen. Er erwiderte ihren Gruß und bat sie, Platz zu nehmen.
‚Irgendetwas ist heute anders‘, schoss es Noromadi durch den Kopf. ‚Seine Aura flackert so merkwürdig und ist von tiefem Blau.‘
„Womit wollen wir beginnen?“, eröffnete sie die Sitzung. Dr. August rieb sich nervös die dünnen Hände und räusperte sich umständlich.
„Was für eine Farbe hat meine Aura?“ Die junge Frau zuckte überrascht zusammen, ihr Kinn klappte auf und wieder zu.
„Wie bitte?“, fragte sie unsicher.
„Meine Aura, Noromadi, welche Farbe hat sie?“ Einen Augenblick lag Totenstille im Raum. Sie wusste nicht, was sie antworten sollte. Glaubte dieser Mann jetzt wirklich an übernatürliche Erscheinungen oder stellte er diese Frage, weil er ihr eine Aussage entlocken wollte, die ihr womöglich zum Verhängnis werden könnte?
„Was ist eine Aura?“, fragte sie vorsichtig und blickte ihn wie ein scheues Reh an.
„In einem Wissenschaftsmagazin habe ich darüber gelesen“, antwortete Dr. August knapp. „Es heißt, es sei ein messbares farbiges Energiefeld, das jeder Mensch ausstrahlt, das aber mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. Aus deiner Akte weiß ich, dass du sie früher sehen konntest, kannst du es wieder?“ Noromadi murmelte:
„Blau.“
„Seit wann bist du wieder in der Lage sie zu sehen?“
„Och“, wisperte die kleine Frau, „seit anderthalb Jahren.“
„Ah so! Was siehst du noch? Es gibt sicher eine Menge Dinge hier, ja, zum Beispiel in diesem Zimmer. Dinge, die ich nicht sehen kann.“
„Da ist nichts …“
„Nichts? Wirklich rein gar nichts?“ Der Doktor beugte sich vor und sah sie mit seinen blauen Augen forsch an. Dabei rang er sich ein wissendes Lächeln ab.
„Was wollen Sie hören?“
„Was hier in diesem Raum noch ist.“ Noromadi rieb sich nervös die spitzen Finger und rutschte auf ihrer Liege hin und her. Derweil wanderten ihre Augen durch den Raum und blieben plötzlich an einem Punkt rechts hinter dem Psychiater stehen. „Was ist da?“, fragte Dr. August und wandte sich um. Die junge Frau hatte hinter seinem eigenen ein weiteres Energiefeld entdeckt. Es war bunt und formte undeutlich eine Gestalt, deren Umrisse sie jedoch nicht erkennen konnte. Aber sie fühlte deutlich die Liebe und Geborgenheit, die von ihm ausgingen. Über ihrem eigenen Kopf schwebte eine Wolke, die violett leuchtete.
‚Bitte helft mir! Was soll ich sagen?‘, schrie sie ihre Bitte an die geistige Welt, aber sie erhielt keine Antwort.
„Noromadi?“, hakte der Psychiater nach.
„Rechts hinter Ihnen steht jemand“, antwortete sie bebend.
„Wer?“
„Es ist Ihr Schutzgeist – manche nennen es Schutzengel.“
„Was ist noch im Raum?“
„Mein Schutzengel.“
„Wo steht der?“
„Er schwebt über meinem Kopf.“
„Noromadi, machen dir diese Erscheinungen Angst? Wie fühlst du dich dabei?“
„Meistens gut.“
„Aber nicht immer?“
„Nein, manchmal machen sie mir Angst.“
„In welchen Fällen?“ Die kleine Frau schluckte. Wieder blickte sie auf seine Aura, und auf seinen Schutzgeist. Auf einmal formte sich aus der bunten wabernden Energie eine Hand, die eine Geste machte: Nein!
„Ach, manchmal ist es einfach nur ungewohnt, dass ich Dinge sehe, die sonst keiner sieht, mehr nicht“, antwortete sie so selbstbewusst wie möglich.
„Da haben mir deine Eltern aber etwas anderes berichtet!“ Dr. August lehnte sich zurück und schrieb etwas in sein Notizbuch.
„Meine Eltern?!“ Aus Noromadis Gesicht wich alle Farbe.
„Ja, deine Eltern. Vorgestern riefen sie mich ganz aufgelöst an, weil sie erfahren hatten, dass du mit dem Gedanken an Selbstmord spielst?“
„Von wem haben sie das erfahren?“ Noromadi biss sich dafür sogleich auf die Lippe.
„Als Freund der Familie weiß ich, dass sich sowohl dein Partner Martin als auch deine Eltern Sorgen um dich machen. Und wenn ich mich an ihre Aussage erinnere und höre, was du mir da erzählst, geht es mir ähnlich!“
„Aber ich habe nie gesagt, dass ich mich umbringen will“, protestierte die kleine Frau aufgebracht.
„Auren und Engelserscheinungen, das alles mögen Dinge sein, die in einigen Sitzungen therapierbar sind, aber die Geschichte mit den getrennten Welten, irgendwelchen Prophezeiungen oder auserwählten Mischwesen, das ist definitiv etwas, was mir Sorgen bereitet! Diese Sache ist es nämlich, die dir Angst macht, und womöglich für dich ein Grund mehr, Dinge zu tun, die nicht gut für dich sind!“
„Aber verstehen Sie denn nicht?!“, rief Noromadi aufgelöst. „Ich habe das nie gesagt … und wenn, würde es Sie am allerwenigsten angehen!“
„Hör mal, mein liebes Kind“, die Stimme des Psychiaters wurde samtig. „Ich verstehe, wie du dich fühlst. Solche Angelegenheiten sind nicht einfach zu verarbeiten. Dass du in diesem Fall Panikattacken hast, ist völlig normal. Was ich dir sagen möchte, ist: Du bist damit nicht allein!“
„Wie meinen Sie das?“
„Es gibt Menschen, die ebensolche Dinge erleben, Dinge, die sie nicht erklären können und an denen sie verzweifeln.“
„Und, was möchten Sie mir vorschlagen?“, fragte Noromadi kühl.
„Lass dir helfen.“
„Sie meinen, ich soll wieder in die Psychiatrie?“
„Nicht in die geschlossene! Das auf keinen Fall! Es gibt eine offene Abteilung, in der du bestens aufgehoben bist.“
„Vergessen Sie es, ich gehe auf keinen Fall wieder in die Klappse!“
„Ich verstehe deine Einwände. Nur, überlege einmal: Du bist so eine wundervolle junge Frau mit einem guten Abschluss und Aussicht auf einen Studienplatz. Anstatt dich mit Auren und Engelserscheinungen herumzuplagen, solltest du dich in eine Therapie begeben. Dann wirst du bald als geheilt entlassen und ein schönes Leben wartet auf dich!“
„Sie meinen also, wenn ich es noch einmal auf mich nehme, dann hab ich’s los? Und ich kann ein normales Leben führen?“
„Genau das meine ich. Martin liebt dich und ist an deiner Seite. Natürlich hat er dir versprochen, nichts weiterzuerzählen, aber er war so besorgt, dass er sich schließlich hilfesuchend an deine Eltern wandte … und diese dann an mich.“
„Warum hatten mein so besorgter Partner und meine Eltern nicht den Mumm, mir das ins Gesicht zu sagen?“, rief Noromadi wütend aus und ballte ihre kleine Hand.
„Hättest du denn auf sie gehört?“, fragte Dr. August sanft.
„Nein, womöglich nicht …“, antwortete die junge Frau schlaff.
„Siehst du?“ Dr. August erhob sich aus seinem Sessel, ging zu einem der Aktenschränke und holte einen dicken Ordner hervor. Er blätterte darin herum und zog schließlich ein Papier heraus. „Das hier“, sagte er, stellte den Ordner wieder an seinen Platz und setzte sich, „ist eine Einverständniserklärung, dass du dich behandeln lassen möchtest.“
„Sie wollen, dass ich das jetzt sofort unterschreibe?“
„Natürlich nicht“, antwortete der Psychiater. „Du kannst sie mit nach Hause nehmen und es dir dort noch einmal in Ruhe überlegen“, fügte er mit weicher Stimme hinzu. Noromadi entspannte sich etwas.
„Ist die Sitzung heute beendet?“ Die junge Frau erhob sich wankend und verabschiedete sich mit einem knappen Gruß. Als sie die Treppen hinunterlief, musste sie sich an der Wand abstützen, so schwindlig war ihr. Die Gedanken drehten sich in ihrem Kopf wie ein wildes Karussell.
‚Psychiatrie … du kommst in die Psychiatrie … da gehörst du hin, du kleines hässliches Ding! – Aber ich wollte mich doch gar nicht umbringen, und habe es auch nicht vor. Warum glauben mir die Menschen nicht? Ich bin normal, vollkommen normal, nur hellsichtig, mehr nicht. Ist Hellsicht ein Verbrechen? Eine Krankheit, die es auszumerzen gilt?‘
Als sie ins Freie trat, fühlte sie sich schlagartig besser. Warmes Sonnenlicht schien auf ihre dunkle Haut. Die Luft war angenehm mild, und trotz der schweren Gerüche der Stadt konnte sie den Duft des zarten Grüns wahrnehmen. Irgendwo in einem der Ahornbäume an der Straße, die von eilig vorüber ziehenden Autos befahren wurde, saß ein Vogel und erfreute die Betonwelt mit seiner Melodie. Mit unsicheren Schritten überquerte Noromadi die Straße und nahm auf einer Bank Platz.
„Hier sitzt du, kleiner Vogel“, flüsterte sie lächelnd, als sie ihn in der Krone erblickte. Ein Rotkehlchen sah sie mit seinen Knopfaugen aufmerksam an und musizierte weiter. Noromadi kam es vor, als wolle es sie aufmuntern. Sie lächelte dankbar und nickte ihm zu. Dann schloss sie die Augen und ließ sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Sie wollte noch nicht nach Hause gehen. Warum das so war, wusste sie auch nicht, doch als ihr die Einverständniserklärung einfiel, übermannte sie sofort ein unangenehmes Gefühl.
„Es nützt alles nichts, kleiner Piepmatz“, flüsterte sie und öffnete die Augen, „ich muss nach Hause.“ Sie sah den Vogel an. Der neigte sein gefiedertes Köpfchen zur Seite und sah sie mit einem seltsamen Glanz in den Augen an, als hätte er ihre Worte verstanden. Noromadi erhob sich und schlenderte gemächlich zur Haltestelle. ‚Nur nicht hetzen‘, dachte sie. Im Bus überkam sie ein Schwindelgefühl. Ihr Magen krampfte sich zusammen, sie kämpfte gegen die aufkommende Übelkeit. Die Geräusche um sie herum verschwammen zu einem undefinierbaren Teppich, die Farben der vorbeiziehenden Landschaft verblassten.
„Es wird etwas Schlimmes passieren“, flüsterte Noromadi benommen, während sie auf wackeligen Beinen zum Ausstieg wankte. Draußen wich die Übelkeit einer starken inneren Anspannung, das Karussell beruhigte sich. Langsam ging sie nach Hause.
„Wie sagt meine alte Freundin immer? Noromadi, Contenance!“ Ja, Würde und Haltung, das brauchte sie jetzt. Sie betrat den Flur und hörte Stimmen aus dem Wohnzimmer. Noromadi atmete tief ein, strich sich die Haare zurecht und spannte ihren Körper. Dann setzte sie eine heitere Miene auf und betrat das Wohnzimmer.
„Was ist denn der Anlass dieses fröhlichen Zusammentreffens?“, fragte Noromadi lächelnd und sah von einem zum anderen. Ihre Eltern, die sich offensichtlich sehr angeregt mit Martin unterhalten hatten, wichen – genau wie er – ihrem offenen Blick aus.
„Setz dich doch, mein Kind!“, wies ihr Vater Wilhelm sie ernst aber freundlich an. „Möchtest du auch einen Kaffee?“
„Nein, danke!“ Noromadi nahm auf einem kleinen Hocker Platz, der etwas abseits stand. Jetzt vermied sie es, Martin anzusehen.
„Also … du kommst ja gerade aus der Sprechstunde“, begann ihre Mutter Clara zögerlich, „was hat denn Dr. August gesagt?“
„Warum fragst du ihn nicht selbst? Ihr kennt euch doch so gut“, spie ihr die junge Frau ins Gesicht. „Dort ist das Telefon! Wenn ihr schon so gut darin seid, mich hinter meinem Rücken bloßzustellen, kannst du ihn ebenso gut anrufen und nachfragen!“
„Aber, Noromadi, du verstehst das nicht!“, fuhr Martin dazwischen.
„Was versteh ich nicht? Dass du mich verraten hast, obwohl du mir hoch und heilig versprochen hast, es nicht zu tun? Dass du mein Vertrauen und meine Liebe missbraucht hast? Oh doch, ich verstehe sehr wohl. Ich verstehe euch alle sehr wohl!“ Sie blickte verächtlich in die Runde. „Anstatt mit mir zu sprechen, rottet ihr euch hinter meinem Rücken zusammen und schiebt mich in die Psychiatrie ab. Das ist ja auch viel einfacher, als sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, nicht wahr? Aus den Augen, aus dem Sinn. Weg mit dem Störenfried – eure heile Welt soll bloß nicht befleckt werden.“
„Ich verbitte mir diese Worte!“, sprang Wilhelm wutentbrannt auf. „Wie kannst du es wagen, so mit uns zu sprechen? Du weißt genau, dass wir nur dein Bestes wünschen. Meinst du, uns macht es Spaß, dich so zu sehen? Niemanden schmerzt es mehr als uns, dich in diesem traurigen Zustand in der Psychiatrie zu sehen. Es war unser letzter Versuch, dich in die Realität zurückzuholen, damit du lebst! Ich habe dir immer beigestanden, und ich tue es noch, aber, meine junge Dame, ich unterstütze dich ausschließlich in gesunden Dingen, damit was aus dir wird!“
„Aus mir wird nie was.“ Noromadi sank schlaff in sich zusammen und begann bitterlich zu weinen. „Ich bin einfach nicht so wie ihr …“, flüsterte sie.
„Du sollst nicht weinen“, sagte Clara mitfühlend. Sie kniete sich neben sie und tätschelte sanft die Wange ihrer Tochter. „Es ist doch nur noch dieses eine Mal. Du warst doch auf einem so guten Weg, und bist es sicher noch! Bitte, lass dich behandeln. Es ist eine offene, freundliche Station, in der nicht diese Irren herumlaufen, sondern normale Menschen mit vorübergehenden Problemen. Der Stationsarzt ist ein sehr umgänglicher Mann. Er wird dich gut behandeln. Und wenn du als geheilt entlassen bist, wird bestimmt auch dein Studienplatz bewilligt sein, und du kannst ein neues Leben beginnen, ohne die Sorgen und Nöte, die jetzt auf deinen Schultern lasten.“ Noromadi fühlte sich von den Worten ihrer Mutter seltsam berührt.
‚Sorgen und Nöte, die auf meinen Schultern lasten‘, wiederholte sie in Gedanken. Dabei kam ihr wieder die Botschaft des Engels in den Sinn. Hatte er nicht von einer Prophezeiung gesprochen? Einer auserwählten Person … Währenddessen hatte sein Blick inständig auf ihr geruht. Ja, sie war die Auserwählte, die Gniri Noromadi … Die junge Frau erschrak und schob die Gedanken sofort beiseite. Wie viel aussichtsreicher war es doch, das einfache Leben einer Biologiestudentin zu führen, ohne die Bürde des ganzen Weltvereinigungskrams? Sie entspannte sich ein wenig und sah ihrer Mutter in die hellbraunen Augen.
„Vielleicht habt ihr recht“, sagte sie langsam und holte die Einverständniserklärung hervor. „Es ist doch viel leichter, ein normales Leben zu führen, ohne diesen ganzen Kram, nicht wahr?“ Dem stimmten alle zu. Mit zitternder Hand setzte sie ihre Unterschrift auf das Papier.
Dr. Müller, der Stationsarzt der offenen Abteilung der Psychiatrie, war ein Freund des Psychiaters und als solcher ebenso auch ein Freund der Familie. Noromadi saß ihm gegenüber, sodass sie die Farben seiner Aura deutlich sehen konnte und lauschte geduldig seinem Monolog über die anstehende Behandlung. Dabei fühlte sie sich wie ein Tier in der Falle.
‚Ein Freund des Freundes der Familie‘, grübelte sie. ‚Seit Jahren umgeben sich meine Eltern mit einem Netzwerk von Seelenklempnern und Ärzten. Denn Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, wenn jeder jeden kennt, ist es nur allzu einfach, mich ruhig zu stellen. Niemand erfährt von den Machenschaften, die sich innerhalb dieses Kreises abspielen, alles ist wasserdicht!‘
„Noromadi!“, hörte sie den Arzt plötzlich rufen. „Hörst du mir überhaupt zu?“ Die junge Frau zuckte zusammen und nickte eifrig.
„Was habe ich gesagt?“, fragte er herausfordernd.
„Dass Sie mich erst mit Neuroleptika und später mit Antidepressiva behandeln werden“, wiederholte sie brav. Der Arzt entspannte sich.
„Ja, und dass du dir wegen der Nebenwirkungen keine Gedanken machen sollst, da diese vorübergehender Natur sind.“
„Das müssen Sie nicht erklären, ich weiß es noch vom letzten Mal.“
„Das ist eine offene Station“, fuhr der Mann beschwichtigend fort, „die Medikamente, die du jetzt erhältst, sind nicht so stark wie damals.“ Noromadi nickte und schluckte jegliche Widerworte hinunter. Der Arzt erhob sich und begleitete sie auf ihr Zimmer.
„Das“, lächelte er, „ist dein Reich! Ein Einzelzimmer“, schob er freundlich hinterher. „Deine Eltern haben dir Bücher und Zeitschriften dagelassen, schön. Ich lasse dich jetzt allein, damit du dich einrichten kannst. Nachher kommt eine Schwester, sie wird dich in den Aufenthaltsraum bringen, damit du auch die Anderen kennenlernst. – Mehrmals in der Woche finden Kurse und Sitzungen statt. Wir führen sie in der Gruppe und einzeln durch. Die Schwester wird dir alles erklären.“
„Sind die Sitzungen alle bei Ihnen?“
„Hier bei uns gibt es neben Einzel- und Gruppengesprächen eine Mal-, Tanzund Musiktherapie. Nur die Einzel-Gespräche sind bei mir. Alles andere wird von meinen Kollegen durchgeführt.“
„Ich hoffe, dass ich nach Einnahme der Medikamente noch in der Lage bin, die Termine auch mitzumachen“, seufzte Noromadi. Der Stationsarzt kräuselte die Stirn und verließ den Raum.
„Ein gewaltiger Vorzug, Freund der Familie zu sein“, flüsterte sie, „so bekommt man ein Einzelzimmer …“ Ein großes vergittertes Fenster mit Blick auf den Stationsgarten ließ viel Licht in den goldgelb gestrichenen Raum. Neben dem Bett stand ein kleiner Nachttisch mit Lampe, daneben ein Kleiderschrank, außerdem gab es einen Schreibtisch mit Stuhl. Sie packte ihre Habseligkeiten aus und verstaute sie im Schrank. ‚Offene Station hin oder her, alles derselbe Kram‘, dachte sie stirnrunzelnd und ließ sich auf das Bett fallen.
Die Schwester war groß, hager und sah verhärmt aus. Fältchen umgaben ihre runden dunklen Augen, deren Glanz trotz Alter und Müdigkeit noch nicht erloschen war. Sie begrüßte Noromadi mit einem leichten Händedruck und einem freundlichen Lächeln. Dann holte sie eine Pillenschachtel mit mehreren Fächern hervor, welche die Aufschriften „Morgen“, „Mittag“ und „Abend“ trugen. Sie legte sie auf den Nachttisch und Noromadi sah die vielen bunten Pillen. Sie staunte über die Menge.
„Nur fürs Erste“, sagte die Schwester beruhigend. „Es werden weniger werden.“ Sie zwinkerte der jungen Frau zu und entlockte ihr ein Lächeln. „Morgens um acht Uhr ist Frühstück, um 13 Uhr essen wir zu Mittag und um 18 Uhr zu Abend – alles in der Kantine! Sie müssen also zeitig aufstehen. Deswegen habe ich Ihnen auch den hier mitgebracht!“ Sie stellte einen kleinen rosafarbenen Doppelglocken-Wecker neben die Pillenschachtel. „Hier haben Sie eine Liste der Therapiesitzungen. Ich heiße übrigens Frau Fischer!“ Mit dünnem Zeigefinger tippte sie auf ihr Namensschild. „Sie können mich aber gerne Beate nennen.“
„Freut mich, ich heiße Noromadi“, lächelte die junge Frau und gab ihr erneut die kleine, dunkle Hand.
„Ein schöner Name. Sie stammen nicht aus Deutschland?“
„Doch, schon. Nur der Name kommt woanders her.“
„Woher denn?“, wollte Beate wissen.
„Meine Mutter hat ihn in einem Buch mit alten Namen gefunden, das sie in einem Antiquariat durchgeblättert hat. Sie erinnert sich jedoch nicht mehr an seine Herkunft.“
„Ah, schade“, bekannte die Schwester. „So, nun nehmen Sie bitte die Tabletten ein. Sie müssen vor der Mahlzeit eingenommen werden.“ Noromadi griff in das Fach „Mittag“ und holte die beiden Pillen heraus. Weigern, das wurde ihr jetzt klar, konnte sie sich nicht mehr.
‚Auf das neue Leben‘, dachte sie und spülte sie mit einem kräftigen Schluck Wasser hinunter. Dann wurde sie durch lange Korridore zum Aufenthaltsraum geführt.
„Links von der Tür hängt das schwarze Brett.“ Beate blieb stehen. „Die meisten Termine finden im Aufenthaltsraum statt. Rechts sehen Sie einen Plan, in dem die anderen Therapieorte verzeichnet sind.“ Der Plan war groß, bunt und naiv gestaltet, als sollten Kinder davor bewahrt werden, sich in den weiten Hallen der Psychiatrie zu verirren. Noromadi runzelte die Stirn, sagte aber nichts.
„Muss ich denn alle Termine besuchen?“
„Alle nicht, sie decken sich teilweise mit Ihren Einzelsitzungen. Wenn Sie jedoch keinen Einzeltermin haben, sollten Sie hingehen. Hier können Sie sich in großer Runde mit einem Therapeuten und Ihren Mitpatienten unterhalten.“ Sie deutete auf eine bestimmte Zeile. „Und da können Sie malen oder musizieren, je nachdem, wonach Ihnen ist.“
„Also sind die Termine Pflicht und zugleich keine Pflicht, richtig?“
„Genau!“, lachte die Schwester. „Lassen Sie sich regelmäßig sehen, dann ist alles gut. Wenn Sie in den Garten gehen wollen, fragen Sie in der Anmeldung nach. Haben Sie noch Fragen?“
„Wie kann ich Sie erreichen?“
„Einfach den Knopf neben Ihrem Bett drücken. Tun Sie das aber bitte nur in Notfällen, beispielsweise wenn Sie nicht mehr aufstehen können. Ansonsten bin ich im Schwesternzimmer des Korridors zu finden, auf dem Ihr Zimmer liegt.“
„Okay, vielen Dank!“ Noromadi nickte Frau Fischer noch einmal zu und betrat den Aufenthaltsraum. Er war hell und geräumig mit großen vergitterten Fenstern. Überall standen kleinere und größere Tische mit den entsprechenden Sitzgelegenheiten. Die Stühle erinnerten Noromadi an ihre Schulzeit: Sie waren klein und schienen hart zu sein. An den Wänden hingen Poster mit Naturaufnahmen, andere Stellen waren selbst bemalt. An der Unbeholfenheit der Ausfertigungen erkannte Noromadi, dass es sich um das Werk der Insassen handeln musste. In einer Ecke des Raumes hing weit oben, unerreichbar für jedermann, ein kleiner Fernseher. Später erfuhr die junge Frau, dass er, wenn mal keine Sitzungen und Kurse stattfanden, im Dauereinsatz war. Da keiner der Patienten ihn bedienen konnte, mussten sie sich mit dem begnügen, was gerade lief. Meistens waren es irgendwelche Soaps. In den einfach gezimmerten fest angeschraubten Regalen lagen Zeitschriften, weiche Gummibälle und allerlei anderer abgegriffener Kram. Die Angestellten hatten aber alles entfernt, was zu Wurfwaffen oder Stechwerkzeugen umfunktioniert werden konnten.
‚So ist das, man darf nur unter Beobachtung malen oder musizieren. Nicht, dass sich einer hier mit einem Pinselschaft noch die Augen aussticht!‘ Noromadi nahm auf einem der Stühle Platz, die ebenfalls am Boden angeschraubt waren. Den Tisch zu verrücken, wollte sie erst gar nicht versuchen. Sie strich sich eine Strähne von der Stirn und blickte sich unter den Patienten um. Überall saßen ruhig gestellte Menschen mit fahlen Gesichtern, die vor sich hin stierten. Ihre Auren wirkten matt. Noromadi blinzelte. Das Bild verschwamm plötzlich und die Energien um Gegenstände und Menschen schienen blasser zu werden. Sie schüttelte sich und erkannte mit schwerem Kopf, dass nun wohl die Wirkung der Medikamente einsetzte. Ihr Magen zog sich vor Übelkeit zusammen und sie erinnerte sich, was Frau Fischer gesagt hatte: ‚Die Medikamente sollen vor dem Essen eingenommen werden.’ Mit verkniffenen Augen versuchte sie die Uhrzeit von der neben dem Fernseher hängenden Uhr abzulesen. Es war Zeit für das Mittagessen. Sie erhob sich, aber ein heftiger Schwindelanfall packte sie und sie sank wieder auf den Stuhl. Plötzlich spürte sie eine kräftige Hand auf ihrer Schulter. Sie drehte den Kopf und blickte in die Augen eines farbigen Pflegers.
„Kommen Sie“, sagte er, „ich bringe Sie in die Kantine zum Mittagessen.“
„Mittagessen?“ Der Gedanke an Essen ließ sie sofort wieder würgen.
„Sie müssen etwas zu sich nehmen. Es wird Ihnen besser gehen, wenn Sie etwas im Magen haben, vertrauen Sie mir“, sagte der Pfleger freundlich aber bestimmt. Noromadi ließ sich von ihm aufhelfen und zur Kantine bringen. Essensgerüche schlugen ihr entgegen und sie musste neuerlich würgen. Der Mann wies sie an, sich zu setzen und holte ihr das Essen. Teller gab es nicht. Dafür waren in das Tablett Mulden eingelassen, in denen die einzelnen Komponenten lagen. Es gab Geschnetzeltes, Kartoffelbrei und etwas Gemüse. Der Mann drückte ihr eine Plastikgabel in die Hand und forderte sie auf, zu essen. Dann ließ er sie alleine.
Alles in ihr wehrte sich. Ein Teil von ihr wusste, dass der Pfleger recht hatte. Sie würde sich danach besser fühlen. Sie hielt die Luft an und schob sich etwas Brei in den Mund. Er schmeckte salzig.
‚Los jetzt‘, schrie sie sich an, ‚schluck es runter.‘ Mit verzerrtem Gesicht würgte sie den Happen hinunter und quälte sich noch die nächsten drei Bissen, dann wurde es schlagartig besser. Das Gefühl der Übelkeit verschwand. Nach und nach regte sich ihr Appetit. Sie aß schließlich alles auf und lehnte sich entspannt zurück. Ihr Kopf war zwar noch schwer, aber der Würgereiz war verschwunden. Als sie sich von ihrem Platz erhob, fühlte sie eine bleierne Müdigkeit in ihren Knochen, als hätte sie einen 12-Stunden-Arbeitstag hinter sich.
‚Dabei will ich mich doch gar nicht umbringen …‘, schwamm es in ihrem Kopf herum, während sie langsam auf ihr Zimmer schlurfte. Sie sank aufs Bett und fiel sofort in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Ihr schien, als seien kaum ein paar Minuten vergangen, als sich etwas warmes Schweres auf ihre Schultern legte.
„Noromadi, wach auf! Du musst zur Therapie!“, drang eine männliche Stimme freundlich aber bestimmt auf sie ein.
„Maas tufch …“, murmelte sie und wand sich auf dem Kissen.
„Noromadi?“, er rüttelte sie vorsichtig. Keine Reaktion. Einer plötzlichen Eingebung folgend, versuchte er, ihre Worte zu wiederholen und flüsterte ihr begütigend ins Ohr: „Mas, mas?“
„Ner … màkia màraf … maas tufch …“ Verwundert lauschte er den fremden Lauten, dann holte er geistesgegenwärtig einen Notizblock aus seiner Tasche und notierte sich, was er verstanden hatte. Er stellte den Wecker und ließ ihn klingeln. Noromadi schreckte empor und blinzelte verschlafen in den Raum.
„Was? Was? … Hallo, Herr Doktor“, murmelte sie und rieb sich die Augen. „Was ist los?“
„Es ist Zeit für deine Therapiesitzung! Du hast verschlafen! Komm.“
„Ich bin müde“, erwiderte sie matt, „können wir die Sitzung verschieben?“
„Es wird dir gleich besser gehen. Am Anfang, wenn die Medikamente anfangen zu wirken, ist es immer besonders hart. Wenn du jetzt aber nicht aufstehst, wirst du bis zum Abend schlafen und dich nachts schlaflos herumwälzen. Da helfen die allabendlichen Beruhigungsmittel auch nicht mehr viel.“ Noromadi sah ein, dass er recht hatte, sie erhob sich mühsam und wankte zur Tür. Sie spürte die starken Arme des Stationsarztes, die sie umfasst hielten und ließ sich von ihm bereitwillig führen. Im Korridor verfolgte er geduldig ihre kleinen schlurfenden Schritte und leitete sie schließlich in einen hellen Therapieraum. Noromadi ließ sich in den weichen Stuhl sinken und war schon im Begriff wieder einzuschlafen, als ihr ein bekannter Duft in die Nase stieg.
„Trink’ etwas Kaffee, das macht dich munter.“ Sie ergriff die Tasse und führte sie an die Lippen. Der erste Schluck tat ihr wirklich gut. Mutig trank sie in kleinen Schlucken weiter und wurde immer wacher.
„Fühlst du dich besser?“, fragte der Arzt freundlich.
„Ja“, antwortete sie knapp. Ihr Kopf war zwar immer noch schwer, aber sie war so wach, dass sie sich auf seine Worte konzentrieren konnte ohne einzunicken.
„Ich hoffe, du hast dich in der Kürze der Zeit gut bei uns eingelebt“, begann der Mann die Sitzung.
„Ja, das Personal kümmert sich gut um mich, besonders Frau Fischer“, antwortete Noromadi langsam.
„Ja, Frau Fischer ist unsere Perle, eine wirklich fähige Frau!“, antwortete Dr. Müller mit einem Anflug von Stolz in der Stimme. Dann kramte er einen kleinen Zettel aus der Tasche hervor. Er faltete ihn auseinander und überreichte ihn Noromadi.
„Was sind das für Worte?“, fragte er vorsichtig.
„Ner … mas … makia tufich …“, las die junge Frau laut vor. „Öhm, ich weiß nicht“, antwortete sie verwirrt.
„Du hast sie im Schlaf gesprochen. Ich habe sie aufgeschrieben, aber ich weiß weder die richtige Reihenfolge noch kenne ich die korrekte Schreibweise. Kannst du mir mehr dazu sagen?“ Noromadi beschlich ein seltsames Gefühl. Irgendwoher kannte sie diese Worte. Nur woher? Und was bedeuteten sie? Da erinnerte sie sich auf einmal an jenen Tag, an dem sie das letzte Mal aus dem Wald gekommen war. Damals hatte sie auch etwas vor sich hin gemurmelt, das ähnlich geklungen hatte. Der Zettel begann leicht in ihrer Hand zu zittern. Dr. Müller entging es nicht. „Hab keine Angst“, sagte er sanft, Noromadi blickte zu ihm auf. „Bitte, sag mir die Worte in der richtigen Reihenfolge und, wenn es geht, auch deren Bedeutung“, fügte er freundlich hinzu.
‚Spielt er dasselbe Spielchen wie Dr. August? Will er mir eine Aussage entlocken, um mich als verrückt abzustempeln?‘ Sie sah in seine braunen Augen, sein Blick verriet ihr, dass er sie ernst nahm. Sie atmete geräuschvoll aus und sah wieder auf das Papier in ihrer Hand. Derweil sie sich in die Worte einfühlte, fing ihr Herz immer stärker zu pochen an. Sie öffnete den Mund und klappte ihn wieder zu, öffnete ihn wieder und klappte ihn zu. Sie spürte einen zunehmenden Druck auf ihrem Brustkorb, als würde von dort etwas langsam ihre Kehle hinauf kriechen, groß und klumpig, bis es die Stimmbänder erreichte und …
„Ner …“, sie schluckte, „ner màkia …“, sie stockte, „hier fehlt ein Wort.“
„Welches Wort fehlt, Noromadi?“
„Màraf“, ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
„Und was kommt dann?“
„Sssss…“, stotterte sie mit bebendem Herzen, derweil sich der dicke Wortklumpen langsam aus ihrer Kehle wand. „Ssss… maas, maas …“, wiederholte sie immer wieder. Dieses Wort fühlte sich so unglaublich befreiend an, „tufch“, beendete sie schließlich den Satz.
„Bitte schreib es auf.“ Dr. Müller reichte ihr einen Stift. Mit krakeligen Buchstaben setzte sie den Satz auf das Papier.
„Gut gemacht!“, lobte sie der Arzt. „Nun sag sie alle nacheinander auf.“
„Ner … màkia màraf … maas tufch“, las sie flüssig und blickte ihn dabei erstaunt an. Ihre Stimme klang seltsam, als würde sie von weit her kommen, und als spräche ein Anderer als sie selbst.
„Was bedeuten die Worte?“
„Sie bedeuten: ‚Nein, will nicht, sehr müde’“, stotterte Noromadi und wurde bleich.
„Was ist das für eine Sprache?“ Die junge Frau rieb sich aufgeregt die spitzen Hände. Sie hatte geahnt, dass diese Frage folgen würde.
„Ich weiß es nicht“, flüsterte sie.
„Weißt du es nicht oder hast du Angst, es mir zu sagen?“, wollte Dr. Müller wissen. In Noromadi arbeitete es. Irgendwoher kannte sie diese Worte. Sie waren ihr vertraut, als hätte sie sie schon ihr ganzes Leben lang gesprochen. Sie schloss die Augen und rieb sich das Kinn. Ein Bild wollte sich vor ihr inneres Auge drängen, aber es verblasste so schnell, wie es gekommen war und hinterließ nur einen zarten Duft von blühenden Blumen, Gras, Erde und Baumrinde. Es war der Duft der Natur. Sie seufzte tief und Angst kroch in ihr hoch.
„Ehrlich, Herr Doktor, ich weiß es nicht“, sie sah ihn flehend an.
„Hast du manchmal seltsame Träume?“, bohrte er weiter. „Nachdem du zum Beispiel damals aus dem Wald kamst? Was hatte sich da für dich verändert?“ Mit wachsendem Unbehagen wand sich Noromadi auf ihrem Stuhl. Sie blickte in die dunklen Augen des Arztes und wusste, dass er ihre Geschichte kannte.
„Ich fühlte mich nicht gut“, murmelte sie niedergeschlagen.
„Was machte dir zu schaffen?“
„Dieses … Weltenverbinden“, antwortete sie noch leiser. Irgendetwas in ihr wollte plötzlich alles erzählen, es ein für alle Mal loswerden. Nie wieder wollte sie etwas damit zu tun haben. „Dieses Weltenverbinden … und das Bewusstsein, ein Mischwesen zu sein.“
„Erklär mir, was für ein Mischwesen?“
„Sie wissen es doch!“
„Ich möchte es von dir hören.“
„Ein Mischling aus Naturwesen und Mensch.“
„Und du glaubst, du bist ein solches? Diese Sprache eben, könnte das die Sprache der Naturwesen sein? Was sagte der Engel doch? Es wird ein Volk zu dir Kontakt aufnehmen, das … wie hieß es gleich?“ Er runzelte die Stirn und sah Noromadi erwartungsvoll an.
„Gniri“, flüsterte sie.
„Ja, genau! Also diese Gniri … Was sind das für welche?“
„Ich weiß es nicht.“
„Hast du Angst, es zu erfahren?“
„Ja.“
„Wenn du fühlst, dass du ein Mischwesen bist, dann weißt du bestimmt auch, was ein Gniri ist. Ich sehe es in deinen Augen. Ganz tief in dir drin spürst du es, oder?“
„Nein, tue ich nicht!“, wehrte sich Noromadi heftig und verschränkte die Arme vor der Brust.
„Was spürst du?“, fragte Dr. Müller mit einer Herzenswärme, die nicht zu überbieten war. Wie im Wahn begann sie sich langsam hin und her zu wiegen, derweil sie gegen die Tränen ankämpfte. „Lass es raus, ich sehe doch, wie sehr es dich quält.“
„Ich … ich habe sie noch nie gesehen. Ich weiß nur, es fühlt sich seltsam an. Na ja, stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens auf und blicken in den Spiegel. Sie sehen einen Menschen, aber Sie wissen, da steckt etwas anderes in diesem Körper, kein Mensch. Es ist, als hätten Sie sich verkleidet, um nicht aufzufallen. – Ja! Das ist es: Ich fühle mich, als sei ich zu Gast in diesem Körper, zu Gast in der Menschenwelt, zu Gast bei meinen Eltern. Sie kennen doch meine Eltern. Finden Sie, ich sehe Ihnen ähnlich? Nein! Ich bin klein und hässlich, eine kleine, hässliche Gniri!“
„Hast du deswegen vor diesen Wesen Angst, weil sie hässlich sind?“
„Nein, ich habe vor denen Angst, die mich als hässlich bezeichnen. All die, die mich so wie ich bin nicht wollen.“ Noromadi sah den Arzt gequält an.
„Wenn du glaubst, andere finden dich hässlich, ist das eine Widerspiegelung dessen, was in dir selbst vorgeht. Wenn du dich selbst nicht akzeptierst, wie kannst du dich dann vor anderen selbst vertreten? Diese Gniri, wie du sie nennst, sind Erfindungen deines Geistes, der sich weigert einzusehen, dass er weder klein noch hässlich noch unzulänglich ist. Wenn du dich selbst nicht als Teil der Gesellschaft akzeptierst, wird es kein anderer für dich tun. Als Außenseiter ist es normal, wenn du dich in Fantasiewelten flüchtest, in denen Engel und Naturwesen hausen. Dort wird dir eine hohe Aufgabe anvertraut und du bist die Weltenvereinigerin. Du bist die, die hilft, Mensch, Natur und Äther zu verbinden, damit alle gerettet werden und alle glücklich sind – dich eingeschlossen! – Aber hier, in der Realität, da sieht die Sache anders aus. Hier fühlst du dich wie eine Ausgestoßene, deren Leben gar keinen hohen Zweck haben kann, weil es sich an den Rändern der Gesellschaft bewegt. Aber, Noromadi, du bist keine Ausgestoßene, du machst dich nur selbst dazu! Fakt ist, du bist ein Mensch. Wenn du das angenommen hast, wird alles leichter!“
„Und was ist mit der Sprache?“, hielt ihm die junge Frau trotzig vor.
„Ein Produkt deiner Fantasie, wie alles andere. Ich habe in meiner Laufbahn viele Menschen erlebt, die sich irgendeine Sprache zusammenschustern. So drücken sie ihre Weigerung aus, am Leben teilhaben zu wollen und erheischen Aufmerksamkeit, damit sich ihnen jemand widmet, wenn sie etwas wollen ohne etwas dafür zu tun. Ein ‚zurückgebliebener‘ Mensch ist im wahrsten Sinne des Wortes pflegebedürftig. Wenn er Zuwendung wünscht, bekommt er sie. Gleichzeitig ist er so ‚verrückt’, dass sich ihm niemand länger widmet als unbedingt nötig, und das ist es, was er will: in Ruhe gelassen werden, sich seinen Tagträumereien hingeben.“
„Haben Sie wirklich eine solche Meinung von mir?“
„Nein, habe ich nicht! Ich möchte dir nur aufzeigen, dass sehr, sehr viel Potential in dir steckt, und dass du aufhören solltest, vor dir selbst wegzulaufen“, antwortete Dr. Müller freundlich.
Als Noromadi an diesem Abend ihre Pillendosis einnahm, glaubte sie fest, dass es gut für sie ist. Die Argumente des Stationsarztes hatten sie überzeugt. Ja, mehr noch. Er glaubte an sie. Dankbar überantwortete sie sich der beruhigenden Medizin und dämmerte in einen narkotischen Schlaf, den erst das Weckerrasseln abrupt beendete.
Noromadi erhob sich mühsam und schluckte gleich die morgendliche Ration, die belebend und stimmungsaufhellend wirken sollte. Da sie keine Einzelsitzung hatte, besuchte sie den Malkurs und erheiterte sich mit Bildern von Sonnenblumen, Früchten und Häusern. Die Therapeutin nahm es zufrieden hin und lobte die Frische ihrer Bilder. Noromadi gefielen die Farben, doch ärgerte sie sich über ihre zittrigen Striche.
„Nur keine Sorge“, tröstete die Therapeutin, „das sind Nebenwirkungen Ihrer Medikamente. Sie werden nachlassen, sobald Sie eine leichtere Dosis erhalten.“ Das Muskelzucken empfand sie als ebenso lästig wie die Übelkeit, die sie vormittags überkam und die sie nur mit einem opulenten Mahl bekämpfen konnte. Nachdem sie einige Wochen in der Klinik verbracht hatte, zitterten ihre Hände so sehr, dass sie sich kaum noch ihre Kleidung zuknöpfen konnte. Die Hosen spannten um Schenkel und Bauch, sie mied den Spiegel, denn ein feistes, aufgedunsenes Gesicht starrte ihr aus matten Murmelaugen entgegen. Sie fühlte sich unförmig und schwer. Ihre Schritte vom Zimmer zu den Einzelsitzungen oder in die Kantine wurden immer kleiner und schlurfender.
Ihre Bilder behielten ihre prächtigen Farben, doch Blumen und Früchte gerieten zu teigigen absurden Formen. Beim Musizieren begnügte sie sich damit, draufzuhauen, was ihr vor die Nase gelegt wurde. Trotzdem nahm Noromadi weiter ihre Medikamente. Mit trotziger Genugtuung erkannte sie nämlich, dass nach der Einnahme die Auren um Menschen und Gegenstände mehr und mehr verblassten und schließlich ganz verschwanden, genauso wie die seltsamen Träume über Engel und Gniri, auch versiegte allmählich die fremde Sprache, die ihr einst flüssig von den Lippen gegangen war. Der Arzt nahm alles zufrieden zur Kenntnis.
„Du hast dich hervorragend entwickelt“, teilte er ihr während einer Einzelsitzung mit. „Ich denke, wir können die Dosis heruntersetzen.“ Noromadi nickte erschöpft. „Außerdem möchte ich dir mitteilen, dass dich heute Nachmittag deine Familie besuchen kommt. Du hast dich sicherlich schon gefragt, warum sie sich solange nicht gemeldet haben. Es war keine Nachlässigkeit von ihrer Seite aus. Ich habe ihnen geraten zu warten, bis es dir besser geht. Ihre Anwesenheit hätte dich überfordert.“ Die junge Frau nickte abermals. „Wie würdest du deinen jetzigen Zustand beschreiben?“, er lehnte sich mit gefalteten Händen zurück.
„K… ggut! Es hat aufgehört.“
„Was hat aufgehört?“
„Träume und Erscheinungen.“
„Empfindest du das als einen Verlust?“
„Nein.“
„Was möchtest du nach deiner Entlassung im Leben erreichen?“
„Sch… studieren“, Noromadi spürte, wie ihr Kinn zuckte, wie die kleinen aufgedunsenen Finger aufgeregt das Stofftaschentuch kneteten und sie hörte ihr linkes Bein rhythmisch gegen das Stuhlbein schlagen. „W… wenn d… das hhier aufhört …“
„Die Symptome gehen zurück, das verspreche ich dir!“, der Arzt sah sie zuversichtlich an. „Ab morgen reduzieren wir sukzessive die Dosis. Es muss langsam geschehen, damit du keinen Schock erleidest.“
Die Bücher und Zeitschriften lagen noch so da wie am Tage ihrer Einlieferung. Noromadi saß zuckend auf dem Bett.
„K… keine Zzeit“, meinte sie entschuldigend, während sie in die entsetzten Gesichter ihrer Familienmitglieder starrte.
„Martin lässt sich entschuldigen“, lächelte Mutter Clara verlegen. „Er hat heute eine wichtige Prüfung, deswegen konnte er nicht kommen.“
„Wir freuen uns, dass es dir besser geht“, fügte Wilhelm hinzu und legte ihr seine Hand auf die Schulter. „Dr. Müller sagt, dass die Nebenwirkungen bald vorübergehen. Er meint, wenn die Symptome nachgelassen haben, könntest du wieder nach Hause kommen. Freust du dich?“ Noromadi lächelte gequält. „Ich darf dir übrigens mitteilen“, fuhr er aufmunternd fort, „dass du an der Uni angenommen wurdest. Na, wie findest du das? Nächstes Jahr im Herbst kannst du mit deinem Biologiestudium beginnen!“
„Gut“, antwortete die junge Frau matt.
„Komm, Wilhelm, ich glaube, sie muss sich ausruhen“, drängte Clara ungeduldig und sie verabschiedeten sich eilig. Noromadi saß auf ihrem Bett und fühlte sich mutterseelenallein. Tränen kullerten über ihr Gesicht und sie fragte sich ängstlich, was sie da nur mit sich hatte anstellen lassen. Es beschlich sie der Gedanke, dass sie vielleicht nie wieder so wie früher werden würde. Vor ihrem inneren Auge sah sie sich alt, einsam und vergessen, wie sie zitternd und stotternd in einer Anstalt saß, während ihre Eltern und Freunde draußen ihr normales Leben führten.
„N… nach Hhause, wenn d… die Symptome … sss … Unsinn“, stolperte es aus ihrem Mund, derweil sie ihre Hände nervös rieb. Sie weinte still vor sich hin und überlegte, Frau Fischer zu rufen, aber die war bestimmt, wie immer, viel zu beschäftigt, um ihr Händchen zu halten.
„Nn… niee tun sssolln hätt ich dass …“, schluchzte sie und schnäuzte sich umständlich. Dann erinnerte sie sich auf einmal an die wohltuende Wirkung des Wortes in dieser merkwürdigen Sprache, als sie es damals ausgesprochen hatte. Wie hatte es doch geheißen? Noromadi suchte krampfhaft in ihren Erinnerungen und verzerrte dabei ihr Gesicht zu einer einzigen Grimasse. Ihre Hände verkrampften sich, dass die Haut weiß wurde, und ihre Beine bäumten sich auf wie wilde Tiere.
„Ssss… sss…“, zischte sie immer wieder. „Ssss… mmm… ssss“, entfuhr es ihr, während die Tränen rannen und ihr Herz hämmerte. Plötzlich barst etwas in ihr, wie ein Knoten, der sich löst. Sie holte tief Luft und rief mit klarer Stimme: „Maas.“ Überrascht hielt sie inne, dann versuchte sie es erneut, und wieder gelang es ihr: „Maas, maas …“ Sie schluckte, schloss die Augen und wartete, dass sich ihr Herz beruhigte, dann schüttelte sie langsam den Kopf und sagte so leise, dass sie es selbst kaum hören konnte: „Nein, maar … maas maar … maas maar …“ Die Worte glitten aus ihr heraus wie Öl. Sie spürte, wie die Zuckungen ihres Körpers nachließen, ihr Herzschlag nahm seinen gewohnten Rhythmus auf und ihr Kopf wurde klar. Dann öffnete sie die Augen und wusste ganz genau: Nie wieder würde sie sich freiwillig in die Psychiatrie begeben.
In den nächsten Wochen wurde die Dosis der Medikamente reduziert und durch schwächere Präparate ersetzt. Mit Erleichterung stellte Noromadi fest, dass die Symptome endlich nachließen. Das Zittern ihrer Gliedmaßen verebbte und Kraft kehrte in ihren Körper zurück. Müdigkeit wechselte – je nach Tageszeit und Präparat – mit Überaktivität ab, aber die Auswirkungen waren nicht mehr ganz so heftig. Das machte Noromadi ausgeglichener, sie nahm konzentrierter an den Therapiesitzungen teil und war mit ihren Bildern wieder zufrieden.
Was sie jedoch für sich behielt, war die Tatsache, dass mit der Reduktion der Medikamente eine ganz andere „Nebenwirkung“ auftrat, die von der Ärzteschaft nicht gerne gesehen werden würde. Noromadi konnte wieder Auren sehen. Ja, mehr noch: Ihre Träume kehrten zurück, und die fremde Sprache, die ihr so wohl tat, fiel ihr wieder ein und ging ihr leicht von den Lippen. Überrascht stellte sie fest, dass diese eigenartigen Worte eine außerordentlich positive Wirkung auf ihren Körper und Geist ausübten, wenn sie sie in einer Art Singsang wiederholte. Also tat sie es immer wieder … nur eben heimlich.
‚Ja, es muss geheim bleiben’, dachte sie in dieser Nacht, als sie zum ersten Mal wieder in der Lage war, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen, wann sie einschlief. ‚Vielleicht sollte ich ein Wörterbuch schreiben. Deutsch und … wie heißt diese Sprache eigentlich?’, ein Geistesblitz schoss ihr durch ihren Kopf, ‚ich nenne sie Gniri-Sprache, was anderes kann es ja nicht sein, sagt selbst der Stationsarzt. Aber warum kann ich sie sprechen, ich bin doch …‘ Plötzlich erinnerte sie sich an die Botschaft des Engels, sie stutzte. ‚An diesen Gedanken muss ich mich erst einmal gewöhnen, mich gewissermaßen empirisch herantasten, damit ich nicht verrückt werde. Ach egal, Hauptsache ich bin wieder ich selbst.‘ Sie blickte zur Zimmerdecke und freute sich zu sehen, dass die wabernde dunkelblaue Energie ihres Schutzengels in ein zartes Rosa überging.
‚Ganz behutsam’, erklang plötzlich eine Stimme in ihrem Kopf. ‚Nimm dir die Zeit, die du benötigst, gönne sie dir, nur bitte, geh den Weg weiter!‘ Die Bitte klang irgendwie flehentlich, ja fast schmerzlich.
‚Manchmal’, reagierte ihr Schutzgeist, ‚können wir ermessen, wie wichtig es ist, einen Schritt zu gehen!‘
‚Ich werde mir Mühe geben‘, antwortete Noromadi, ‚du verstehst, dass das nicht leicht für mich ist. Schau nur, wie ich mich verstellen muss, damit ich in Ruhe sein kann.‘
‚Es ist kein Verstellen, mein Kind, du gehst zu den Menschen und holst sie dort ab, wo sie sind.‘
‚Kannst du das näher erläutern, bitte?‘
‚Stell dir vor, du stehst mitten in der Natur. Vor dir liegen Felder und Wiesen. In der Ferne plätschert ein Bach. Du siehst auf der anderen Seite des Bachs jemanden stehen. Ein Mensch. Er steht ganz nah am Wasser und beobachtet ängstlich, wie es dahinfließt. Der Bach reicht ihm bis an die Knöchel, dennoch hat der Mensch Angst, ihn zu überqueren. Es nützt nichts, wenn du ihm zurufst, wie schön die Landschaft jenseits des Wassers ist, denn er kennt sie nicht. Also musst du zu ihm gehen, durch den Bach waten, ihn an die Hand nehmen und hinüberbegleiten. Erst wenn ihr am anderen Ufer seid, kannst du ihm die Landschaft nahebringen – ohne ihn zu erschrecken. Je mehr er selbst davon erfährt und verinnerlicht, desto eher ist er imstande, deinen Worten eine Bedeutung zu geben.‘
‚Hat das mit Naturwesen und Weltenverbinden zu tun?‘ Noromadi war etwas verwirrt.
‚Noromadi, du bist eine Vermittlerin. Was du in der Welt der Naturwesen erfahren wirst, dürfen auch die Menschen erfahren. Die Menschen, die mehr darüber wissen möchten, werden zu dir finden, wenn es an der Zeit ist. An dieser Stelle ist dein Einfühlungsvermögen gefragt: Bringe dem Ängstlichen die Botschaft der Harmonie von Natur und Mensch, ohne ihn noch mehr zu ängstigen.‘
‚Ich muss also keinen Zauber weben, um die Welten zu vereinen?‘
‚Mitgefühl ist ein Zauber‘, und Noromadi verstand.
‚Aber diese Mischwesen-Sache?‘, erkundigte sie sich beklommen.
‚Was behagt dir daran nicht?‘
‚Das Bewusstsein, kein Mensch zu sein.‘
‚Aber du bist ein Mensch, innen wie außen. Im Grunde sind alle Menschen Naturwesen, sie haben sich nur von der Natur entfernt und das vergessen.‘
‚Ich weiß‘, meinte Noromadi betrübt, ‚aber da steckt mehr dahinter.‘
‚Was dich von ihnen unterscheiden mag‘, fuhr ihr Gegenüber unbeirrt fort, ‚ist dein Gefühl, in einer vergangenen Inkarnation unter dem Volk der Gniri gelebt zu haben, als einer von ihnen. Dieses Erinnern verwirrt dich, denn deine unterschiedlichen Leben offenbaren sich dir wie eine Perlenkette. Ereignisse, die weit in der Vergangenheit liegen, die geschahen, als du in einem anderen Körper lebtest, treten auf einmal wieder klar zutage, als seien sie erst gestern passiert. Dein Verstand ist jung, er lebt nur so lange wie der Körper Noromadi lebt, und seine Erinnerungen sind nur aus dem jetzigen Dasein. Er kann nicht verstehen, dass sich deine Seele an etwas erinnert, was nicht in diesem Leben stattfand. Deswegen fühlst du in dir eine Diskrepanz, einen Widerspruch zwischen dieser und der anderen Welt, deswegen fällt es dir als Mensch so schwer, den Aspekt des Mischwesens anzunehmen.‘
‚Also ist die Bezeichnung Mischwesen nur eine Metapher dafür, dass ich einmal eine Gniri war? In einem früheren Leben?‘
‚Exakt!‘
‚Aber ich kann doch nicht die Einzige sein, die zu einem Menschen geworden ist. Es muss doch ganz viele solcher Mischwesen geben.‘
‚Natürlich. Doch bist du eine der Wenigen, die eine solche Botschaft verkraften und die das Potential haben, mit diesem Bewusstsein zu leben ohne in die geistige Verwirrung abzugleiten.‘
‚Gibt es denn noch andere auf der Welt wie mich?‘
‚Schlaf‘, erwiderte er schlicht und streichelte sie sanft.
„Vielen Dank“, flüsterte die junge Frau und schloss die Augen.
Noromadi betrat mit einem freundlichen Lächeln und einem flotten Gruß auf den Lippen den Raum, gab dem Doktor brav die Hand und nahm artig Platz.
„Du hast dir die Haare zurückgebunden“, bemerkte der Arzt erstaunt.
„Ja, sie sind sehr widerspenstig. Ein wenig Ordnung schadet nicht“, antwortete sie kokett.
„Ich möchte dir heute die freudige Nachricht überbringen, dass dies unser Abschlussgespräch ist. Du wirst heute entlassen.“
„Dankeschön. Ich wusste es schon, Frau Fischer hat geplaudert.“
„Ja, unsere Frau Fischer. Manchmal kann sie einem die Überraschung wirklich verderben“, antwortete Dr. Müller augenzwinkernd. Dann erhob er sich und legte ihr seine Hand auf die Schulter. „Freust du dich auf zu Hause?“
„Was für eine Frage?“, sie grinste. „Natürlich. Ich habe Heimweh nach meinen Eltern … und nach Martin.“
„Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück!“ Dr. Müller reichte ihr die Hand.
‚Hoffentlich muss ich sie nie wieder schütteln‘, dachte sie schaudernd, derweil sie sich höflich verabschiedete.
Die Sonne schien hell und heiß, kein Wunder, der Sommer stand in seinem Zenit. Vor der Klinik warteten die Eltern – und Martin. Während Clara und Wilhelm sie fest an sich drückten, blieb er distanziert, als wolle er prüfen, ob sie wirklich geheilt sei. Er musterte sie von oben bis unten. Dann rang er sich ein mühsames Lächeln ab, küsste sie kurz auf die Stirn und bekannte mit einem knappen Gruß, dass er sich freue, sie wieder in der Freiheit zu sehen. Noromadi runzelte die Stirn.
‚Wahrscheinlich haben ihn seine Freunde wegen der Irren in der Klappse aufgezogen‘, dachte sie. Mit interessiertem Gesicht ließ sie die Berichte ihrer Eltern von alltäglichen Banalitäten über sich ergehen.
„Die Bilder, die du auf der Station gemalt hast, gefallen mir sehr gut“, lobte Clara ihre Tochter auf der Fahrt. „Diese Sonnenblume würde ich glatt einrahmen und im Wohnzimmer aufhängen. Was hältst du davon, mein Schatz?“ Sie sah Noromadi mit glänzenden Augen an. Diese erkannte, dass sie sich nicht davor drücken konnte.
„Ja, eine gute Idee“, antwortete sie gespielt munter, derweil Beklommenheit in ihr aufkam, weil sie wusste, dass dieses Bild sie immer an ihren Aufenthalt in der Psychiatrie erinnern würde. Ihrer Mutter schien dafür das nötige Feingefühl zu fehlen. Als auch Wilhelm die Idee seiner Frau lobte, sank der jungen Frau das Herz in die Knie.
‚Halt den Mund‘, zwang sie sich. Dann sah sie Martin an. Der zuckte zusammen und blickte scheu auf die Landschaft, die an ihnen vorbeizog. Zu Hause ließ Noromadi ihre Eltern vorangehen, dann packte sie Martin an der Schulter und hielt ihn zurück.
„Hör mal“, zischte sie, „du musst dich mit meiner Gegenwart nicht quälen, nur um mich zu schonen. Wenn du etwas zu sagen hast, dann tu es jetzt!“ Um Martins Mundwinkel zuckte es. Schließlich senkte er den Kopf und nuschelte so leise, dass man es kaum hören konnte:
„Ich denke, es ist besser, wenn wir beide getrennte Wege gehen.“ Noromadi nickte.
„Das denke ich auch“, antwortete sie und ließ ihn, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, einfach stehen. Sie betrat das Haus und erklärte ihren Eltern, dass Martin noch etwas zu erledigen hätte. Unter einem Vorwand begab sie sich auf ihr Zimmer. ‚Ich werde mich jetzt nicht damit aufhalten, zu erklären, dass wir uns getrennt haben.‘ Sie ließ sich auf ihr Bett fallen und drückte das Kopfkissen an sich.
„Egal wie groß das Haus auch sein mag, dieser Raum hier ist meiner, mein Reich, in dem ich sein darf, wie ich wirklich bin“, flüsterte sie. „Ab jetzt gilt für mich mehr denn je: Ich muss aufpassen, was ich in der Gegenwart anderer Menschen sage. Am besten sage ich gar nichts. Ich habe meinen Schutzgeist, mit dem ich reden kann, und wer weiß, vielleicht finden sich noch Gniri … Ob die mich wohl verstehen würden?“ Noromadi kaute zweifelnd auf ihrer Unterlippe. Angst keimte in ihr auf und ließ ihr Herz klopfen, aber dann besann sie sich.
‚Alles ist gut, es ist alles in Ordnung. Ich bin nicht verrückt, spätestens dann, wenn ich wieder im Wald bin, werde ich merken, dass sie da sind und ich mich nicht irre. Sie werden den Kontakt suchen, also muss ich mich nicht überwinden, ich muss ihn nur annehmen … Nebenher werde ich ein normales Leben in einem profanen Alltag führen, in dem Studium, Abendessen und andere Themen wohnen, nur keine Gniri oder Engel. Meinen Eltern werde ich eine vortreffliche Tochter sein und für ihre Belange Interesse zeigen, als wären sie für mich von absoluter Wichtigkeit. – Ou, der Nachbar hat geheiratet? Wirklich? Ah, schön … wen denn? Wie alt ist sie? Was macht sie? Oh, Bankkauffrau, ein solider Beruf … Eine neue Tapete haben Sie im Wohnzimmer? Die Blumenmuster sind ja wirklich der letzte Schrei.‘ Noromadi schluckte.
„Ja, so wird es sein. Diese Gespräche werde ich führen, derweil mich andere Dinge beschäftigen, Dinge, die mein Herz berühren, die mich aufwühlen, Fragen, auf die ich dringend eine Antwort benötige – und all das muss ich mit mir selbst ausmachen, während mich die neue Tapete im Wohnzimmer wahnsinnig fasziniert …“
„Du bist nicht allein“, hörte sie ihren Schutzgeist plötzlich als reale Stimme. „Alles wird gut.“
Auf einmal spürte Noromadi etwas Weiches auf ihrer Hand. Sie lächelte, während ihre Augen zu den Medikamenten wanderten, die auf ihrem Schreibtisch lagen.
„Ich glaube“, flüsterte sie so leise, dass es nur ihr Schutzgeist hören konnte, „ich werde sie ganz absetzen … die Packungen werden leer sein, aber wo der Inhalt landet …“