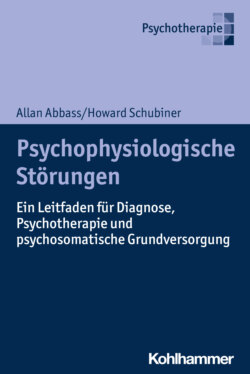Читать книгу Psychophysiologische Störungen - Allan Abbass - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Psychophysiologische Störungen – eine Übersicht
Elisabeth, eine 32 Jahre alte Frau, klagt, sie bekomme immer wieder schlecht Luft, sie habe Anfälle von Atemnot und multilokuläre Schmerzen. Zwei frühere Untersuchungen erbrachten keinen pathologischen Befund. Als ich sie über ihre Symptome befrage, rinnt eine Träne über ihre Wange.
Peter, ein 45-jähriger Mann, klagt seit sechs Monaten über anhaltende Rückenschmerzen. Die Beschwerden begannen vor einigen Jahren mit intermittierenden Schmerzen. Der Schmerz strahlt nicht in die Beine aus. Gelegentlich komme es aber zu Kribbelparästhesien im vorderen Bereich der Oberschenkel. Die neurologische Untersuchung ist normal. Im MRT finden sich Anzeichen einer degenerativen Wirbelsäulenerkrankung im Bereich der LWS, eine Bandscheibenprotrusion im Bereich L4/L5 mit einer mäßiggradigen Einengung des linken Neuroforamen. Die zweimalige Verordnung von Physiotherapie hatte zu einer bedeutsamen Verbesserung geführt.
Diese beiden Patienten klagen über häufige Beschwerden, die psychophysiologisch, durch Organpathologien oder durch eine Kombination beider Ursachen hervorgerufen werden können. Beide Vignetten sollen im Folgenden veranschaulichen, wie eine effiziente Diagnosestellung und Behandlung bei dieser Art von Befundkonstellationen gestaltet werden kann.
1.1 Übersicht
Psychische und emotionale Faktoren spielen bei Arztbesuchen eine herausragende Rolle (Kroenke, 2003; Kroenke und Rosmalen, 2006; Stuart und Noyes, 1999). Gemäß einer Metaanalyse weisen in der Primärversorgung zwischen 40–49 % der Patienten mindestens ein psychophysiologisches Symptom auf und bei 26–34 % kann eine somatische Belastungsstörung diagnostiziert werden (Haller et al., 2015). Tatsächlich können psychosoziale Faktoren vielen Krankheitssymptomen zugrunde liegen, wie bspw. Nacken- und Rückenschmerzen, Bauch- und Beckenschmerzen, Fibromyalgie, Angstzuständen, Depressionen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit und autonome Funktionsstörungen wie dem Reizdarm oder der nervösen Blase (Schubiner und Betzold, 2016). Psychosoziale Faktoren spielen außerdem eine bedeutsame Rolle für Behandlungsfehler, Probleme mit der Adhärenz, protrahierte Genesungsverläufe nach Verletzungen und die übermäßige Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Leider werden diese Faktoren noch zu häufig nicht identifiziert und nicht effektiv behandelt (Kroenke, 2003; Kroenke und Rosmalen, 2006).
Darüber hinaus wirken sich emotionale Faktoren auch ganz entscheidend auf Gesundheit, Wohlbefinden, Lebensqualität und Arbeitszufriedenheit der Ärzte und deren Mitarbeiter aus. Patienten mit behandlungsresistenten Syndromen und schwerwiegenden emotionalen Problemen beeinträchtigen die Zufriedenheit der Behandler und erhöhen das Risiko für Burnout und Kunstfehler (Croskerry et al., 2010).
1.2 Multifaktorielles Ursachenspektrum
Jeder Patient mit psychophysiologischen Störungen (PPS) weist eine einzigartige Krankengeschichte auf, die durch das Zusammenspiel von Symptomen, belastenden Lebensereignissen, der aktuellen Lebenssituation und den Umgang mit den Symptomen gekennzeichnet ist. Demgemäß können für die Ätiologie der PPS leichter zugängliche verhaltensbezogene, kognitive und zwischenmenschliche Faktoren eine Rolle spielen oder aber auch tief verwurzelte dysfunktionale Reaktionsmuster ( Tab. 1.1).
Tab. 1.1: Ursachen und Behandlungen
1.3 Lernerfahrungen
Bei Patienten mit weniger schweren psychophysiologischen Störungen spielen vor allem erlernte Denk- und Verhaltensmuster eine Rolle: Sie verfallen in hypochondrische Sorgen und andere maladaptive Verhaltensweisen. Typische Beschwerden sind Nackenschmerzen und Spannungskopfschmerz. Angst wird vor allem in die quergestreifte Skelettmuskulatur kanalisiert und führt zu muskulärer Verspannung. Außer durch interpersonelle Lernerfahrungen können diese Symptome aber auch durch das Gesundheitssystem verstärkt werden.
In der Regel sind diese Patienten aber in der Lage, Emotionen wahrzunehmen, die auf vorangegangene Bindungstraumata zurückgehen. Sie können in der Regel gesunde Bindungsbeziehungen aufbauen. Sie sind offen für den Zusammenhang von Stress und Symptomentstehung, können ihre wichtigen seelischen Probleme erkennen und sprechen deshalb auf edukative und kognitiv-behaviorale Interventionen an. Die Behandlung besteht in der Psychoedukation über die Bedeutung von Stress und in Methoden der kognitiven Umstrukturierung. Außerdem sollen die Patienten in die Lage versetzt werden, Stressoren weniger maladaptiv zu bewältigen. Ausführlich werden diese Interventionen in den Kapiteln 2–4 erklärt.
1.4 Unbewusste Konflikte
Bei schweren Formen psychophysiologischer Störungen werden die Symptome primär durch unbewusste emotionale Faktoren verursacht. Diese Patienten sind oft alexithym, d. h. sie haben Schwierigkeiten, Emotionen wahrzunehmen, innerlich zu erleben und angemessen auszudrücken. Meist sind sie durch die Beschwerden sehr stark blastet, fast immer besteht eine ängstlich-depressive Symptomatik und in der Biografie finden sich gehäuft traumatische Lebenserfahrungen. Es fällt ihnen oft schwer, die Rolle emotionaler Faktoren für die Symptomentstehung zu verstehen. Die Beschwerden dieser Patienten sprechen häufig nicht auf unspezifische medizinische Behandlungen oder psychotherapeutische Bemühungen an. Diese Patienten benötigen eine psychotherapeutische Behandlung, die ihre Fähigkeit verbessert, Gefühle wahrzunehmen und den Zusammenhang zwischen emotionalen Faktoren und der Symptomentstehung zu verstehen. Dieser Behandlungsansatz wird in den Kapiteln 5–8 beschrieben.
1.5 Ein Kontinuum
Zwischen diesen beiden Polen, dem der leichten und schweren psychophysiologischen Störungen, finden sich viele Patienten, die eine Kombination dieser unterschiedlichen Therapieansätze benötigen. Die in den Kapiteln 2–4 beschriebenen, leichter zu erlernenden Techniken eignen sich für die meisten Patienten der Primärversorgung. Auch Patienten mit tief verwurzelten emotionalen Konflikten können von diesen edukativen und kognitiv-behavioralen Techniken profitieren, ebenso wie weniger schwer Betroffene von den emotionsfokussierten Interventionen, die in den Kapiteln 5–8 beschriebenen werden. Für alle Patienten mit psychophysiologischen Störungen ist eine evidenzbasierte und rationale medizinische Herangehensweise sinnvoll, die relevante somatische Ursachen ausschließt und Patienten über die zugrunde liegenden psychophysiologischen Mechanismen aufklärt.
1.6 Settingfaktoren und Interventionen
Patienten mit psychophysiologischen Störungen werden von Klinikern in unterschiedlichen Settings mit unterschiedlichen zeitlichen Rahmenbedingungen gesehen. In manchen Einrichtungen steht nur sehr wenig Zeit für die Untersuchung und Behandlung der Patienten zur Verfügung. Für diese Ärzte ist es hilfreich, unterschiedliche Ursachen funktioneller Störungen zu kennen, ein überschaubares Repertoire kurzer edukativer und kognitiv-behavioraler Interventionen zu beherrschen und zu erkennen, wann sie Patienten in eine fachspezifische Behandlung überweisen müssen.
Ärzte mit mehr therapeutischem Spielraum profitieren in ihrer klinischen Arbeit sehr davon, wenn sie lernen, wie man die spezifischen Ursachen psychophysiologischer Störungen identifiziert, wie man psychoedukative und kognitiv-behaviorale Behandlungen einsetzen kann und dem Patienten hilft, unbewusste Emotionen zu erkennen und zu verarbeiten.
1.7 Die zentrale Rolle einer vertrauensvollen Beziehung
Vertrauen in der Arzt-Patient-Beziehung ist die Basis einer erfolgreichen klinischen Arbeit. Patienten mit psychophysiologischen Störungen haben oft stigmatisierende und diskriminierende Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem gemacht: Ihre Beschwerden wurden als »eingebildet« entwertet und sie als »klagsam« oder gar als »Simulant« abgestempelt. Gleichzeitig fühlen sich die Betroffenen wie überwältigt von ihren belastenden Lebensumständen und dem Ausmaß ihrer Beschwerden. Die frühen Lebenserfahrungen der Betroffenen sind oft von Bindungstraumatisierungen, d. h. belastenden Kindheitserfahrungen, gekennzeichnet. Wenn man versteht, dass die Schmerzen der Betroffenen real sind und die Ursachen für diese Symptome auf frühe belastende Lebenserfahrungen in Gestalt von Vernachlässigung, Verlassenheit und Missbrauch zurückgehen, ist es einfacher, eine fürsorgliche Haltung einzunehmen und dem Aufbau von Vertrauen viel Aufmerksamkeit zu schenken. Machen Sie sich klar, dass die Qualität der therapeutischen Beziehung die notwendige Grundlage für den Erfolg der nachfolgend beschriebenen Interventionen ist. Wir hoffen, dass dieses Buch Ihnen hilft, Ihre Patienten besser zu verstehen und eine gute therapeutische Beziehung aufzubauen.
1.8 Zusammenfassung
• Die Ursachen psychophysiologischer Störungen reichen von erlernten kognitiv-behavioralen Schemata bis hin zu tiefverwurzelten maladaptiven emotionalen Reaktionsmustern.
• Emotionale Faktoren spielen bei sehr vielen Patienten eine Rolle. Diese emotionalen Faktoren müssen im Fokus der Behandlung stehen.
• Die meisten Kliniker können von der Theorie und den Interventionstechniken in diesem Buch profitieren.
• Eine fürsorgliche und vertrauensvolle Beziehung ist entscheidend für die Behandlung von Patienten mit psychophysiologischen Störungen.