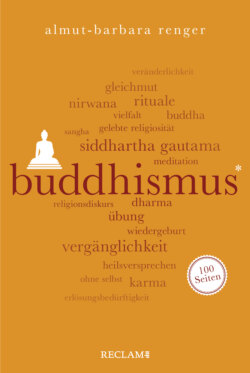Читать книгу Buddhismus. 100 Seiten - Almut-Barbara Renger - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеProlog: Innehalten im Wandel stetiger Veränderung
Der Buddhismus ist ein lebendiger Teil der Weltkultur. Nachdem er über zwei Jahrtausende lang hauptsächlich in Asien verbreitet war, hat er am Beginn des 21. Jahrhunderts Fuß auf fast allen Kontinenten gefasst. In einer religiös und weltanschaulich pluralistischen Welt, in der er sich, wie andere missionierende Religionen, an alle Menschen richtet, wird er auch im sogenannten Westen – insbesondere in Europa und Nordamerika, Australien und Neuseeland – immer beliebter. Die Zahl derer, die ihm weltweit folgen, wird auf rund eine halbe Milliarde geschätzt.
Dabei gibt es den Buddhismus, das sei vorausgeschickt, ebenso wenig wie das Christentum oder den Islam. Es handelt sich vielmehr um ein Gefüge von Bewegungen und Traditionen, das, in seinem beständigen Wandel, der Grundidee der buddhistischen Lehre entspricht: Nichts auf der Welt hat Bestand, alles ist veränderlich.
Die Veränderlichkeit, mit der sich der Buddhismus auseinandersetzt, zeigt sich auch in Europa, wo buddhistische Ideen und Philosophie seit über 300 Jahren bekannt sind. Die Europäer näherten sich dem Buddhismus zunächst über Textlektüren denkerisch-intellektuell an. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich seine Aneignung in eine erfahrungsbetont-pragmatische Richtung. Heute wird er in den Medien und der Breite der Gesellschaft vor allem mit Meditationsformen wie Zen und Vipassana oder der davon abgeleiteten Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion (MBSR) in Verbindung gebracht, die von Schulen bis in die Wirtschaft hinein Anwendung findet. Damit einher geht eine große Sichtbarkeit buddhistischer Bildsprache und -ästhetik in der Populär- und Alltagskultur. Buddha-Statuen in der Einrichtungs- und Wohnkultur zum Beispiel sind Teil des gesellschaftlichen Mainstreams geworden. Ihre Beliebtheit als exotisierender Dekor in privaten und öffentlichen Räumen verweist darauf, wie fließend die Grenzen zwischen Religion und Popkultur, Privatheit und Öffentlichkeit, Religiösem und Nichtreligiösem bisweilen sind.
Sehr viel weniger sichtbar dagegen ist die gelebte Religiosität des Buddhismus mit ihren kultischen Handlungen und Glaubensgeschichten, die sich um den Buddha und andere buddhistische Heilsgestalten ranken: Zwar sind Reliquienverehrung, Bilderkult und Pilgerwesen, Rituale zwecks Heilung und Schadensabwehr, Bitt- und Dankgebete für Ahnen und der reiche buddhistische Schatz an Mythen und Legenden das, was bis heute in Asien das Gesicht des Buddhismus prägt. Doch außerhalb dieses Kontinents, in der Bundesrepublik Deutschland etwa, werden sie in Medien und Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.
Die Gründe dafür liegen nicht zuletzt in der Geschichte des Buddhismus im Kontext europäischer Entdeckungsreisen und des Kolonialismus. Durch die Erschließung buddhistischer Texte, die im 19. Jahrhundert zum Beispiel aus Tibet, Nepal und Ceylon nach Europa gelangten, entwickelte sich im Austausch zwischen den Kontinenten ein Diskurs, in dem sich ›der‹ Buddhismus als Gegenstand herausbildete. Dabei versuchten asiatische Mönche und gebildete Laien, buddhistische Lehrinhalte und Praxiselemente in Einklang mit westlichen, modernen Konzepten zu bringen. Zugleich begaben sich europäische Gelehrte, ähnlich wie die historisch-kritische Jesusforschung in Schriften des Urchristentums nach Jesus von Nazareth forscht, auf die Suche nach dem historischen Buddha und den Anfängen des Buddhismus. Philip C. Almond beschreibt in The British Discovery of Buddhism (1988) ausführlich, wie die neu entdeckte Religion im Laufe dieser Suche immer mehr in frühen Texten verortet wurde, die in der Kolonialzeit gesammelt, herausgegeben und übersetzt wurden: Unter Bezug auf Inhalte, die als Worte des »Stifters« galten, wurde ein »wahrer Kern«, eine »ursprüngliche« Form des Buddhismus konstruiert. Ihr gegenüber galten die meisten Glaubens- und Praxisformen in Asien als verfälscht.
Diese Konstruktion des Buddhismus mit ihrer Marginalisierung zentraler asiatischer Erscheinungsformen ist bis heute wirkmächtig – und erschwert den Zugang zu dem, was den Buddhismus ausmacht: Vielfalt durch Veränderlichkeit. Wollen wir den Buddhismus verstehen, ist es von Vorteil, den Blick auch auf Formen gelebter Religiosität zu richten, die auf den ersten Blick befremdlich anmuten mögen, anstatt sie auszublenden oder gar aus einer ›modern-säkularen‹ Perspektive als rückständig abzutun. Dies gilt zumal dann, wenn wir in einer multiethnischen und multireligiösen Gesellschaft leben, die vor der Aufgabe steht, Andersheit anzuerkennen und Diskriminierung entgegenzuwirken. Der weltweite numerische Zuwachs des Buddhismus beruht zu einem Großteil auf Eingewanderten und Geflüchteten, die in asiatischen Kult- und Glaubensimporten Sinn und Identität finden.
Mit dem Folgenden möchte ich dazu anregen, einseitige westliche Ansichten über ›den‹ Buddhismus als »Religion, die eigentlich keine Religion« ist, zu hinterfragen. Dabei bieten die 100 Seiten lediglich eine kleine, durch persönliche Interessen und Erlebnisse bedingte Auswahl: Momentaufnahmen und Stationen des Innehaltens im dynamischen Wandel steter Veränderung dessen, was heute unter dem Sammelbegriff »Buddhismus« zusammengefasst wird.
Zur Schreib- und Zitierweise
Über den Buddhismus lässt sich in einer europäischen Sprache nicht ohne zentrale buddhistische Begriffe schreiben. Dies geschieht im vorliegenden Text in international üblicher wissenschaftlicher Umschrift. Dabei werden die kursivierten Fachausdrücke, sofern sie nicht eindeutig chinesischer, japanischer oder tibetischer Herkunft sind, in ihrer Sanskritform wiedergegeben. Schreibweisen in anderen Sprachen werden alternativ oder zusätzlich angeführt, wenn ein jeweiliger Bezug gegeben ist.
Da die 26 Buchstaben des deutschen Alphabets zur Wiedergabe der größeren Zahl von Schriftzeichen in den asiatischen Sprachen nicht ausreichen, erscheinen die Begriffe mit Diakritika: Ein Querbalken über einem Vokal dient zum Beispiel als Dehnungszeichen. Ausnahmen bilden Namen von Göttern, Personen und Orten sowie Begriffe wie ›Sutra‹, ›Karma‹ und ›Nirwana‹, die inzwischen Teil der deutschen Sprache sind oder im Text zuvor eingeführt wurden: Sie sind in der im Deutschen geläufigen vereinfachten Sanskrit-Schreibweise ohne angefügte Zeichen belassen.
Bei näheren Angaben zu Passagen aus dem Pali-Kanon sind die Abteilungen (nikāya), in denen die Texte kompiliert sind, abgekürzt in runden Klammern angegeben.
Abkürzungen
| DN: Dīgha Nikāya | chin.: Chinesisch |
| MN: Majjhima Nikāya | jap.: Japanisch |
| SN: Saṃyutta Nikāya | p.: Pali |
| Lv.: Lalitavistara | skt.: Sanskrit |
| tib.: Tibetisch |