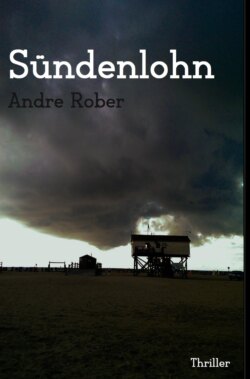Читать книгу Sündenlohn - Andre Rober - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDa war sie! Also hatte sich das Warten gelohnt! Er hatte nicht damit gerechnet, sie heute, wo er sie doch am Vormittag gesehen hatte, noch einmal an der Bushaltestelle anzutreffen. Aber offensichtlich war sie am Mittag zurück in die Stadt gekommen und befand sich - es war mittlerweile dunkel - wieder auf dem Nachhauseweg. Sie hatte dieselben Kleider an wie vor einigen Stunden und wieder beobachtete er genau, wie sie sich bewegte, die unbekümmerte, fast kindliche Art, wie sie ihre Arme schlenkerte. Wie sie ihre Schritte wie im Tanz setzte und sie ausgelassen und, ohne auf die anderen Leute zu achten, den Kopf zu dem Rhythmus aus ihren Ohrhörern hin- und herbewegte und dabei stumm den Liedtext mit den Lippen mitsang. So nah war er ihr heute Morgen nicht gekommen. Er selbst saß auf einem der verzinkten Stühle der überdachten Bushaltestelle, wo in Kürze ein Bus der Linie drei ankommen und die hier wartenden Menschen auf dem Weg nach Hause mitnehmen würde. Sie kam über die Straße direkt auf ihn zu, und wieder folgte er ihr mit seinem Blick aufs Genaueste. Aus einer unverfänglichen Kopfhaltung schielte er zu ihr, immer darauf gefasst, dass sich ihre Blicke treffen könnten und er dann schnell woanders hinsehen musste. Doch sie war so vertieft in ihre Musik und ihre Gedanken, dass diese Gefahr nicht bestand. Jetzt erreichte sie die Bushaltestelle, schaute auf ihre Armbanduhr und blickte sich um. Obwohl etwa acht Leute ebenfalls auf den Bus warteten, war der Sitz zu seiner Rechten nicht belegt. Ob sie sich dort hinsetzen würde? Innerlich spannte er sich an und hoffte, dass sie die paar Schritte in seine Richtung machen würde, um sich neben ihm niederzulassen. Dann wäre sie in Berührweite. Nicht, dass er es gewagt hätte, sie in irgendeiner Form anzufassen, auch eine scheinbar zufällige Berührung wollte er auf keinen Fall riskieren. Aber für ihn bedeutete die physische Nähe eine ungeheure Intimität, fast, als würden sich ihre Auren überlagern. Er würde den Luftzug spüren, den sie beim Hinsetzen verursachte, er würde hören, wie beim Umdrehen ihre Schuhsohlen leise über die Betonplatten scheuerten, vielleicht würde er sogar ihren Körpergeruch oder ihr Parfüm riechen können. Doch es kam anders. Sie lief zwar noch ein paar Schritte auf ihn zu, lehnte sich jedoch an die Stahlstrebe des Haltehäuschens und stellte, wie am Morgen an der Ampel, einen Fuß auf die Zehenspitzen und wiegte mit dem Bein im Takt der für ihn und die anderen Menschen unhörbaren Musik.
Er starrte vor sich auf den Boden. Seine Augen so weit nach rechts zu verdrehen konnte zu leicht von den Umstehenden gesehen werden. Außerdem, die Erfahrung hatte er schon mehrfach gemacht, erhöhte die extreme Augenstellung einen der, Gott sei Dank, selten gewordenen Krampfanfälle. Also beobachtete er zwischen seinen Schuhen, wie sich ein paar Ameisen fleißig an einem für sie gigantischen Stückchen Brot zu schaffen machten, Stück für Stück abtrennten und mit ihrer Last zwischen den Fugen der Betonplatten verschwanden. Obwohl sie nur in der Lage waren, verhältnismäßig kleine Bröckchen aufs Mal wegzutransportieren, war, als nach wenigen Minuten die Motorbremse des eintreffenden Busses zu hören war, fast das gesamte Stück Brot im Erdboden verschwunden.
Er hob den Kopf.
Linie drei.
Sie machte sich bereit einzusteigen. Folglich erhob auch er sich bemüht lässig, ließ den meisten der Mitwartenden den Vortritt und stieg dann durch die hintere Tür in den Bus ein. Er wandte sich nach links in der Hoffnung, dort noch einen Platz vorzufinden, denn nur, wenn er hinter der letzten Tür saß, konnte er, ohne sich verdächtig zu verhalten, überwachen, wo sie ausstieg. Er hatte Glück. In der letzten Reihe, wo sich normalerweise immer ein Haufen Jugendlicher lautstark breitmachte, saß niemand. Also wählte er den Platz links außen, so konnte er alle drei Türen bestens einsehen. Als auch der letzte Fahrgast Platz genommen hatte – der Bus war nur gut zu einem Drittel gefüllt – versuchte er, sie zu erspähen. Er ließ den Blick schweifen und fand sie relativ zügig. Sie saß direkt hinter der mittleren Tür mit dem Rücken zu ihm und bewegte immer noch ihren Kopf im Takt.
»Was wolltest du mir denn jetzt so Wichtiges erzählen? Hast du dich doch dazu entschlossen, etwas zu tun, was deiner Intelligenz und deiner Erziehung mehr entspricht, als eine kleine Beamtin bei der Polizei?«
Der Augenblick war gekommen, wo Sarah Hansen ihrer Mutter reinen Wein einschenken musste. Ob sie wollte oder nicht, durch diese Konfrontation mussten sie beide durch. Bevor sie ansetzen konnte, ihrer Mutter von der bevorstehenden Versetzung zu berichten, brachte ihr Gegenüber die immer wieder und wieder aufs Neue geführte Diskussion über Sarahs Beruf auf den Tisch.
»Wie oft habe ich dir gesagt, dass solch ein Beruf nicht gut für dich ist! Seine Zeit mit Halunken, Schlägern, Mördern und Prostituierten zu verbringen, ist nichts für eine junge Frau aus so gutem Hause, wie du eine bist.« Waldburg Hansen stellte den gut gefüllten Schwenker mit Armagnac auf das Beistelltischchen neben ihrem Fauteuil und beugte sich mit übertriebener Gestik nach vorne.
»Für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften ist es noch nicht zu spät! Du weißt, ich habe immer noch Kontakte in höchste Kreise. Es wäre kein Problem, dich in einer herausragenden Position in einem namhaften Unternehmen unterzubringen!«
Noch vor wenigen Jahren hätte sich Sarah zu diesem Zeitpunkt den Beistand ihres zu damals schon verstorbenen Vaters gewünscht. So wie damals musste sie hier aber alleine bestehen und die langwierige Therapie, mit der sie ihre Mutter-Tochter-Beziehung zuerst analysiert und dann aufgearbeitet hatte, gab ihr jetzt den nötigen Rückhalt.
»Mama, das hatten wir doch schon so oft. Du weißt doch, dass BWL oder VWL nun mal nichts für mich ist. Ich…«
»Nein, Kind, du weißt einfach nicht, was gut für dich ist und was nicht! Und ihren Kindern das beizubringen, dafür sind Eltern ja nun mal da!«
Sie hob kurz den Zeigefinger, lehnte sich dann wieder zurück und nahm einen ausgiebigen Schluck von dem Armagnac.
»Dein Vater hätte auch gewollt, dass du etwas Ordentliches machst. Ein richtiges Studium, das zu einem anständigen Beruf führt. Polizistin! Was für einen Ruf haben denn Frauen, die als Polizistinnen arbeiten?«
Dass ihre Mutter am heutigen Abend nicht in die Rolle der sorgenvollen, vor Angst um ihre Tochter leidgequälten Mutter schlüpfen würde, hatte Sarah schon bei der Begrüßung gemerkt. Heute war also die strenge, um Ansehen und Ruf bemühte Waldburg Hansen ihr Gegner in der Diskussion und so, wie sie ihren letzten Satz betont hatte, würde auch die du-beschmutzt-das-Ansehen-deines-Vaters-Karte rücksichtslos ausgespielt werden. In welcher Rolle sich ihre Mutter am Ende der Diskussion befinden würde, war sich Sarah noch nicht sicher, aber eines war klar: Beide würden verletzt sein, sie würden sich wieder ein Stück, wahrscheinlich ein sehr großes Stück, voneinander entfernen. Ob es zum Bruch kommen würde, vermochte Sarah zu diesem Zeitpunkt nicht zu sagen, aber sie war entschlossen, auch das zu riskieren.
»So? Mama, erkläre mir bitte mal, welchen Ruf Polizistinnen, so wie ich eine bin, denn haben.«
Natürlich hätte sie gleich auf den Punkt kommen können, ihre Mutter mit ihrer Entscheidung konfrontieren und dann, abhängig von ihrer Reaktion, darüber diskutieren oder einfach aufstehen und das Haus verlassen können. Aber sie fühlte sich von der gereizten Art Waldburg Hansens so provoziert, dass sie – und so stark war sie im Moment – ruhig auch ein wenig gegenprovozieren konnte.
»Nun, das… das… das weißt du doch!«, schnaubte ihre Mutter zurück. »Jeder weiß das!«
»Ich nicht«, entgegnete Sarah unschuldig und schwieg beharrlich.
Erstaunlicherweise ließ ihre Mutter das Thema Ruf und Ansehen schnell fallen und versuchte es auf einem anderen Kanal.
»Ein junger Mensch mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Bildung muss einfach etwas aus sich machen. Stell dir vor, was du als Ökonom in einer Bank alles bewegen könntest. Du vergeudest dein Potenzial.«
Die Antwort Aber ich tu das nicht mit übermäßigem Alkoholgenuss schluckte Sarah schon im Ansatz hinunter. Die Wunde war zu groß, um sie wieder aufzureißen. Aber sie blieb angriffslustig.
»Da bewege ich doch lediglich Unsummen von Geld, meinen Hintern nicht vom Bürostuhl und das Ganze nur zum Vorteil der Bank. Abends könnte ich wahrscheinlich nicht mehr guten Gewissens in den Spiegel schauen.«
»Jaja, du willst mit Menschen zu tun haben und bist wohl geradezu versessen auf die, die auf die schiefe Bahn geraten sind.«
Waldburg Hansens Tonfall war so abwertend, dass Sarah Hansen innerlich getroffen war. Doch ihre Mutter war noch nicht fertig.
»Wenn das dein innigster Wunsch ist, dann wäre ein Jurastudium die richtige Wahl. Als Anwältin in der Kanzlei von Dr. Klöbner zum Beispiel. Oder meinetwegen auch bei der Staatsanwaltschaft. Kind, mach etwas aus deinen Talenten!«
Bevor Sarah ihre Erziehung, die Reit- und Ballettstunden, die Segelausbildung, überhaupt alles, was in sie investiert worden war, zum x-ten Male vorgehalten wurde, hob sie ziemlich energisch die Hand und sagte mit leicht erhobener Stimme:
»Mama, ich bin Polizistin und das werde ich in absehbarer Zeit auch nicht ändern. Und genau darüber möchte ich mit dir heute Abend sprechen: Ich werde in etwa drei Wochen versetzt, und zwar sehr weit weg.«
Nun war es raus. Und an der selbstmitleidsvollen Miene, die ihre Mutter unmittelbar nach dem zuerst kurz schockierten und dann verärgerten Blick aufsetzte, erkannte Sarah, für welche Rolle sich ihre Mutter entschieden hatte.
Während der ganzen Fahrt hatte er sie nicht aus den Augen gelassen. Er war konzentriert darauf, wo sich der Bus gerade befand, darauf, wie die Gegebenheiten an der nächsten Haltestelle waren, darauf, ob die Menschen um ihn herum sein gesteigertes Interesse an ihr vielleicht bemerken könnten. Zu konzentriert, um sich den Fantasien hinzugeben, die er sonst üblicherweise aussann. Fantasien, in denen er sich ihr unbemerkt näherte, ihr zärtlich den Nacken streichelte oder im Vorbeigehen mit seiner Hand die ihre streifte. Fantasien, in denen er den Mut aufbrachte, sich an den Vierersitz zu ihr zu setzen, ihr ins Gesicht zu lächeln und es zu genießen, wenn sich ihre Knie während der Fahrt sacht berührten und ihn in jedes Mal Ströme von Glücksgefühlen durchfluteten.
Jetzt aber nahm er sich selbst kaum wahr. Außer dem leichten Druck im Kopf, den er immer verspürte, wenn er körperlich oder geistig angestrengt war, fühlte er nur Leere.
In diesem Moment nahm sie die Hand vom Schoß, erhob sich halb vom Sitz und beugte sich weit nach vorne. Sein Atem beschleunigte sich minimal, als sie den schlanken Arm mit der leicht gebräunten Haut, die er so gerne berühren, streicheln wollte, anhob und mit der kleinen, grazilen Hand zu dem Haltewunsch-Knopf griff und mit ihren langen Fingern dreimal in schneller Folge darauf drückte. Dann sank sie wieder zurück in den Sitz, schüttelte kurz den Kopf in beide Richtungen und strich sich das kurze braune Haar wieder hinter die Ohren.
Er löste seinen Blick von ihr, sah auf die Anzeige der kommenden Haltestelle und begann, sich die Landschaft, die voraus lag, aufs Genaueste einzuprägen, so gut dies im Dunkeln möglich war. Als der Bus schließlich mehr oder weniger auf freier Strecke zum Stehen kam, war sie die Einzige, die aufstand, sich um die Haltestütze schwang und den Bus verließ. Noch ehe sich das Fahrzeug wieder in Bewegung setzte, war sie hinter dem Heck herumgegangen und stand jetzt, nur durch die Fensterscheibe und die Rückenlehne von ihm getrennt, keinen halben Meter hinter ihm. Sie blickte kurz nach links und rechts, lief dann schnellen Schrittes über die halbdunkle Straße und steuerte einen unbeleuchteten Feldweg an, der im rechten Winkel abzweigte und sich im Schwarz der Nacht verlor. Erst in etwa zwei Kilometern konnte er die Lichter von einem Haus erkennen. Entspannt lehnte er sich zurück und stieg erst an der Endstation aus.
»Was bedeutet das, weit weg?«, fragte Sarahs Mutter in leicht weinerlichem Ton. »Du bist doch schon weit weg. Flensburg! Musstest ja unbedingt fort von Kiel.«
»Mama, ich rede nicht von einer Stunde Fahrt.« Die Diskussion vor eineinhalb Jahren war ihr noch gut im Gedächtnis. Das vorwurfsvolle Gesicht, das ihre Mutter damals gemacht hatte, als klar wurde, Sarah würde keinesfalls jeden Morgen und jeden Abend eine Stunde Fahrt auf sich nehmen, war auch jetzt wieder zu erkennen. Dennoch: Die Entscheidung, auszuziehen und sich direkt an der dänischen Grenze eine Bleibe zu suchen, also die größtmögliche Entfernung zwischen sich und ihre Mutter zu legen, hatte sie zu keiner Sekunde bereut.
»Es ist richtig weit weg. Ich werde nicht spontan zu einem Abendessen bei dir vorbeischauen können. Selbst ein Wochenendbesuch wird schon aufwändig.«
Mit leerem Blick sah Waldburg Hansen ihr in die Augen.
»Aber Kind, das geht doch nicht! Wie kannst du mich nur alleine hierlassen? Du bist doch alles, was ich habe!«
Die typische Reaktion ihrer geradezu verabscheuungswürdig egozentrischen Mutter. Wie sehr hätte sich Sarah gewünscht, dass sie nachgefragt hätte, wo sie denn hinginge, was es für eine Stelle sei, welche Aufgaben und Herausforderungen sie erwarteten… nein, Waldburg Hansen dachte wie immer nur an sich und an ihr Leid, das mit dem Wegzug – wohin auch immer – über sie hereinzubrechen drohte. Obwohl Sarah dieses Verhalten schon, seitdem sie denken konnte, gewohnt war, traf es sie. Trotzdem gelang es ihr, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten und ihrer Mutter nicht aus tiefster Seele: Wieso? Du hast doch immer noch deinen Scheißalkohol, ins Gesicht zu schreien. Sie schloss kurz die Augen, atmete tief ein und entschied sich für die rationale Taktik.
»Mama, das stimmt doch nicht. Du hast den Yachtclub, deine Bridgerunde, die Empfänge bei Freunden und nicht zuletzt den Kulturverein, alles respektable Menschen, mit denen du häufig und intensiv Kontakt hast. Außerdem liebst du das Haus und den Garten über alles. Dein Glück ist doch nicht davon abhängig, dass ich in Reichweite lebe.«
Waldburg Hansen verdrückte ein paar Tränen, von denen Sarah sich nicht sicher war, ob sie wieder Produkt des theatralischen Moments waren oder wirklich infolge bebender Emotionen in die Augen ihrer Mutter traten. Da Sarah ein bestimmtes Thema unbedingt vermeiden wollte, beschwichtigte sie ihre Mutter weiter.
»Außerdem, Mama, gibt es ja Telefon! Erinnerst du dich, was die Peeks immerzu erzählen? Seit ihre Tochter nach Australien ausgewandert ist, ist ihre Beziehung noch viel enger als zuvor! Sie telefonieren drei bis vier Mal pro Woche. Das tun wir nicht, und ich bin nur fünfundneunzig Kilometer entfernt und nicht sechzehntausend!«
Doch Sarah sah ihrer Mutter an, dass sie nicht zuhörte, sondern sich sukzessive nach innen wandte. Sie starrte mit leeren Augen an ihr vorbei und schüttelte in kleinen, ruckhaften Bewegungen den Kopf. Dabei verfiel sie in eine Stoßatmung, und das fast schluchzende Geräusch, das beim Auspressen der Luft entstand, hätte einen Unwissenden zu ehrlichem Mitleid, wenn nicht gar ernster Sorge gebracht. Sarah hingegen kannte dieses Verhalten seit jüngster Kindheit. Ihre Mutter hatte es immer dann eingesetzt, wenn sie gewahr wurde, dass Worte alleine nicht erfolgreich ihren Willen durchzusetzen vermochten. Dass sie als Kind auf die so übermittelten Botschaften ihrer Mutter immer erwartungsgemäß reagiert hatte, verwunderte Sarah nicht im Geringsten. Dass allerdings auch ihr Vater angesichts eines solchen, zugegebenermaßen perfekt inszenierten Schmierenstücks sofort in den Fürsorglichkeitsmodus schaltete und in der Regel alles tat, um seine Frau zu beruhigen, das entzog sich Sarahs Verständnis. Immerhin verzichtete Waldburg Hansen im Moment noch darauf, ihre Hand auf die Brust zu legen und über Schmerzen zu klagen, wo doch ihr Blutdruck so hoch und die Folgen für das Herz nicht abzuschätzen waren! Sarah entschied, erst einmal abzuwarten, ob sich ihre Mutter nicht auf einer verbalen Ebene an sie wenden würde und die Diskussion wie unter Erwachsenen weitergeführt werden konnte. Doch als nach einigen Minuten herzerweichendem Schluchzen vermehrt Tränen in die Augen ihrer Mutter traten, wusste Sarah, was nun kommen würde. Das Thema, das Waldburg Hansen sicher gleich anschneiden würde, war das Einzige, mit dem auch sie zutiefst getroffen werden konnte! Und so sehr sie sich gewünscht hatte, es am heutigen Abend nicht mit in die Diskussion einzubeziehen, war sie sich sicher, dass sich ihre Mutter genau dort hineinsteigerte, um mit emotionaler Authentizität ihren letzten Trumpf ausspielen zu können.
»Kind«, flüsterte Waldburg Hansen kaum hörbar mit geschlossenen Augen. »Dass du mich nun auch verlässt! Kannst du überhaupt nachempfinden, wie eine Mutter sich fühlt, die ein Kind, ihre geliebte Tochter, verloren hat? Wenn ihr eigen Fleisch und Blut das Leben hingeben musste, und sie keine Möglichkeit hatte, dies zu verhindern?«
Sarah verdrehte die Augen und seufzte ebenfalls, doch sie erwiderte nichts und ließ ihre Mutter weiterreden.
»Das ist der größte, ja der größte Schmerz,« - sie riss ihre Augen weit auf und fixierte Sarah - »den eine Mutter ertragen muss. Die härteste Prüfung, die dir im Leben auferlegt werden kann.«
Sie schloss die Augen wieder und lehnte sich zurück. Sarah war jetzt auch aufgewühlt, jedoch schaffte sie es immer noch, das Ereignis, auf das ihre Mutter anspielte, rational zu bewerten.
»Und wenn dein Vater nicht auf Geschäftsreise gewesen wäre, und ich nicht diese entsetzliche Migräne gehabt hätte, dann wäre deine Schwester heute noch am Leben.« Die Worte kamen zwar in einem Tonfall von Bedauern über die Lippen ihrer Mutter, doch Sarah wusste um die theatralische Begabung ihrer Mutter nur zu gut. Folglich fiel es ihr schwer, an sich zu halten. Die Art, wie sich ihre Mutter die Welt um sich zurechtlegte, widerte sie an. Seit jenem Tag versuchte Waldburg Hansen, die Verantwortung, die sie am Tod von Sarahs Schwester Lena hatte, von sich zu schieben. Der Hinweis auf die Abwesenheit ihres Mannes stand dabei zwar nicht im Vordergrund, wurde aber jedes Mal angebracht, wenn dieser schreckliche Tag zur Sprache kam. Maßgeblicher – und in Sarahs Augen um etliches verwerflicher – war, dass man die Unfähigkeit, Lena zu helfen, die beim Spielen in den Pool gefallen war, keineswegs durch eine schwere Migräne begründen konnte. Auch wenn es Sarah damals nicht bewusst gewesen war – schließlich war sie erst fünf Jahre alt – da sie sich heute noch an kleinste Details an jenem Tage erinnern konnte, hatte sie sich später zusammenreimen können, dass ihre Mutter damals sturzbetrunken auf der Chaiselongue im Salon gelegen hatte. Die Zeit, die Sarah damals benötigt hatte, um ihre Mutter an den Pool zu bekommen, waren möglicherweise die entscheidenden Minuten gewesen, die ihrer siebenjährigen Schwester das Leben gekostet hatten. Migräne! Sarah drehte es auch heute noch den Magen um, als ihre Mutter zum wiederholten Mal auf diese Art und Weise versuchte zu entschuldigen, was damals geschehen war. Doch sie hielt sich zurück. Bei einer einzigen Gelegenheit hatte Sarah geglaubt, ihre Mutter mit der Wahrheit konfrontieren zu müssen. Dass jener Abend mit einem Anruf beim Notarzt und einer aufreibenden Nacht in der Klinik geendet hatte, war ihr immer noch als fast traumatisches Erlebnis in Erinnerung. Und eines hatte sich in ihren Gefühlen gegenüber den Lügen ihrer Mutter ohnehin grundlegend geändert: Was lange Zeit Trauer und vor allem Wut bei ihr ausgelöst hatte, machte heute einem anderen, sehr starken Gefühl Platz: Verachtung! Ja, sie verachtete ihre Mutter! Für die Lügen, für das, was sie ihr in der Kindheit angetan hatte, für die Verletzungen, die sie durch ihre Mutter bis zum heutigen Tag erfahren hatte. Und so sehr sie die Erinnerungen an ihre Schwester im Moment auch schmerzten, spürte Sarah, dass nun etwas zum Abschluss gekommen war. Und die Freude über die Tatsache, dass sie in wenigen Wochen einen entscheidenden Schritt aus dem Leben ihrer Mutter hinaustreten würde, ließ sie sogar ein wenig lächeln.
Es machte ihm nichts aus, durch die Dunkelheit zu laufen. Die Dunkelheit war sein Freund. Wenn er an die schönsten Momente in seinem Leben zurückdachte, war es stets dunkel gewesen. Nicht die absolute Dunkelheit, die einen schnell die Orientierung verlieren ließ, die einen Schwindel hervorbrachte, in dem man schnell panisch um sich schlug. Nicht um ein Möbelstück, eine Wand oder eine Tür zu ertasten, die einem seine Position verriet. Sondern um sich schlug, um irgendetwas zu ertasten. Irgendetwas, das einem versicherte, dass da tatsächlich um einen herum etwas existierte. Das einem versicherte, dass die Welt, die normalerweise zu sehen man gewöhnt war, einen noch immer umgab. Das einem versicherte, dass man sich nicht in einer schwarzen Realität befand, die körperlos war, unendlich in Raum und Zeit. Nein, es war die Dunkelheit, in der er sich, wenn sich die Augen den Gegebenheiten angepasst hatten, sehr gut bewegen konnte, sehr gut beobachten, sich zu verstecken vermochte. Die Dunkelheit, die ihm Sicherheit gab, weil sie sein Freund war, aber jedem anderen Feind. Die er liebte, weil sie ihn bevorzugte. Weil ihn die Erfahrung gelehrt hatte, dass es allen anderen mit ihr unwohl war, sie ihm aber Schutz und Geborgenheit bot.
Orientierung war für ihn kein Problem, und selbst wenn sich die schmalen Feldwege, die sich schier endlos durch die ebene Landschaft zogen, kreuzten, musste er nicht lange überlegen, welchem davon er folgen sollte. Und so bewegte er sich so zügig vorwärts, wie es manch einer selbst am Tage nicht schaffen würde. Die Stunden, die er von der Endhaltestelle aus unterwegs war, hatte er mit Gedanken ausgefüllt. Gedanken unterschiedlichster Art. Viele betrafen Erinnerungen, die wenigsten die Gegenwart, die meisten die nahe Zukunft. Er wusste nun, wo sie den Bus verließ und welche Richtung sie danach einschlug. Er konnte schon morgen… nein! Er verwarf den Gedanken. Erstens würde er noch einige Zeit in die genaue Planung investieren müssen. Zweitens konnte er, da er seit gestern wusste, wie er sie auffinden konnte, die Momente, in denen er in ihr Leben trat, auch genießen. Die Momente, in denen er sie beobachten konnte, ohne dass sie dies auch nur erahnte. Ihre Gestik, ihre Bewegungen, ihren zarten Körper, das hübsche Gesicht. In denen er ihr so nahe war, dass er ihre Stimme hören und den Duft ihrer Haare riechen konnte. Er würde ihr also die nächsten Tage aus zwei Gründen folgen, wobei das Studieren ihrer Gewohnheiten wie immer zu Anfang lediglich zweitrangig war. Er erinnerte sich an das erste Mal. Damals war es ihm überhaupt nicht darum gegangen, herauszufinden, in welcher Situation er sie zu sich holen konnte. Er wollte nur in ihrer Nähe sein, wie ein unsichtbarer Begleiter an ihrem Leben teilhaben, das Leben in ihr spüren. Das Leben, die Freude, die er selbst eben nicht mehr imstande war, zu empfinden. So ging es über ein Jahr, bis er der rein optischen und auditiven Wahrnehmungen überdrüssig wurde und sich noch mehr Nähe, physische Nähe wünschte. Damals verging wohl ein wieteres halbes Jahr, bis das Verlangen tatsächlich darin mündete, sich mit der akribischen Planung auseinanderzusetzen, wie er sie auf Dauer in seiner Nähe haben konnte. Mit der Zeit begann das Verlangen einer physischen Verbundenheit immer früher einzusetzen, nichtsdestotrotz versetzten ihn die Beobachtungen, das scheue, unbemerkte Annähern nach wie vor in Glücksgefühle und waren somit wichtiger Bestandteil seines Tuns und Handelns. Bei der nächsten Weggabelung hielt er einen Moment inne. Er wandte sich gen Osten und glaubte am Horizont einen leichten blauen Schimmer erkennen zu können. Bis zum Sonnenaufgang war nicht mehr viel Zeit. Selbst wenn er sich mittlerweile auch bei Tageslicht sicher und unauffällig bewegen konnte, so war er doch froh, dass es nicht mehr weit bis zu dem Parkplatz war, wo er seinen VW-Transporter am Nachmittag abgestellt hatte. Nach den verbleibenden zwanzig Minuten, die er deutlich schnelleren Schrittes weiterlief, war der Himmel tatsächlich zur Hälfte in ein dunkles, fast ins Lila gehende Blau getaucht. Als er den Schlüssel in das Schloss der Fahrerseite steckte, zögerte er einen Moment. Im Laderaum lag eine Matratze, frisch bezogen, verlockend. Er hatte die nächtliche Wanderung genossen, trotzdem war er jetzt müde. Nicht erschöpft, sein
Körper war trainiert und er hätte leicht die doppelte Strecke zurücklegen können, aber müde. Er zog den Schlüssel wieder aus dem Schloss, begab sich an das fensterlose Heck des Transporters und öffnete die Tür. Er zog sie hinter sich zu, verriegelte von innen, ging auf die Knie und rollte sich auf der Matratze ein wie ein Embryo.
Die wärmende Sonne kitzelte an der Nase und mit stark zusammengekniffenen Augen konnte sie die Silhouette der alten Linde erkennen, die in der Ecke des Gartens mit ihrem Blätterwerk ein Spiel aus Licht und Schatten auf ihrem noch blassen Körper und der Gartenliege tanzen ließ. Sie räkelte sich. Das Badetuch, das sie bis eben um den Schultern hatte, rutschte hinunter und fiel zu Boden. Das kümmerte sie nicht. Ihr Interesse galt einem Eichhörnchen, das in raschen Sprüngen über den kurzgemähten Rasen huschte, dann und wann stehenblieb und neugierig in ihre Richtung sah. Besonders faszinierend fand sie, dass sich der buschige Schweif des Nagers trotz der zuweilen großen Sätze, die das Tier machte, überhaupt nicht zu bewegen schien. Jetzt hatte das rotbraune Tier am Rand des Blumenbeets etwas gefunden, eine Nuss des Walnussbaumes vielleicht, die noch vom vergangenen Herbst dort lag. Mit beiden Pfötchen drehte das Eichhörnchen die Nuss und biss an der ein oder anderen Stelle hinein, bearbeitete die harte Schale mit den scharfen Zähnen und schaffte es schließlich, den Leckerbissen zu knacken. Mit dicken Bäckchen, fast wie ein Hamster, fraß es nun den Inhalt der Walnuss und fegte, noch bevor es sein Mahl beendet hatte, blitzschnell über das Gras und an dem Stamm des Baumes hinauf.
Sie runzelte die Stirn. Warum war es aufgescheucht worden? Hatte sie sich doch kaum bewegt und sogar fast aufgehört zu atmen!
Doch dann hörte sie eine Stimme, die von der Terrasse her nur Das Eis! rief und sah, dass ihre Schwester das vor wenigen Minuten versprochene Eis in großen Bechern aus dem Haus brachte.
»Ja, Eis!«, freute sie sich lautstark und sprang von der Liege. Sie lief schnell um den Pool, um das kalte, süße Eis in Empfang zu nehmen, auf das sie sich seit dem späten Vormittag so gefreut hatte. Ihre Mutter wollte es ihnen zubereiten und in den Garten bringen, doch sie war den ganzen Tag nicht erschienen. Umso besser, dass ihre Schwester wusste, wo sich alles befand und auch schon richtig gut darin war, die Creme mit dem Ausstecher aus der Dose zu kratzen, und in ansehnlichen Kugeln in die Becher zu stapeln. Welche Sorten sie wohl ausgesucht hatte?
»Hol es dir, hol es dir!«
Sie schaute verdutzt auf. Ihre Schwester war mit beiden Bechern um den Pool gelaufen und befand sich auf der anderen Seite. Sie lachte hämisch hinüber.
»Hol es dir, hol es dir!«, wiederholte sie.
»Du bist gemein!«
Sie rannte rechts um den Pool, doch ihre Schwester lief immer in entgegengesetzter Richtung, so dass sie stets genau auf der gegenüberliegenden Seite war. Sie lachte und tanzte.
»Hol es dir, hol es dir!«
Das war zuviel! Sie konnte das Eis sehen, konnte erahnen, wie es in der Sonne zu schmelzen begann.
»Du bist so gemein«.
Sie fing an zu weinen. Die Arme vor dem Gesicht verschränkt schielte sie zu ihrer Schwester, um ihre Reaktion zu beobachten. Noch war sie nicht sonderlich beeindruckt und trieb ihr Spiel weiter.
»Heulsuse, hol es dir!«
Statt um den Pool zu rennen und die aussichtslose Jagd fortzusetzen, ließ sie sich auf den Boden fallen und erhöhte Frequenz und Lautstärke ihres nunmehr herzzerreißenden Tränenausbruchs: Fast war es schon ein verzweifeltes Schreien in der Vorahnung, das leckere, erfrischende Süß nicht mit dem Löffel zu schlecken, sondern einer Limo gleich einfach nur zu trinken. Obwohl sie sich auf dem Boden hin- und herwarf und auch mit den kleinen Fäustchen auf die Terracottafliesen schlug, versäumte sie es nicht, das Verhalten ihrer Schwester zu beobachten. Offensichtlich von der Angst geplagt, ihre Mutter würde wider Erwarten aus dem Haus stürmen und eine saftige Standpauke halten, vielleicht mit einer Ohrfeige versehen, um für mehr Nachdruck zu sorgen, gab ihre Schwester ein Pschschschscht! von sich und beeilte sich, das Eis nun doch zu ihr zu bringen. Den Heulanfall jetzt schon abzuschwächen oder gar ganz aufzugeben, kam ihr jedoch nicht in den Sinn. Das hatte ihre Schwester davon. Sie wollte es solange ausreizen, bis sie als der unumstrittene Sieger aus diesem Gefecht hervorgegangen war. Von ihrer Schwester einfach so das Eis entgegenzunehmen, war definitiv nicht genug. Also zappelte sie am Boden weiter, bis ihre Schwester, die anfing, beruhigend auf sie einzureden, unmittelbar neben ihr stand. Bevor sie sich zu ihr hinunterbeugen konnte, um ihr das Eis zu überreichen, sprang sie mit lautem Kampfgeschrei blitzschnell auf, um ihrer erschrockenen und entsetzt dreinblickenden Schwester das Eis zu entreißen.
Lena stolperte. Doch anstatt die beiden Eisbecher fallen zu lassen, um den Sturz abzufangen, bemühte sie sich noch im Fallen die Süßigkeit vor der gewaltsamen Entwendung zu bewahren und riss beide Arme in die Höhe. Sie schlug mit dem Kopf auf die Travertineinfassung des Pools, und die Eisbecher entglitten ihren Händen. Eines der Gläser zerschellte laut splitternd auf dem Terracotta, das andere wurde mit einem tiefen Glucksen vom Wasser des Pools verschluckt. Da Sarah direkt über ihrer Schwester stand, konnte sie sehen, dass Lena die Augen verdrehte und wie in Zeitlupe in das Becken rutschte, erst ihr rechtes Bein, dann das linke, ihre Hüfte, ihr Oberkörper und schließlich ihr Kopf. Noch glaubte sie, Lena wolle sie veräppeln, um ihrerseits die Auseinandersetzung mit einem Sieg im Finale zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Opferung der beiden Eisbecher wäre allerdings ein sehr gewagter Schritt gewesen, schließlich musste das Malheur ja auch ihrer beider Mutter irgendwie erklärt werden. Doch ihrer großen Schwester hätte sie sogar das zugetraut. Dann aber entdeckte sie den dunkelroten Fleck auf dem Beige des Travertin und sah sofort angstvoll in das türkisblaue Becken. Lena trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Von ihren Haaren breitete sich in immer dünner werdenden Fäden das Blut aus, so, als würde man einen Pinsel mit Wasserfarben in ein Glas mit Wasser tupfen. In Schockstarre beobachtete sie einige Sekunden, wie das Blut ihrer Schwester ständig in Bewegung verschlungene, fast anmutige Bilder malte, während es sich nach und nach mit dem klaren Wasser des Pools vermengte.
Mit einem Mal begriff sie, dass sich Lena keinesfalls einen Scherz auf ihre Kosten erlaubte, sondern sich wirklich verletzt hatte und in ernster Gefahr schwebte.
»Lena!«, schrie sie laut und sah sich hilfesuchend um. Sie konnte mit ihren sechs Jahren schon gut schwimmen, aber sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter hatten ihr eingeschärft, nicht in den Pool zu gehen, solange nicht einer von ihnen dabei war.
»Lena! Lena!«, schrie sie und jetzt rannen auch echte Tränen ihr Gesicht hinab. Sie begriff, dass sie ihrer Schwester mit lautem Schreien nicht helfen konnte.
»Mama!«, kreischte sie nun und konnte den Blick nicht von dem leblos im Wasser treibenden Körper wenden.
»Mama! Komm ganz schnell! Mama!«
Obwohl es ihr unendlich schwer fiel, Lena zurückzulassen, hastete sie zum Haus, um ihre Mutter zu holen.
»Mama! Mama!«
Im Wohnzimmer war sie nicht, also rannte sie weiter in das Esszimmer. Auch dort niemand.
Auch in der Küche nicht.
»Mama!«
Sie stürzte in den kleinen Salon. Dort endlich sah sie ihre Mutter, die sich langsam auf der Liegecouch aufrichtete.
»Mama, komm ganz schnell! Lena ist etwas passiert!«
Die zeitlupenartigen Bewegungen ihrer Mutter machten sie rasend. Sie zerrte sie am Ärmel, riss fast die Seidenbluse entzwei, als sie versuchte, ihre Mutter vom Sofa zu ziehen.
»Mama, du musst kommen, ganz schnell! Lena ertrinkt!«
Doch anstatt wie elektrisiert aus der Chaiselongue aufzufahren, starrte ihre Mutter sie nur mit stark geröteten Augen an und bewegte sich kaum.
»Mama! Beeil dich!«
Ihre Mutter kniff die Augen zusammen.
»Ich komme ja schon.«
Sie versuchte, aufzustehen, musste sich jedoch mit der rechten Hand abstützen, um nicht wieder zurück auf das Sofa zu fallen.
»Einen Moment noch…«
Es dauerte zu lange. Ohne auf ihre Mutter zu warten, rannte sie aus dem Salon, durch das Esszimmer, das Wohnzimmer, über die Terrasse und sprang mit Anlauf in den Pool.
Sie hatte Lena schnell erreicht; ihre Schwester bewegte sich immer noch nicht, ihr Körper war bis auf den Hinterkopf und die langen Haare schon unter die Oberfläche gesunken und trieb senkrecht in dem zartrosa gefärbten Wasser. Sie griff nach Lenas Arm, tastete sich bis zu ihrer Hand und begann, sie mit wildem Paddeln Richtung Beckenrand zu ziehen. Es war so schwer, sie kam kaum vorwärts, musste nach Luft schnappen, schluckte Wasser, hustete. Einmal musste sie ihre Schwester loslassen, um nicht selbst zu ertrinken. Doch sie gab nicht auf, fasste Lena am Oberarm und kämpfte weiter. Beinahe hätten sie ihre Kräfte auf dem letzten kleinen Stück verlassen, doch sie schaffte es bis zu der Edelstahlleiter, an der sie sich festhielt und krampfhaft versuchte, Mund und Nase ihrer Schwester über Wasser zu halten.
»Lena!« Sie weinte bitterlich. Die Versuche, sie aus dem Wasser zu ziehen oder zu schieben, scheiterten bereits im Ansatz.
»Lena! Komm schon, du bist so schwer! Lena! Mama! Hilf mir, Mama!«
Doch ihre Mutter erschien nicht.
Sie legte Lenas Kopf in die Armbeuge und starrte in die weit geöffneten Augen ihrer blau angelaufenen, reglosen Schwester.
»Lena! Lena!«
Mit einem Ruck durch den ganzen Körper riss es Sarah aus dem Schlaf! Die Sonne schien ihr in das nasse Gesicht. Sie verspürte einen riesigen Druck auf ihrer Kehle und konnte nur stoßweise atmen. Ihr ganzer Körper war schweißgebadet, das weiße T-Shirt klebte an ihrer Haut, und auch ihre nackten Beine waren so nass, dass das Leintuch komplett vollgesogen war. Sie rang nach Luft, und es wurde ihr speiübel. Sie presste die Arme auf ihren Bauch. Der Schmerz und die Trauer waren so präsent, so real, dass sie der schreckliche Alptraum immer noch gefangen hielt! Ihre Gefühle überschlugen sich!
»Lena! Nein!«, schrie es aus ihr heraus! Ihr ganzer Körper war ein einziges Schütteln und Zucken, wie bei einem schweren Fieberanfall. Ihre Beine zitterten unter dem nassen Leintuch, und auch ihre Schultern, ihre Arme und ihr Kopf bewegten sich unkontrolliert und ruckartig.
»Lena! Nein!«
Jetzt war es nur noch ein Wimmern. Sie kippte zur Seite, krümmte sich qualvoll in ihrem durchnässten Bett und erstickte ihr Schluchzen in dem dicken, flauschigen Kopfkissen.