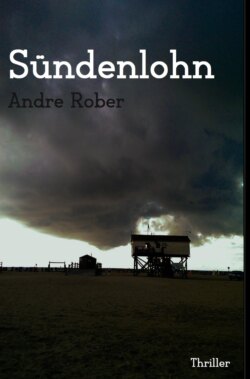Читать книгу Sündenlohn - Andre Rober - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеAm nächsten Morgen fuhr Inge Westerhus erst gar nicht zur Polizeidirektion in Husum, sondern machte sich auf die knapp einhundert Kilometer lange Fahrt nach Kiel. Als sie den Kombi in die Arnold-Heller-Straße lenkte und das große rote Gebäude vor ihr auftauchte, begann ihre Stimmung zu kippen. Da sie wusste, was sie in wenigen Minuten hinter den Mauern dieses Hauses erwartete, hatte sie wieder die Bilder vom Vortag im Kopf. Heute würde aber der Abstand, mit dem sie gestern an die unbekannte Tote herangetreten war, durchbrochen werden. Heute würde sie mehr über die Frau erfahren. Es würden ihr Stück für Stück Erkenntnisse und Details zugeordnet werden, Lebensumstände, ältere Verletzungen, ihr Alter, Haarfarbe, ob sie schon einmal ein Kind geboren hatte. Vielleicht sogar ihren Namen, und ob sie Verwandte, Eltern, vielleicht einen Partner oder Ehemann hatte. Aus dem anonymen, entstellten Körper würde nach und nach das Bild eines Menschen, einer Persönlichkeit entstehen, die gelebt, Freunde, Ziele und Träume gehabt hatte. Sie würden auch erfahren, wie sie gestorben war, ob langsam oder schnell. Ob sie ohne Schmerzen aus dem Leben geschieden war oder ob sie zu leiden hatte. Dieser Prozess bei den Ermittlungen, wo aus dem bloßen Körper, der toten Materie zuerst das Bild eines Menschen gezeichnet wurde, um es dann durch die Klärung der Umstände des Todes wieder zurück zu dem verdreckten, halb verwesten Bündel aus dem Watt zu führen, machte den Termin in der Rechtsmedizin für Inge Westerhus zu einem solch nagenden Ereignis. Einem Ereignis, dem sie nicht unvorbereitet begegnen wollte. So blieb sie, nachdem sie den Wagen vor dem Haus mit der Nummer drei abgestellt hatte, erst ein paar Minuten sitzen, um sich zu sammeln und sich auf das, was sie erwarten würde, vorzubereiten.
Als ein offener TT Roadster schwungvoll in die Parklücke neben ihr rauschte, drehte Inge Westerhus unweigerlich den Kopf. Hinter dem Steuer des Sportwagens saß Alice Peters, die sofort wild in Westerhus` Wagen hineinwinkte. Die Polizistin hatte mit dem Eintreffen der Ärztin und Freundin gerechnet: Im Rahmen ihrer ständigen Weiterbildung für die Polizeiarbeit war sie öfters am rechtsmedizinischen Institut der CAU, und da sie in diesem Fall die erste Leichenschau durchgeführt und den vorläufigen Totenschein ausgestellt hatte, war klar, dass sie am heutigen Tag dabei sein würde. Über eine Fahrgemeinschaft nach Kiel hatten sie nie gesprochen. Alice Peters liebte ihren TT zu sehr, um in dem Astra von Westerhus mitzufahren, und die Polizistin ihrerseits war eine denkbar schlechte Beifahrerin, vor allem in schnellen, zweisitzigen Autos, die noch dazu über kein richtiges Dach verfügten. So kam es, dass, wann immer sie gemeinsam in Kiel zu tun hatten, beide mit ihrem eigenen Auto fuhren. Die beiden Frauen stiegen aus, begrüßten einander kurz und schritten zielstrebig zum Eingang der Rechtsmedizin.
»Seien Sie gegrüßt! Was für eine Freude, Sie beide wieder einmal in meiner Wirkungsstätte begrüßen zu dürfen«, begrüßte sie Professor Klaas Herrmann überschwänglich. In Erwartung einer anzüglichen Bemerkung schüttelten erst Alice Peters und dann Inge Westerhus die Hand des etwa 1,65 kleinen Endfünfzigers. Der Rechtsmediziner, dessen pechschwarzes Toupet wie immer perfekt saß, erwiderte den Handschlag mit einem kaum wahrnehmbaren Druck seiner schweißigen Hand und hielt dennoch einige Sekunden länger als nötig den Körperkontakt, nicht ohne seinen beiden weiblichen Besuchern dabei tief in die Augen zu schauen. Professor Herrmann, Single und geradezu besessen von seiner eigenen Person, bewegte sich mit seinen Äußerungen, seinem Verhalten, seinen Gebärden praktisch stets am Rande des Sexismus, nie so direkt, als dass man ihn damit konfrontieren könnte, aber für Westerhus` und Peters` Geschmack konstant in einer unangenehmen Grauzone der männlich-weiblichen Interaktion. Er selbst mochte es als charmant bezeichnen, für sein vorwiegend weibliches Umfeld, das er sich hier am Institut der Christian-Albrechts-Universität über die Jahre geschaffen hatte, war es meist eine halbe Stufe unterhalb der Belästigung. Seine Distanzlosigkeit, die aus dem Glauben entstand, er sei der Versteher und messianische Berater der ihn umgebenen weiblichen Belegschaft, wurde auch von seinem direkten Umfeld meist nur belächelt. Da so etwas außerhalb seiner Wahrnehmung stattfand – schließlich wollten es sich die meisten um ihrer Karriere willen auch nicht mit dem Chef verscherzen – und auch nie direkte Kritik von anderer Seite geäußert wurde, hatte sich bei dem Institutsleiter eine Selbstsicherheit manifestiert, die beinahe sämtliche männliche Mitarbeiter des Instituts mit der Zeit derart vergrault hatte, dass sie sich versetzen ließen. Allein sein Obduktionsassistent Klaus Feeren war seit langem eine feste Institution in den Seziersälen Professor Herrmanns. Das lag nicht etwa an einer strapazierfähigen Geduld oder gar an der Rolle, die ihm als Assistenten in der Hierarchie zukam, sondern schlicht an der Tatsache, dass Feeren als bekennender Homosexueller in Herrmanns Augen eher in die Schublade weiblich, zwar nicht wirklich, aber irgendwie doch, gehörte. Folglich wurde er nicht Opfer der harschen Zurechtweisungen und verletzender Kritik, sondern er musste vielmehr die aufgedrängten Analysen und grenzüberschreitenden Ratschläge seines Chefs erdulden. Doch dies tat er mit Bravour: Ihm war nie anzumerken, ob er die Worte seines Chefs einfach hinunterschluckte, sie ignorierte oder innerlich darüber lächelte – er erweckte immer den Eindruck, dankbar zu sein.
Professor Herrmann schob sich geschickt zwischen Westerhus und Peters, legte seine Hände auf die Schultern der Frauen und dirigierte sie in Richtung des Aufzugs.
»Meine Damen, kommen Sie, ich werde Sie gleich in die Ergebnisse der Obduktion einweihen, oder möchten Sie zuvor noch etwas zur Stärkung, einen Kaffee oder ein Laugenbrötchen?«
Die beiden Angesprochenen verneinten höflich und nahmen vor der Aufzugtür Stellung, während Herrmann mit seinem Schlüssel an dem Bedienfeld hantierte, um seinen Ruf zu priorisieren. Während sie warteten, beugte sich Herrmann zu Alice Peters und sog deutlich hörbar Luft durch die Nase.
»Frau Peters, Sie duften aber heute besonders gut, Dolce und Gabbana?« fragte er in der Meinung, der Kollegin ein Kompliment zu machen.
Dass Alice Peters mit einem eher angewiderten Gesichtsausdruck zurückwich, verständnislos den Kopf schüttelte und keinen Ton dazu verlor, schien ihn nicht zu kümmern.
Kaum widmete er sich wieder der Aufzugsteuerung tauschten die beiden Frauen vielsagende Blicke, die aber nach wenigen Sekunden mit einem gleichgültigen Schulterzucken und nach oben gezogenen Augenbrauen ihren Abschluss fanden. Solche, für sie beide als selbstbewusste, in ihrem Beruf erfolgreiche Frauen schlicht postpubertär wirkenden Sprüche des Rechtsmediziners mochten den Professor zwar als Person noch unsympathischer machen, täuschten über dessen fachliche Kompetenz und akribische Arbeitsweise jedoch keinesfalls hinweg. Gemäß des Little-Man-Syndroms, so hatte Alice Peters es Inge Westerhus einmal bei einem Glas Wein erklärt, versuche er seine äußerlichen und menschlichen Defizite in anderen Bereichen zu kompensieren, und genau deshalb war er ein so herausragender Rechtsmediziner geworden. Auf die Frage, ob das auch ein Grund dafür sein könne, dass er ausgerechnet mit
Leichen arbeitete, von denen zwar keine Anerkennung zu erwarten sei, aber eben auch keine Widerrede, hatte Peters nur grinsend geschwiegen. Kurzum, seine Brillanz und Ausdauer machten ihn zu einem absolut zuverlässigen Quell forensischer Informationen und zu einem unersetzlichen Glied in der Kette von Mordfallermittlungen.
Was sowohl Westerhus als auch Peters besonders am heutigen Tag an dem Rechtsmediziner schätzten, war die Tatsache, dass er mit drei bis vier Stunden Schlaf auskam. Natürlich rühmte er sich mit dieser Fähigkeit bei jeder Gelegenheit und verpasste auch niemals, bezüglich der Besonderheit auf die Parallelen mit Napoleon hinzuweisen. Dass dem französischen Kaiser - wenn auch laut Historikern zu Unrecht - eine auffallend kleine Statur zugeschrieben wird, wurde nur spöttisch hinter seinem Rücken kommentiert. Nichtsdestotrotz lagen genau wegen dieses Umstandes die Obduktionsergebnisse bereits vor, schließlich hatte der Professor den Leichnam der Frau aus dem Watt erst am späten Nachmittag des Vortages in Empfang genommen. Wahrscheinlich hatte er bis drei oder vier Uhr morgens gearbeitet und dann in der kleinen Schlafkammer neben seinem Büro den Rest der Nacht verbracht.
Heute schien Professor Herrmann allerdings nicht auf seinem reduzierten Schlafbedürfnis herumreiten zu wollen, die Fahrt mit dem Aufzug und der anschließende Gang durch den Korridor waren von Schweigen geprägt. Erst als die Drei die schweren, mattgescheuerten Edelstahltüren des Obduktionsbereichs erreichten, tat Herrmann wieder den Mund auf.
»Bitte sehr die Damen, gehen Sie gleich durch. Es ist hier im Moment nicht viel los. Tisch Nummer fünf, Feeren hat sie uns schon rausgeholt. Ich sehe nur schnell nach dem Bericht und organisiere zwei Paar Handschuhe.«
Westerhus und Peters nickten und setzten sich in Richtung des hinteren Teiles des Raumes in Bewegung. Gemäß der Ankündigung Professor Herrmanns waren die ersten vier Tische nicht belegt, erst auf dem vorletzten war ein mit einem weißen Leintuch bedeckter Körper zu sehen. Bei Inge Westerhus machte sich ein sehr vertrautes Gefühl breit: eine Mischung aus Furcht, Mitleid, Ekel und Neugier. Viele Leichen hatte sie auf dem Obduktionstisch noch nicht gesehen. In der Ausbildung war es eine Pflichtveranstaltung, dem fachmännischen Zerlegen eines menschlichen Leichnams beizuwohnen. Für die Polizeianwärter hatte das im Wesentlichen drei Gründe: Zum Einen sollten sie mitbekommen, wie die Arbeit eines Rechtsmediziners aussah. Dies nicht zuletzt, um ihnen vor Augen zu führen, welche Möglichkeiten in der modernen Forensik bestanden, die Aufklärung eines Verbrechens maßgeblich voranzutreiben. Der zweite Zweck der Übung war es, sie auf den Anblick eines toten Menschen vorzubereiten. Wenn man so wollte, um einen gewissen Grad an Gewöhnung, nicht Abstumpfung, zu erzeugen. Dahinter stand der Gedanke, dass all die Emotionen und Reaktionen, die beim direkten Kontakt mit einer Leiche mehr oder minder stark ausgeprägt auftraten, nicht zum ersten Mal bei einem echten Delikt und an einem echten Tatort auftraten. Zu guter Letzt war die schonungslose Konfrontation, die relativ früh während der Ausbildung stattfand, natürlich ein Test. Ein Test, der sowohl den Ausbildern als auch dem Kandidaten selbst aufzeigen konnte, ob die Entscheidung für die Polizei als solche oder eine entsprechende Abteilung auch die richtige war. Immer wieder kam es vor, dass Kandidaten angesichts eines grausam zugerichteten Unfallopfers oder einer gewaltsam getöteten Person ihre Entscheidung revidierten. Bei Inge Westerhus war der Mix der Gefühle bei jenem ersten Mal genau derselbe, wie die Male danach oder auch am heutigen Tag. Ihre Reaktion hatte an Intensität über die Zeit verloren, dennoch war sie in der Lage, die einzelnen Nuancen ihrer Emotionen zu isolieren und für sich auch zu bewerten. Eine Fähigkeit, die sie schon damals besaß und die ihr half, die Auswirkungen des Erlebnisses auf ihr Berufs- und Privatleben relativ gut einzuschätzen. Darin sah sie auch mit einen Grund dafür, dass sie ihre Entscheidung, mit Leib und Seele Polizistin zu sein, zu keiner Sekunde bereut hatte.
Als Professor Herrmann leise von hinten an Alice Peters und sie herantrat und anscheinend im Glauben, eine mitfühlende Geste zu machen, ihnen die Hände abermals auf die Schultern legte, zuckte Inge Westerhus förmlich zusammen. Doch angesichts der toten Frau unter dem Leintuch vor ihnen unterdrückte sie jede harsche Zurechtweisung oder gar physische Abwehr, sondern begnügte sich damit, zur Seite zu treten und den Edelstahltisch zu umrunden. Gleich würde der Rechtsmediziner ohnehin rein professionell agieren und sachlich auf ihre Fragen antworten, so waren sie und Peters das gewöhnt. Trotzdem konnte sie ein süffisantes Lächeln nicht unterdrücken, als Herrmann auf die Operationsleuchte deutete, die ganz knapp außerhalb seiner natürlichen Reichweite unter der Decke hing, und fragte:
»Dürfte ich Sie kurz bitten?«
Westerhus griff wortlos nach der EMALED-Lampe, zog sie auf Arbeitshöhe und schaltete sie ein. Kaum fiel das weiße Kaltlicht auf den Obduktionstisch, schlug Herrmann das Tuch, das den Leichnam bedeckte, zurück. Wie immer, wenn er die Erkenntnisse seiner Untersuchungen vortrug, nahm seine Stimme einen komplett anderen Ton an.
»Wir haben hier den Leichnam einer Frau, Alter Mitte zwanzig. Zirka einen Meter achtundfünfzig, zu Lebzeiten schätzungsweise 43 Kilogramm schwer, was bedeutet, dass sie auffallend schlank gewesen sein muss.«
Sofort hakte Alice Peters ein.
»Das ist ja fast schon anorektisch! Gibt es Hinweise darauf?«
Herrmann schüttelte den Kopf.
»Nein. Soweit ich das beurteilen kann, war ihre Physis in bestem Zustand. Keinerlei langfristige Mangelerscheinungen. Auf die kurzfristigen komme ich später. Stabiler Knochenbau, unauffällige Organe, normale Muskelmasse. Auch weisen Zähne, Speiseröhre oder Magen nicht auf eine bulimische Ausprägung einer Anorexie hin. Sie war wohl einfach nur sehr schlank. Außerdem, und das sehen Sie ja selbst, war sie vom Körperbau schon fast leptosom, kaum weibliche Formen. Knabenhaftes Becken. Sehr filigrane Gliedmaßen. Lediglich die Mammae waren, wenn auch relativ klein, doch innerhalb der Varianz des altersgemäßen Durchschnitts ausgebildet.«
Herrmann ließ den beiden Frauen Zeit, seine Worte anhand des Leichnams zu verifizieren. Als beide den Blick hoben und ihn ansahen, referierte er weiter.
»Haare kurz, Farbe brünett. Augenfarbe wegen fehlender Bulbus Oculi leider nicht feststellbar, da haben uns die Vögel oder anderes Getier einen Strich durch die Rechnung gemacht«.
Obwohl die letzte Bemerkung für Herrmann untypisch war, nahmen weder Alice Peters noch Inge Westerhus Anstoß daran. Zu offensichtlich waren die Fressspuren der Nordseefauna am ganzen Körper der Frau zu erkennen.
»Zahnschema ohne besonderen Befund. Ihre Weisheitszähne wurden ihr vor einigen Jahren entfernt. Ebenso die zweiten Prämolaren des Unterkiefers, was auf einen Engstand und eine kieferorthopädische Behandlung in jungen Jahren hindeutet.«
»Können Sie eingrenzen, woher sie stammt«? wollte Inge Westerhus wissen.
Herrmann nickte.
»Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit aus einem der hochentwickelten Länder. Ich würde Mitteleuropa sagen. Vielleicht Osteuropa, da wird zum Teil auch sehr viel gemacht. Deutschland ist absolut möglich, aber nicht wahrscheinlicher als die anderen Staaten. Zu vage, um sich festzulegen.«
»OK«, murmelte Westerhus nur, und Herrmann nahm den Faden wieder auf.
»Ansonsten keinerlei Hinweise auf medizinische Eingriffe. Eine Speichenfraktur des linken Arms liegt schon etliche Jahre zurück und ist ohne Operation sauber verheilt. Abnutzung von Gelenkknorpel und Bandscheiben sind altersgemäß und durchschnittlich. Daher sind Rückschlüsse auf eine bestimmte Tätigkeit oder Leistungssport leider nicht möglich.«
»Schade«, meinte Alice Peters, »ich könnte mir vorstellen, dass ihr es eh schon schwer habt, sie zu identifizieren.«
»Abwarten«, entgegnete Inge Westerhus zuversichtlich und an Herrmann gewandt: »Haben Sie die Fingerabdrücke schon ans LKA geschickt?«
»Habe ich, die kommen direkt auf Sie zu, wenn sie was haben.«
»OK. Fertig mit den Fakten zur Person?«
»Eine Sache noch: Schauen Sie mal hier.«
Herrmann hob den rechten Arm der Toten an und deutete
mit dem Zeigefinger auf eine unregelmäßige dunkle Verfärbung an dessen Innenseite.
»Das hat mit dem Tod der Frau nichts zu tun. Es handelt sich meiner Meinung nach um ein Tatoo. Leider stark in Mitleidenschaft gezogen. Irgendeine Art Tribal, schätze ich.«
Peters und Westerhus betrachteten die feinen Flecke aufmerksam.
»Foto ist bei den Unterlagen?«, fragte die Polizistin, ohne den Blick abzuwenden.
»Natürlich, mit Größenskala.« Herrmann fasste solche Nachfragen niemals als Kritik auf. Er wartete, bis die beiden Frauen sich abwandten und ließ den Arm der Toten wieder sinken.
»So viel zur Person. Kommen wir auf die Verletzungen und die Umstände des Todes. Da habe ich sehr, sehr traurige Nachrichten für Sie«.
Er schaute Inge Westerhus und Alice Peters mit gehobenen Augenbrauen an und schien auf ein Zeichen zu warten, dass sie für die nun folgenden Ausführungen bereit waren.
»Schießen Sie los«, forderte die Ärztin ihren Kollegen auf und stützte sich mit beiden Armen auf den Edelstahltisch.
»Die Verletzungen an Augen und Mund, sowie einige kleinere Abschürfungen und natürlich auch die Fesselspuren sind prämortal entstanden. Lassen wir die Spuren, welche die Vögel, Krebse und der ein oder andere Fisch hinterlassen haben, einmal außer Acht, sind es wirklich lediglich diese wenigen Verletzungen. Aber die, das brauche ich Ichnen nicht zu sagen, haben es leider in sich«.
Er deutete auf den Mund der Frau.
»Ihr wurden Mund und Augen mit einem Paketgarn zugenäht. Da hat sie definitiv noch gelebt. Ob sie allerdings bei Bewusstsein war, kann ich Ihnen leider nicht sagen, auch wenn Sie sich das, so wie ich, sicherlich innigst wünschen.«
Inge Westerhus schüttelte mit vorgehaltener Hand entsetzt den Kopf, während Alice Peters sich interessiert vorbeugte, um die regelmäßigen Wunden im Mundbereich genau zu studieren.
»Ich habe selbstverständlich Proben des Garns an das LKA-Labor geschickt, vielleicht ist der Hersteller zu ermitteln. Wie Sie beide sehen, hat der Täter mit der Nadel – ich schätze eine Teppich- oder Polsternadel größeren Kalibers – nicht durch die Lippen gestochen, sondern durch das umgebene Fleisch. Dadurch lässt sich der Mund durch Festzurren gut verschließen, und das Risiko des Ausreißens eines Stiches ist nicht so groß.«
Herrmann referierte die Fakten ohne jegliche erkennbare Emotion oder Rücksichtnahme.
»Und jetzt kommt etwas Spannendes: Unmittelbar nach Setzen der Naht hat er flüssiges Kerzenwachs auf jeden Stich geträufelt. Ich habe verschiedene Theorien, warum er das gemacht hat. Qual oder Folter ist natürlich möglich, jedoch von meinem Standpunkt aus nicht wahrscheinlich. Der Schmerz des Stechchens und Durchziehens des relativ dicken Garns war, vorausgesetzt die Frau war bei Bewusstsein, so groß, dass das heiße Wachs sicher nicht noch schlimmer war. Ich würde vermuten dass auch ein geisteskranker Perverser in der Lage ist, das abzuschätzen.«
»Und warum könnte er es dann getan haben?«, fragte Inge Westerhus und strich sich gedankenlos mit dem Zeigefinger um ihre Ober- und Unterlippe, so als stellte sie sich die Schmerzen vor, die die junge Frau während der entsetzlichen Tortur ertragen musste.
»Entweder, er wollte die Blutung stoppen, denn gerade um den Mund herum ist das Gewebe ja besonders stark durchblutet. So konnte er zumindest verhindern, dass Blut nach außen, also in ihr Gesicht floss. Nach innen haben die Wunden natürlich weitergeblutet. Ich habe geringe Mengen an Blut im Magen nachweisen können, die sie in den Stunden nach der Verletzung geschluckt haben muss. Nach vier, fünf Stunden dürften die Wunden dann auch im Mundraum geschlossen gewesen sein. Der zweite Grund, den ich mir vorstellen könnte, wäre der naive Versuch, die Wunden zu desinfizieren, beziehungsweise zu versiegeln. Einen geringen Effekt in diese Richtung dürfte das heiße Wachs sicher gehabt haben.«
Inge Westerhus, die immer noch ihre Lippen knetete, sagte wie zu sich selbst:
»Das Blut, das er nicht sah, war ihm egal, aber in ihrem Gesicht wollte er es nicht haben… Das halten wir mal für das Profiling fest, ist ja vielleicht ein Puzzleteil. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen?!«
Herrmann schüttelte den Kopf.
»Nicht doch! Kein Problem. Soll ich weitermachen?«
»Ja, sicher!«, ermunterten ihn Alice Peters und Inge Westerhus gleichzeitig.
»Für Sie und Ihr Profiling ist vielleicht auch wichtig, dass der Mund erst einige Zeit nach den Augen zugenäht wurde. Im Bereich von Tagen, vielleicht einer Woche. Ich für meinen Teil finde das ziemlich bemerkenswert! Außerdem hat der Täter auch hier, vergleichbar mit seinem Vorgehen beim Mund, nicht etwa das Lid vernäht, sondern das umliegende Gewebe. Anschließend hat er wieder die Stiche mit heißem Wachs beträufelt. Ihre Augäpfel dürften bei der gesamten Prozedur nicht zu Schaden gekommen sein. Dass sie fehlen, schiebe ich, wie anfangs erwähnt, auf die Fressgier der Vögel, Fische oder Kriechtiere.«
»Aber der Mund folgte eine Woche später!«, überlegte Inge Westerhus halblaut. »Das bedeutet, dass er sie eine ganze Weile in seiner Gewalt hatte, bevor er sie getötet hat! Was für ein krankes Hirn! Hat er sonst noch etwas mit ihr gemacht? Ich meine zum Beispiel, sexuelle Handlungen vorgenommen, eine Vergewaltigung?«
Der Rechtsmediziner schüttelte den Kopf.
»Hierfür habe ich keinerlei Anzeichen gefunden. Die Frau war zwar keine Jungfrau mehr, aber alles deutet darauf hin, dass sie zu Lebzeiten nur einvernehmlichen und auch nicht besonders harten Geschlechtsverkehr hatte. Ich habe weder ältere noch aktuelle Vernarbungen oder Verletzungen feststellen können. Was ich nicht ausschließen kann, ist, dass er sich an ihr in bewusstlosem Zustand vergangen hat. Ich habe trotz der Liegezeit Abstriche gemacht und lasse gezielt nach Sperma, Spermizid und Gleitmitteln suchen. Aber meine ehrliche Meinung? Da ist nichts passiert. Auch die Tatsache, dass sie, bis auf die Einwirkung des Salzwassers und den natürlichen Schmutz, einen unversehrten Slip trug, unterstützt diese These.«
»Haben Sie daran eine Verschmutzung durch Kot oder Urin feststellen können?«, wollte Alice Peters wissen und sowohl Herrmann als auch Westerhus war der Hintergrund der Frage sofort klar.
»Nur im Umfang des normalen Gebrauchs von Unterwäsche. Sie hat nicht in ihre Kleidung defäktiert. Das wollten Sie doch wissen?«
»So ist es. Das und die Tatsache, dass sie sich mindestens eine Woche in seiner Gewalt befand, sagt uns wieder etwas über unseren Täter: Er hat ihr den Toilettengang gestattet. Das heißt, er verhält sich in gewissem Maße fürsorglich seinem Opfer gegenüber.«
Inge Westerhus setzte einen weiteren Punkt auf die Gesprächsliste mit ihrer Kollegin Sarah Hansen, die sie ja am folgenden Tag erwartete.
»Aber nur zu einem gewissen Maß. Sie erinnern sich an meine Bemerkungen zu ihrem Allgemeinzustand? Wenn man die letzte Zeit vor ihrem Tod in Betracht zieht, würde ich sagen, sie hat, während sie in seiner Gewalt war, nichts zu essen und auch nur ein absolutes Mindestmaß an Flüssigkeit bekommen. Der Zustand von Magen, Nieren und Leber, sowie einige Gewebewerte lassen diesen Schluss zu. Mal davon abgesehen, dass die Nahrungsverabreichung nach Zunähen des Mundes sowieso nur intravenös oder durch eine Magensonde möglich gewesen wäre. Aber für keine dieser beiden Möglichkeiten habe ich Anhaltspunkte gefunden.«
Herrmann wandte sich ab, ging zu einer in der Ecke stehenden Kommode und zog eine Schublade auf.
»Ist sie verhungert oder verdurstet?«, fragte Alice Peters in gewohnt nüchterner Manier, während Westerhus den Professor wieder mit entsetzten Augen ansah.
»Weder noch. Sie ist ertrunken.«
Es kam angesichts der letzten Informationen fast schon Sarkasmus gleich, dass sich Herrmann aus der Schublade eine halbvolle Flasche Perrier griff, sie öffnete und in einigen großen Zügen leerte. Dann trat er wieder an den Edelstahltisch.
»Das heißt, der Täter hat sie in diesem Zustand einfach ins Meer geworfen und sie ihrem Schicksal überlassen?«
»Nein, als er sie ins Meer warf, war sie bereits tot. Sie hat nämlich eindeutig in Süßwasser ihr Leben verloren.«
»In Süßwasser?« Inge Westerhus runzelte die Stirn.
»Ja, in Süßwasser. Und es war kein Leitungswasser. Zum Glück, denn sonst hätte ich das möglicherweise gar nicht nachweisen können.«
Alice Peters sah den Rechtsmediziner interessiert an.
»Sie haben es über einen Kleinorganismus oder ähnliches
herausgefunden?«, fragte sie lebhaft.
»Richtig!« Herrmann griff in die Schachtel am Fußende der Toten und förderte eine kleine verschlossene Eppendorf-Ampulle zutage.
»Darf ich vorstellen: Oscillatoria princeps oder Königs-Schwingalge. Kommt nur im Süßwasser vor. Das allerdings leider weltweit und ohne besondere Ansprüche. Den Ort, an dem die Frau ertrunken ist, mit ihrer Hilfe einzugrenzen, wird also nicht möglich sein, so leid mir das tut.«
»Wäre auch zu schön gewesen. Ist trotzdem ein wesentlicher Anhaltspunkt, der uns bei den Ermittlungen weiterhelfen kann«. Inge Westerhus klang zuversichtlich.
»Wie lange war sie im Süßwasser, bevor sie ins Meer gelangte?«
»Es gibt leider keine mir bekannte Methode, das festzustellen. Sicher ist nur: Sie ist in Süßwasser ertrunken und wurde im Salzwasser gefunden. Die Liegezeit im Wasser beträgt schätzungsweise zehn Tage. Wie sich diese Zeit genau in Süß- und Salzwasser aufteilt, kann ich Ihnen nicht sagen.«
Herrmann zuckte bedauernd mit den Schultern, legte die Ampulle zurück in den Beweismittelkarton und fuhr dann fort.
»Aber sie ist nicht erst gestern oder vorgestern im Salzwasser gelandet. Die Fressspuren und der Befall der Salzwasserorganismen sagt mir das. Es ist sogar denkbar, dass sie unmittelbar nach ihrem Tod ins Meer geworfen wurde. Sie könnte also beispielsweise in einem Eimer mit Bach- oder Brunnenwasser ertränkt und unmittelbar danach ins Salzwasser verfrachtet worden sein. Oder eben erst vor, sagen wir, fünf oder sechs Tagen, also doch einige Zeit nach ihrem Tod. Dazwischen ist alles möglich.«
»Das bedeutet, sie könnte irgendwo im Hinterland ertrunken und durch die Entwässerungskanäle ins Meer gespült worden sein.« Alice Peters sah ihre Freundin skeptisch an.
»Auch das wird euch nicht wirklich voranbringen, oder?«
Westerhus war ebenfalls nicht besonders zuversichtlich.
»Nicht durch die Kanäle. Die Fließgeschwindigkeit ist in der Regel zu langsam, außerdem wäre sie spätestens an einem der Rechen an den Sielwerken hängen geblieben. Das muss etwas anderes gewesen sein, ein größerer Bach oder Fluss. Aber selbst Bongsieler Kanal, Arlau oder Rhynschloot enden entweder in Speicherbecken oder haben zumindest eine Schleuse. Auch die Eider hat ein Sperrwerk. Dass sie da unbemerkt durchtreibt, halte ich für nicht wahrscheinlich.«
»Dann also von noch weiter her. Die Elbe käme infrage, das würde auch die lange Liegezeit im Wasser erklären. Schließlich hat sie eine erhebliche Strecke zurücklegen müssen.«
Westerhus nickte.
»Möglich. Wir müssen das auf jeden Fall bei unseren Ermittlungen berücksichtigen. OK, was haben wir noch?«
»Ich habe Gewebeproben zur DNA-Analyse gegeben, falls Sie zu einigen Vermissten schon Vergleichsmaterial haben. Die pharmakologischen Befunde stehen natürlich noch aus. Aber ansonsten wäre es das von meiner Seite.«
»Ich danke Ihnen. Schicken Sie mir alles rüber, wenn es da ist?«
»Klaus, das machst du dann, sowie die Daten vorlegen.«
Ohne sich umzudrehen hatte Herrmann die Worte an seinen Obduktionsassistenten gerichtet, der immer noch einige Meter entfernt an die Tische gelehnt stand und alles interessiert mitverfolgt hatte.
Westerhus hob ihre Tasche auf und nickte Alice Peters zu.
»Wenn Ihr euch noch professionell austauschen wollt…, ich jedenfalls trete die Heimreise an.«
Sie hob die Hand und verließ mit einem unguten Gefühl in der Magengegend und einem nachdenklichen Runzeln auf der Stirn den Obduktionsraum.
Inge Westerhus stand in freudiger Erwartung an ihrem Bürofenster und trommelte ein wenig ungeduldig mit den Fingern auf die Fensterbank. Ihre Kollegen hatte sie allesamt an die Recherche der nationalen und internationalen Vermisstendatenbanken gesetzt, wo sie akribisch nach Treffern suchten und bei Verdacht zum Telefonhörer griffen, um weitere Details zu den einzelnen Fällen zu erfragen. Sie selbst hatte kurz zuvor mit Sarah Hansen telefoniert und ihr beschrieben, wie sie von der B200 am einfachsten zur Polizeidirektion in der Poggenburgstraße kam. Bei dem Telefonat war die junge Kollegin kurz vor Viöl gewesen, und die zwanzig Minuten, die man normalerweise von dort brauchte, waren seit dem Gespräch bereits vergangen. Just als sie noch einmal auf die Armbanduhr an ihrem Handgelenk sehen wollte, sah sie ein kleines rotes Cabrio auf der Straße eine Spur zu schnell herankommen. Sie hörte, wie der Fahrer in den zweiten Gang schaltete und gekonnt in einen freien Parkplatz vor dem roten Backsteinbau einbog. Der Flitzer hatte Flensburger Kennzeichen, und irgendwie passte das Auto und der Fahrstil in Westerhus` Vorstellung zu ihrer Kollegin. Tatsächlich entstieg dem Wagen, unmittelbar nachdem das Motorengeräusch erstarb, eine schlanke Frau mit langen blonden Haaren, schüttelte den Kopf einige Male und band sich die Mähne dann mit einem Gummi zum Pferdeschwanz. So hatte sie Sarah Hansen noch in Erinnerung: keck und voller Energie. Westerhus verließ das Büro, um ihre Besucherin beim Pförtner in Empfang zu nehmen.
»Wir haben möglicherweise einen Treffer bei der Vermisstensuche.« Feit Müller hatte schwungvoll die Halbglastüre zwischen den Büros aufgerissen und blökte die Neuigkeit lautstark in Richtung seiner Chefin und Sarah. Obwohl die ziemlich respektlose Unterbrechung ihres Profilings mit Sarah Inge Westerhus verärgerte, hob sie erwartungsvoll und ohne strafende Miene den Blick. Auch Sarah sah den Kollegen gespannt an. Sie klickte ihren Kugelschreiber zu und legte die Hände vor sich auf die Tischplatte, während Feit Müller, ehe er zum Wesentlichen kam, noch einmal von seinem Schokoriegel abbiss und, da er in Sarahs Gegenwart offensichtlich vermied, mit vollem Mund zu sprechen, erst hastig kaute und den Bissen herunterschluckte. »Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um Andrea Keller aus Merseburg bei Halle«, verkündete Feit Müller und setzte sich zielstrebig in Richtung Schreibtisch in Bewegung. Dort rollten Inge Westerhus und Sarah reflexartig auf ihren Stühlen beiseite, um dem schwergewichtigen Kollegen Platz vor dem Rechner einzuräumen. Müller warf den unverpackten Rest seines Snacks achtlos auf die Schreibtischplatte und griff nach der Funkmaus. Jetzt konnte Sarah einen leicht sauren Blick auf Westerhus` Gesicht erkennen, in dem die Überzeugung zum Ausdruck kam, dass sowohl ihr Zeigegerät als auch die Tastatur wahrscheinlich ohne schmelzende Schokoladenbrösel ihren Dienst in Zukunft weitaus zuverlässiger würden verrichten können. Ihre Kollegin beließ es aber bei dem Blick, zuckte kurz mit den Schultern und ließ Feit Müller gewähren. Nach wenigen Sekunden hatte er die Akte aus der Vermisstendatenbank auf dem Schirm.
»Das ist sie: Andrea Keller, 24 Jahre. Studierte Orientwissenschaften an der Universität Leipzig.«
Sarah und Inge Westerhus betrachteten das Foto. Ein Schnappschuss, der eine auffallend zierliche junge Frau zeigte, fröhlich lachend, mit einer Eiswaffel in der Hand, eine kesse Bob-Frisur und sommerlich gekleidet. Irgendwo im Grünen hatte sie mit einem vertrauten Menschen viel Spaß, war ausgelassen und hatte unbeschwert mit der Kamera oder der Person dahinter geflirtet, den Schalk in den dunklen Augen. Das Bild einer dynamischen, vor Lebensfreude sprühenden Person, unbeschwert, glücklich, das ganze Leben noch vor sich.
Bedrücktes Schweigen machte sich an dem Schreibtisch breit, auch wenn Sarah und Feit Müller nicht wie Inge Westerhus sofort die Bilder aus dem Leichenschauhaus vor dem inneren Auge hatten. Wie war es möglich, dass der grausam geschundene, teils verweste, mit Wunden übersäte, von Fressspuren gezeichnete, blasse, kalte Leichnam aus den Kellerräumen einst dieses lustige, voller Energie steckende Mädchen war? So schrecklich, so unvorstellbar war der Gedanke an das Martyrium, das die junge Frau durchleiden musste, bis sie, in unendlicher Angst und immer wieder aufkeimender Hoffnung, erkannt haben musste, dass sie nie wieder lachen, nie wieder die Menschen sehen würde, die ihr viel bedeuteten, die sie liebte. Bis sich in den unerträglichen Schmerzen und der beklemmenden Einsamkeit die Erkenntnis schlagartig oder schleichend manifestierte; die Erkenntnis, dass ihr Peiniger ihren Tod beschlossen hatte und es keinen Ausweg aus ihrer Situation gab. Dass es nichts und niemanden auf der Welt gab, der sie jetzt noch retten konnte.
Feit Müller war einen Schritt zurückgetreten, so dass sich Sarahs und Westerhus` Blicke wieder trafen. Während die erfahrene Polizistin in den Augen ihrer jüngeren Kollegin nur Trauer, Entsetzen und Abscheu lesen konnte, nahm Sarah bei ihrem Gegenüber noch etwas anderes wahr. Auch Westerhus war aufgewühlt, voller Mitgefühl und Fassungslosigkeit. Doch ihre Augen verrieten auch Wut und eine Entschlossenheit, die wie in Stein gemeißelt, unverrückbar und kompromisslos ihr Innerstes beseelt hatte: Die Entschlossenheit, denjenigen, der für diese Tat verantwortlich war, zur Rechenschaft zu ziehen und niemals in ihrem Vorhaben aufzugeben. Feit Müller bewegte sich wieder einen Schritt nach vorne und griff - Gott sei Dank, schoss es durch Sarahs Kopf - nicht zu dem Schokoriegel sondern zu der Funkmaus, um ein wenig in der Akte nach unten zu scrollen.
»Deswegen sind wir uns bei der Identifizierung relativ sicher«, sagte er und vergrößerte den Ausschnitt eines zweiten Fotos. Darauf war Andrea Keller beim Federballspiel zu sehen. Gut zu erkennen war die Innenseite ihres hoch zum Schlag erhobenen rechten Oberarms. Je tiefer Feit Müller in das Bild hineinzoomte, desto besser konnte man eine Zeile arabischer Schriftzeichen erkennen, die längs in die Haut des Armes tätowiert war.
»Soviel zu Herrmanns Vermutung das Tribal-Muster betreffend. Dass die junge Frau Orientwissenschaften studierte, konnte ja keiner ahnen.« Feit Müller angelte sich, bevor er wieder in den Hintergrund trat, nun doch noch sein Snickers und steckte sich den Rest in einem Stück in den Mund.
»Aber Größe und Lage des Tattoos, Körpermaße der Frau, Alter, Haarfarbe, Statur, alles passt zusammen. Um sicherzugehen, müssen wir natürlich Andrea Kellers Eltern kontaktieren und sie um Zahnarztbefunde oder für das DNA Labor verwertbare Dinge ihrer Tochter bitten.«
Sarah war sich nicht sicher, was wohl für die Eltern die schlimmere Nachricht bedeuten würde: Erleichterung, dass es sich bei der Toten nicht um ihre Tochter handelte und weiter Hoffnung haben, oder die Sicherheit, dass Andrea nicht wieder nach Hause kommen würde, und trotzdem – wegen des grausigen Anblicks - kein wirklicher Abschied von der geliebten Tochter möglich sein würde. Sie mochte sich in die Gefühlsachterbahn der Eltern gar nicht erst hineinversetzen.
»Wie lange wird sie denn schon vermisst?«, nahm Inge Westerhus Sarahs nächste Frage vorweg und scrollte zum Datenteil der Akte.
»Seit vorgestern?«, entfuhr es Sarah ungläubig, als sie das Datum sah. »Das kann ja wohl nicht sein! Unser Opfer ist doch sicher seit etwa vierzehn Tagen tot und befand sich vorher längere Zeit in der Gewalt des Täters! Sie ist es nicht!«
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, ergriff Feit Müller das Wort.
»Es gibt viele Gründe, warum Eltern ihr erwachsenes Kind erst deutlich später vermisst melden. Eine gestörte Beziehung, eine längere Reise, ein hoher Grad an Selbständigkeit. Es kommt jede Menge in Frage. Wir müssen auf jeden Fall mit ihnen sprechen.«
Inge Westerhus nickte bestätigend.
»Frau Hansen, wollen Sie das Telefonat führen? Sie sind doch sehr einfühlsam, oder?«
Sarah schluckte kurz, aber signalisierte Inge Westerhus mit zusammengepressten Lippen und der Andeutung eines Nickens ihr Einverständnis.
»Natürlich, das mache ich«, fügte sie leise hinzu.
»OK, dann beeilen wir uns, die Identifizierung zu bestätigen. Sicher ergeben sich bei der Befragung der Eltern und des Umfeldes, so es sich denn um Andrea Keller handelt, weitere Ansatzpunkte für unsere Ermittlungen.«
Inge Westerhus klickte auf Datei drucken, wählte den Farblaser im Geräteraum und erhöhte die Anzahl der Exemplare auf „3“. Dann schloss sie die Vermisstenakte und wandte sich an Feit Müller.
»Feit, du und Bernd, ihr schaut nach ungeklärten oder auch geklärten Todesfällen, die in irgendeiner Art unserem ähnlich sind. Also Frauen, die verschwunden sind und denen Augen und Mund zugenäht wurden. Bitte schaut bundesweit, und setzt euch auch mit den Kollegen in Dänemark und den Niederlanden in Verbindung. Frau Hansen, noch eine Idee hierzu?«
Sarah nickte beflissentlich.
»Ja, die habe ich. Ich würde zuerst nach anderen Merkmalen suchen. Und zwar nach Alter, Geschlecht, Statur, Haarfarbe et cetera. Achten Sie auch auf Details wie die Art der Fesselung, möglicherweise auch darauf, dass die Opfer längere Zeit verschwunden waren, bevor der Tod eintrat.«
Feit Müller stutzte.
»Sie finden das mit dem Zunähen von Mund und Augen nicht als markant genug?«
Sarah nickte bekräftigend.
»Doch, aber genau das ist der Punkt. Hätten Sie nicht von solchen Fällen gehört, wenn schon Opfer mit solch grausamen Verletzungen gefunden worden wären? Die Sache ist nämlich die, dass, wenn es sich tatsächlich um einen Serientäter handelt, der schon über die Phase des Fantasierens hinaus ist, sprich getötet hat, dann folgt er bestimmten Grundmustern…«
»Wie die verfluchte Sch… mit dem Zunähen«, unterbrach Müller, doch Inge Westerhus hatte verstanden.
»Sie meinen, dass das Grundschema zunächst die Art des Opfers ist, das er auswählt und jene Verstümmelungen erst später hinzukamen? Er sich sozusagen weiterentwickelt hat?«
»So ist es«, bestätigte Sarah. »Möglicherweise ist Andrea Keller nicht sein erstes Opfer, aber das erste, dem er…«, sie rang sichtlich um die richtigen Worte, «… die vorliegenden Abscheulichkeiten zugefügt hat. Serientäter durchlaufen häufig eine Art Entwicklung, wie Sie richtig sagen. Diese kann ganz unterschiedlich ausfallen. Von manchen Tätern weiß man, dass sie zum Beispiel die Art, das Opfer zu töten, akribisch perfektioniert haben. Die Maßstäbe, die für sie eine Verbesserung bedeuten, mögen in unseren Augen krank und nicht nachvollziehbar sein. Für den Täter folgen sie aber durchaus einer gewissen Logik.«
»Und wie habe ich mir so eine Entwicklung in unserem Fall vorzustellen?«, fragte Feit Müller nach.
»Die psychiatrische Forensik beschreibt bei Serientätern ein Grundschema, das eigentlich immer gleich ist. Das bezieht sich natürlich auf pathologisch kranke Menschen, die einem Zwang folgen, ein Trauma verarbeiten oder Ähnliches. Auftragskiller zum Beispiel, die aus monetärem Kalkül heraus mehrere Menschen töten, haben natürlich eine komplett andere Motivation und spielen bei unserer Betrachtung keine Rolle. Das Gleiche gilt auch für Massenmord im militärischen Zusammenhang, wie Töten auf Befehl oder Vergeltung am Gegner oder der Zivilbevölkerung. Diese und auch der Amoklauf fallen nicht unter den Begriff des Serienmörders.«
Inge Westerhus hörte Sarah voller Anerkennung zu. Die Art, wie sie Feit Müller die Fakten vortrug, war beeindruckend. Auch der Kollege folgte gespannt Sarahs Ausführungen.
»Man unterscheidet zwischen unterschiedlich motivierten Serienmördern. In unserem Fall können wir davon ausgehen, dass wir es mit einer traumatisch ausgelösten Störung zu tun haben. Wobei auch ein sexuell motivierter Täter in Frage käme, selbst wenn die Rechtsmedizin keinen Hinweis darauf gefunden hat.«
»Sexuell motiviert muss schließlich nichts mit unseren normalen Vorstellungen von Sexualität zu tun haben«, ergänzte Inge Westerhus. »Er könnte bei jeder seiner Handlungen sexuell erregt werden, sei es durch das bloße Fesseln oder durch das Riechen an irgendwelchen Körperteilen seiner Opfer. Vielleicht zieht er auch Befriedigung aus dem Zunähen des Mundes und der Augen. Was für ihn sexuell stimulierend ist und ihn auch zu einem Orgasmus bringen kann, geschieht ohne die klassischen Anzeichen einer Vergewaltigung oder eines Geschlechtsaktes.«
»Es kann auch«, griff Sarah den Faden wieder auf, »eine Kombination aus traumabedingter und sexueller Motivation sein. In der Regel beginnt die Geschichte eines solch gestörten Charakters mit einem Vorfall in der frühen Kindheit oder Jugend. Das kann ein einmaliges traumatisches Erlebnis sein, oder auch ein über längeren Zeitraum erlebter Umstand. Zeuge eines Gewaltverbrechens oder systematischer Missbrauch sind Beispiele. Natürlich spielen Umfeld, genetische Disposition, die Chance, das Erlebte aufzuarbeiten, ganz tragende Rollen, denn schließlich wird nicht jedes Missbrauchsopfer zum Serienkiller. Es bedarf immer vieler und auch subjektiver Faktoren, um ein solches Verhalten hervorzubringen.«
»Und das geschieht dann plötzlich? Oder wie?« Feit Müllers Interesse war geweckt.
»In der Regel geht den Taten eine lange Phase voraus, in der zunächst fantasiert wird. Dann kann es ein Zufall sein, die Begegnung mit einer Person, ein Erlebnis, eine Szene in einem Kinofilm, das den Auslöser für den nächsten Schritt darstellt: Eine Phase, in der sich der Täter in der Realität an seine Fantasien annähert. Das ist in der Regel visuell und kann mit Voyeurismus umschrieben werden. Aber Vorsicht: Das bedeutet nicht, dass jeder Voyeur ein verkappter Serientäter in seiner visuellen Phase ist!«
»Klar, sonst würde ich mir bei einigen meiner Kumpels ernsthaft Sorgen machen.«
Dass dies kein Witz sein sollte, sondern eine ernst gemeinte Feststellung des Polizisten, war allein wegen seines Tonfalles eindeutig.
»Irgendwann reicht dann das visuelle Erlebnis nicht mehr aus, die Bedürfnisse zu befriedigen. Und bei manchen kommt es tatsächlich zur Tat. Nicht bei allen. Manche schaffen es, sich ein Leben lang zu beherrschen, andere nehmen sich das Leben. Nur ein verschwindend geringer Promillesatz der Personen mit entsprechender Disposition wird zum Serientäter.«
Sarah sah sich nach ihrem Wasserglas um, da es aber leer war, räusperte sie sich nur und fuhr dann fort.
»In signifikant häufigen Fällen ist es auch so, dass der Täter die Art seiner Handlungen nach einer langen Pause modifiziert, zum Beispiel durch so etwas, wie in unserem Fall, die zugenähten Körperöffnungen. Entweder er hat das in den passiven Phasen seinen Fantasien hinzugefügt, oder aber es war schon immer Bestandteil seiner Fantasien, kam aber nicht zur Ausführung. Es ist also nichts, das ausprobiert und möglicherweise wieder verworfen wird. Er hat sein Gefühl, seine Befriedigung, schlicht seinen Benefit in den Träumen vorweggenommen und Gefallen daran. Eine solche Modifikation des MO wird er nicht wieder aufgeben.«
»Und wegen seiner Entwicklung und der damit verbundenen Änderung bestimmter Tatmuster ist es wichtig, uns zunächst auf die wesentlichen Umstände zu konzentrieren«, konkludierte Feit Müller.
»Und das sind Alter, Geschlecht, Aussehen, Statur, Haarfarbe, Kleidungsstil, möglicherweise auch Hobbys, ein Instrument zum Beispiel, oder eine bestimmte Sportart. All das sind die Merkmale, über die er seine Opfer möglicherweise auswählt. Vielleicht war sein erstes Opfer im selben Musik- oder Turnverein, und deswegen sucht er sich seine weiteren Opfer in eben jenem Umfeld. Die Handlungen sind eher nachgeschaltet und können sich, wie gesagt, entwickeln.« Sarah war sich sicher, dass der Kollege die Zusammenhänge verstanden hatte.
»Sehr gut, was noch?«, wollte Westerhus wissen.
»Gehen Sie bei den Recherchen ruhig einige Jahre in die Vergangenheit. Oftmals ist es so, dass, wenn die Grenze zum aktiven Handeln, also der Übergang zum Töten, zum ersten Mal überschritten ist, die daraus gezogene Befriedigung sehr lange anhält. Bis zur nächsten Tat können Monate, ja sogar Jahre vergehen. Irgendwann werden die Intervalle allerdings kürzer, weil das Glücksgefühl nicht mehr so lange andauert.«
Feit Müller und auch Inge Westerhus gaben ihrer Abscheu mit eindeutiger Gestik Luft.
Die Polizistin nickte.
»Mit der Modifikation seiner Handlungen steigt meist auch die Frequenz der Taten. MO steht übrigens für Modus Operandi, also quasi Vorgehensweise«, erläuterte sie an Feit Müller gewandt, denn sie hatte dessen Stirnrunzeln bemerkt, als Sarah die Abkürzung verwendet hatte.
»Heißt das, dass wir in Kürze mit einer weiteren Leiche zu rechnen haben?«, wollte er wissen.
Sarah verneinte.
»Das wollen wir doch nicht hoffen! Erhöhung der Frequenz muss nicht bedeuten, dass er jetzt jede Woche zuschlägt. Es kann auch bedeuten, von alle fünf Jahre auf alle zwei Jahre. Es muss auch nicht notwendigerweise jetzt dazu kommen. Nur drei Dinge sind sicher: Erstens, er wird wieder töten. Zweitens: irgendwann wird er anfangen, in geringeren Abständen zu töten. Und drittens: sollte es ein nächstes Opfer geben, werden auch ihr Mund und Augen zugenäht werden. Davon lässt er nicht mehr ab.«
Die nun entstandene Stille beendete Inge Westerhus mit klarem Pragmatismus.
»OK, Feit, dann weißt du, wie ihr nachher vorzugehen habt.«
Sie sah auf die Uhr und meinte:
»Zeit für die Mittagspause. Trotz allem ein wenig Appetit?«
Er hatte riesiges Glück, sie unter den vielen anderen Menschen überhaupt bemerkt zu haben. Sie war viel früher als sonst aufgetaucht, so viel früher, dass er noch nicht einmal darüber nachgedacht hatte, nach ihr Ausschau zu halten. Der einzige Grund für seine Anwesenheit war das bescheidene Angebot an Möglichkeiten, seinen Transporter legal und unverfänglich abzustellen und trotzdem eine gute Sicht auf die Haltebuchten der Busse zu haben. Eigentlich hatte er vorgehabt, sich noch einige Zeit zurückzulehnen und mit geschlossenen Augen seinen Gedanken nachzuhängen. Doch auf einmal war sie aufgetaucht, das Mobiltelefon am Ohr, lachend und mit dem beschwingten, kecken Gang. Sie trug heute ein türkisfarbenes T-Shirt, auf dem ein stilisierter Affe mit ziemlich breitem Mund abgebildet war. Die Blue Jeans endete wieder zwei Handbreit über den Knöcheln, und an den Füßen trug sie heute bunte Turnschuhe. An dem schwarz-roten Rucksack hing eine gelbe Windjacke, und um den Hals hatte sie ein luftiges, buntes Tuch, das mit den Schuhen sehr gut harmonierte. Wieder bestach sie durch ihre unbeschwerte Art, sich zu bewegen, zu lächeln, den langen Pony aus dem Gesicht zu streichen. Eine innerliche Wärme erfüllte ihn, als er ihr neugierig, ja, fast sehnsüchtig mit seinen Blicken folgte. Der Bus der Linie drei kam, doch sie stieg nicht ein. Wartete sie noch auf jemanden, oder würde sie eine andere Linie nehmen? Nach wenigen Minuten stieg sie in den Bus Richtung Sankt Peter-Ording, und so hatte er Gewissheit: Er würde heute dabei sein, wenn sie etwas für ihn Neues tat. Ohne Hast lenkte er den VW in den Verkehr. Da er die Strecke, die der Bus befuhr, gut kannte, verfolgte er ihn nicht, sondern beschränkte sich darauf, an den Haltestellen genau zu überprüfen, ob sie ausgestiegen war oder nicht. Erst, als sich der Bus dem Bahnhof in Sankt Peter-Ording näherte, schloss er dichter auf, da es dort zu viele Möglichkeiten gab, sie nach der Ankunft aus den Augen zu verlieren. Dass er richtig daran getan hatte, zeigte sich unmittelbar, denn sie sprintete nach Verlassen des Busses sofort los und stieg in den wartenden Ortsbus. Wenn er die wenigen Sekunden, die sie sichtbar gewesen war, verpasst hätte, wäre die Spur für heute verloren gewesen. Doch so konnte er ihr weiter folgen und beobachten, wie sie an den Dünenthermen ausstieg und zu Fuß weiter in Richtung Meer ging. Also überholte er sie beherzt, bog links auf den Parkplatz gegenüber des Strandhotels, stellte den Transporter ab und beeilte sich, wieder zur Straße zu gelangen. Als er sie wieder ausgemacht hatte, blieb er auf der gegenüberliegenden Straßenseite immer auf ihrer Höhe und verfolgte sie so bis zum Deichkind. Zielstrebig steuerte sie die Restaurant-Bar an. Durch die großen Glasscheiben konnte er erkennen, wie sie sich suchend umsah und dann mit einem Strahlen auf dem Gesicht zu einem der Tische mit Blick auf das Meer und den Übergang zur Arche Noah trat. Die dort sitzende junge Frau stand auf, sie begrüßten sich mit Küsschen rechts und links und setzten sich beide an den Tisch.
Er überlegte. Es war kein Problem, hier inmitten der Touristenscharen irgendwo unauffällig Posten zu beziehen und sie weiter zu beobachten. Aber auch er hatte Hunger. Wann hatte er das letzte Mal gegessen? Gestern Morgen? Vorgestern Abend? Auf alle Fälle spürte er seinen Magen sehr deutlich und entschied, dass es besser wäre, etwas zu sich zu nehmen. Ins Deichkind wollte er nicht. Auch wenn er es prinzipiell bevorzugte im Sitzen zu essen, entschied er sich, bei Gosch ein Krabbenbrötchen auf die Hand zu nehmen. Schließlich setzte er sich auf einen der Steinblöcke, die einen künstlichen Wasserlauf überbrückten und behielt die Ausgänge des Deichkind und des Hotel Strandgut im Blick.
»Möchten Sie ein kleines Schnäpschen, einen Aquavit oder einen Bommerlunder vielleicht?«
Peter Westerhus war aufgestanden und blickte Sarah fragend und aufmunternd zugleich an.
»So als Zwischengang vor dem Nachtisch?»
Sarah sah erst ihn an und dann in die Runde.
»Aber nur, wenn ich nicht die Einzige bin…«, antwortete sie etwas zögerlich und versuchte Inge Westerhus ein klares Statement zu entlocken. Es war Isolde Westerhus indes, die die Entscheidung für alle traf.
»Schätzchen, damit sind Sie, wenn ich dabei bin, nie alleine«, rief sie lautstark und nickte ihrem Sohn bekräftigend zu. Entgegen Westerhus` Hoffnung, ihre Schwiegermutter würde sich wie sonst relativ zurückhaltend gebärden und vielleicht sogar verfrüht die Abendtafel verlassen, hatte sie mit Elan an den Diskussionen teilgenommen, Sarah Hansen mehrfach unter lautem Lachen in die Seite geknufft und schien den Abend in Anwesenheit der jungen Polizistin richtiggehend zu genießen. Gut, die Gespräche über den Fall hatten sie wegen Marie-Claire und Lars ausgeklammert, derart Furchtbares wollte sie nicht vor ihren Kindern ausbreiten. Aber so offen und fast exaltiert hatte Inge sie noch nie erlebt. Wahrscheinlich hatte Isolde an Sarah einen Narren gefressen. Und da schien sie nicht die einzige zu sein, denn auch Marie-Claire, die normalerweise unter einem fadenscheinigen Vorwand aufstand, um mit Freundinnen zu chatten oder zu telefonieren, saß immer noch am Tisch. Sie hatte förmlich an den Lippen der Besucherin geklebt und von Sarah ausführlich erfahren wollen, wie sie zu ihrer Berufswahl gefunden hatte. Auch stellte sie ihr interessiert Fragen über die Ausbildung bei der Polizei, und Inge Westerhus machte sich Gedanken, warum ihre Tochter all dies nicht bereits sie gefragt hatte. Ohne jeden Anflug von Eifersucht stellte sie nach kurzem Rechenspiel fest, dass ichre junge Kollegin vom Alter her ihrer Tochter erheblich näher war als sie selbst. Wahrscheinlich vermittelte Sarah Hansen einfach ein junges, frisches Bild einer Kriminalbeamtin, ganz anders als sie das in ihrem Alter und in ihrer Rolle als Mutter je gekonnt hätte. Und, auch das machte sie sich ohne Bitterkeit klar, war es in einer Mutter-Tochter-Beziehung eben so, dass gewisse Dinge besser außerhalb der Familie besprochen oder geklärt wurden. Noch während Inge Westerhus anfing, die Teller zusammenzustellen – selbst ihre Schwiegermutter legte das Besteck ordentlich zusammen und reichte ihr Geschirr bereitwillig weiter – erbot sich Marie-Claire sogar einen Nachtisch zuzubereiten:
»Mögen Sie Vanilleeis mit heißen Kirschen? Ich könnte das ganz schnell in der Küche machen», sprudelte es aus ihr heraus, und während Inge Westerhus mit hochgezogenen Brauen ein erstaunt anerkennendes Gesicht aufsetzte, lächelte Sarah der 16-Jährigen zu:
»Sehr gerne, das ist lieb von dir.«
Derweil kam Peter Westerhus mit einem ganzen Arm von Schnapsflaschen aus dem Wohnzimmer zurück, stellte eine Flasche Averna an den Platz seiner Mutter und baute den Rest in Sarahs Reichweite auf.
»Bedienen Sie sich einfach selbst«, forderte er sie auf. »Wenn ich einmal am Einschenken bin, höre ich so schnell nicht auf.»
Ein verschmitztes Lächeln lud Sarah dazu ein, sich ein Glas zu nehmen und unter den verschiedenen Bränden etwas nach ihrem Geschmack auszuwählen.