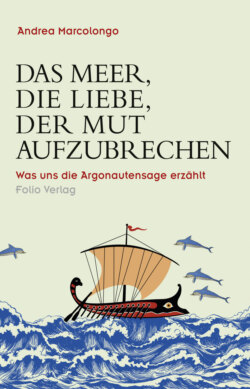Читать книгу Das Meer, die Liebe, der Mut aufzubrechen - Andrea Marcolongo - Страница 12
Sich über Wasser halten
ОглавлениеKurz und gut, die Erfahrung und die Gesetze der Physik lehren, dass die Menschen für gewöhnlich mehr Zeit haben, sich bei einem Schiffbruch zu retten, als sie glauben.
Verlassen Sie Ihr Schiff erst, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt.
Vertrauen Sie dem Auftrieb, er erklärt, warum Dinge sich über Wasser halten.
Wie schön war doch die Argo auf ihrer ersten Fahrt, sobald sie mit vollen Segeln aus dem Hafen der Stadt Iolkos ausgelaufen war.
Und die Fische, die von unten aus der tiefen Salzflut heraufkamen, unendlich große, vermischt mit kleinen, folgten, durcheinander springend, den feuchten Pfaden. Und wie ivenn den Spuren eines ländlichen Aufsehers zehntausend Schafe zum Gehöft folgen, die sich genugsam am Gras satt gefressen haben, der aber geht voran und spielt mit der helltönenden Syrinx schön eine Hirtenweise: so begleiteten nun die Fische sie. Und das Schiff trug immer eine Brise nach der anderen.
Am frühen Morgen sahen die Argonauten den Berg Athos vor sich, der seinen majestätischen Schatten auf alle Inseln rundherum warf.
Den ganzen Tag lang wurden sie von günstigen Strömungen getragen, und als am Abend der Wind verebbte, landeten sie auf der Insel Lemnos, im nördlichen Teil der Ägäis, auf dem Weg zu ihrem Ziel, dem Bosporus.
Wie lebt man ohne Liebe?
Wie auf der steinigen und gefühllosen Insel Lemnos.
Seit geraumer Zeit konnte sich auf der Insel niemand mehr verlieben – wollte sich niemand mehr verlieben, weil die wirkliche Liebe zu anstrengend ist.
Aphrodite war zornig auf die Einwohner, weil sie zu sehr mit ihren alltäglichen Geschäften beschäftigt waren, sie vergessen hatten, es ihr gegenüber an Respekt mangeln ließen und ihr die Ehrengaben vorenthielten.
Auf der Insel herrschte nur noch Alltagstrott. Man arbeitete und erledigte die notwendigen Dinge, bevor man am Abend müde zu Bett ging: Auf Lemnos verlief die Zeit ohne Überraschungen und ohne Unbekanntes, Gefühle waren verbannt.
Ein schreckliches – erbarmungsloses – Unglück war über die Insel hereingebrochen. Die Männer waren ihrer Frauen überdrüssig geworden und liebten ihre Töchter nicht mehr, sondern hegten ein heftiges und irrationales Verlangen nach den jungen Frauen, die sie von den Küsten gegenüber der Insel raubten.
Da beschlossen die bejammernswerten und in ihrer Eifersucht schlimm unersättlichen Frauen von Lemnos, das ganze männliche Geschlecht auszurotten, damit sie von ihren Söhnen, Vätern, Ehemännern nicht länger gedemütigt und vernachlässigt werden konnten.
Sie brauchten sie nicht, um zu überleben, sie dachten: Wir können auch selbst Rinder und Schafe hüten, Felder pflügen und sogar Waffen tragen.
Anstatt die verlorene Liebe zurückzuerobern, beschlossen die Frauen, auf immer darauf zu verzichten; mit eigenen Händen brachten sie die um, die sie geliebt hatten oder hätten lieben können.
Sie glaubten, ohne Liebe in Sicherheit zu sein, doch mit jedem Tag wurde ihre Unsicherheit größer – das geschieht, wenn man Gefahren unter den Teppich kehrt, statt sich ihnen zu stellen.
Die Frauen von Lemnos fristeten einsam ihr Leben und vor allem hatten sie Angst, dass jemand ihr Verbrechen entdecken könnte.
Als sich die Argo der Insel näherte, strömten die Frauen bewaffnet ans Ufer, um herauszufinden, wer die Fremden waren, die auf ihrer Insel an Land gingen, und welche Absichten sie hatten – jeder Mann auf Erden erinnerte sie an die begangene Straftat und war gleichzeitig ein Versprechen, sich vor einem Leben in Einsamkeit und Entbehrung zu retten.
Und in Ratlosigkeit strömten sie dahin, sprachlos; eine derartige Furcht schwebte über ihnen.
Ahnungslos entsandten die Argonauten einen Boten, der den Frauen mitteilen sollte, dass sie nur eine Nacht in Lemnos bleiben und dann wieder abfahren wollten.
Doch am Morgen darauf konnten die Helden nicht auslaufen, weil der Boreas blies.
Die Frauen hatten sich derweil, unter der Führung ihrer Königin, der schönen, aber mittlerweile verhärteten Hypsipyle, in der Stadt versammelt, um zu entscheiden, was zu tun sei.
Sie setzte sich auf den steinernen Thron ihres Vaters, des alten Thoas, des einzigen Mannes, der der Katastrophe entgangen war. Hypsipyle hatte ihn in eine Holzkiste gesetzt und der Flut anvertraut; Fischer hatten ihn gerettet.
Nicht aus schlechtem Gewissen hatte das Mädchen dem Vater geholfen, sondern weil die Liebe trotz allem noch in ihr lebendig war, wenn auch unterdrückt, verleugnet, verachtet. Die Liebe lebt immer in uns, auch wenn wir ihre Stimme nicht hören wollen – und je mehr wir sagen nie wieder, desto lauter wird ihr Ruf.
Nervös und ängstlich schlug die Königin den Frauen vor, den Argonauten alle möglichen Gaben zu schicken; Speisen, süßen Wein, was auch immer auf dem Schiff fehlte, damit die Männer außerhalb der Mauern blieben und nicht wagten, sich ihnen zu nähern.
Wenn sie die Stadt betreten hätten, hätten sie nämlich herausgefunden, was die Frauen ihren Männern angetan hatten. Denn wir haben ein verwegenes Werk betrieben!
Aber vor allem hätten die Frauen von Lemnos dann nicht länger ignorieren können, dass das Schicksal ihnen eine Chance bot, wieder zu leben und zu lieben.
Hypsipyle schlug also vor, Glück vorzuspielen, um das reale Unglück zu verschleiern.
Sich zum Lächeln zu zwingen, während sie im Grunde aus Schmerz und über ihren Irrtum weinen wollten.
So zu tun, als ob nichts wäre, anstatt zu versuchen, alles zu ändern.
Sie sprach, und keine wagte zu antworten.
Traurig und schweigend saßen sie da, den Blick zu Boden geschlagen, die Hände im Schoß, und dachten daran, dass sie nie Kinder haben, nie die Liebe kennenlernen würden. Sie fantasierten wie kleine Kinder, denn sie waren kleine Mädchen geblieben, die sich dafür entschieden hatten, auf immer die Beständigkeit auszumerzen, die die Liebe erfordert, und in Ruhe, ohne Störung zu leben, doch ihre stillen Nächte waren von Alpträumen erfüllt und nicht von Träumen.
Plötzlich erhob sich eine Alte, hinkend und auf einen Stab gestützt.
Mitten in der Versammlung, mit gebeugtem Rücken, sprach sie zu den Frauen von Lemnos:
Wenn das aber einer der Seligen abwenden sollte, so bleiben doch hinterher zehntausend andere Leiden, größer als eine Schlacht. Wenn nun die alten Frauen dahingegangen sind und ihr jüngeren kinderlos ins verhasste Alter gekommen seid, wie werdet ihr dann leben, ihr Unglückseligen? Werden die Rinder sich von selbst ins Joch spannen und euch den die Erde zerschneidenden Pflug durch das Brachland ziehen und sogleich, wenn das Jahr sich erhebt, die Ernte abmähen? […] Die Rüstigeren aber fordere ich auf, das im Ganzen zu bedenken; denn jetzt liegt doch Abwehr bereit zu euren Füßen.
Befreiender Applaus brach aus, denn den Frauen gefiel die Rede: Endlich wagte es eine, die Schwächste von ihnen, zuzugeben, wie sie in Einsamkeit und Unabhängigkeit lebten.
Die Frauen von Lemnos waren allein, aber vor allem unglücklich.
Glück oder Unglück sind fast nie eine Gegebenheit, ein Preis oder ein Fluch des Lebens, ein unveränderlicher Zustand der Freude oder der Verzweiflung.
Ihr tieferer Sinn verbirgt sich vielmehr in der Veränderung: in dem, was wir, eben weil wir glücklich oder unglücklich sind, für uns oder die anderen in unserer Umgebung tun können oder nicht.
Glücklich, auf Lateinisch felix, hat denselben Wortstamm (fe-) wie fecundus: fruchtbar, produktiv, ergiebig.
Fruchtbar sind nicht nur die Weizenfelder. Wir sind fruchtbar, die wir dank des Glücks plötzlich Gesten oder Taten vollbringen, die wir uns nicht zugetraut hatten.
Glücklich zu sein bedeutet also nicht, keine Probleme oder Schwierigkeiten zu haben und in einem unerschütterlichen Zustand der Ruhe und Entspannung zu leben – oder gar des relax, wie es in Prospekten von Hotels an exotischen Stränden heißt.
Glück ist das reine Gegenteil davon: Es ist energisches Handeln, die Freude am Tun, die Lust an der Veränderung – fruchtbar zu sein, die Blumen blühen zu sehen, die wir sind.
Und Unglück ist das reine Gegenteil: die Unfähigkeit, sich in Bewegung zu setzen, unangenehme Gedanken abzuschütteln, die Unfähigkeit, auch nur einen weiteren Schritt zu tun.
Unglücklich zu sein bedeutet, nichts zu tun, nichts zu sagen, niemanden zu lieben – die Fruchtbarkeit des Lebens abzuweisen, das immer wieder ungeahnte Chancen bietet, und die Unfruchtbarkeit und Ereignislosigkeit vorzuziehen.
Das eine ist Tätigkeit, das andere Untätigkeit. Das eine ist eine Aufwärtsbewegung, das andere ein Absinken.
Sagt man nicht etwa „Freudensprünge machen“ und im Gegenteil dazu „sich hängen lassen“?
Es fällt uns schwer anzuerkennen, dass unser Glück oder unser Unglück kein Zustand, sondern ein ständiger Prozess, also Bewegung, sind.
Oft haben wir das Gefühl, dass unsere Traurigkeit ewig währt und das Glück nur ein kurzes, flüchtiges Intermezzo ist. Vor beidem haben wir Angst.
Fast immer erkennen wir den Mechanismus nur, wenn wir zurückblicken, nie, wenn wir nach vorne blicken – wenn unser Gedächtnis uns einen Zeitraffer vorgaukelt wie in einem Dokumentarfilm, in dem Samen in Sekundenschnelle zu Früchten werden, wobei die Zeit, die Jahreszeiten und all die Schmetterlinge, die dafür nötig sind, ausgespart werden.
Doch eine sternenklare Nacht oder ein grauer, wolkenverhangener Morgen sind nie ewig und kein statisches Bild des Himmels: Die Wolken haben den Zweck, Regen zu bringen, danach scheint wieder die Sonne.
Die Königin senkte das Haupt und antwortete leise:
Wenn nun doch allen dieser Wunsch gefällt, möchte ich jetzt auch einen Boten zum Schiff senden!
Und sofort brach eine Sprecherin auf, um den Seefahrern zu sagen, sie dürften als Freunde die Stadt betreten, ohne Angst. Und dass die Königin sich freue, den Anführer des Zuges zu empfangen.
Hypsipyle wusste nicht, dass der Anführer des Zuges kein Mann war.
Er war ein Junge, Jason, der sich noch nie verliebt hatte, der vielmehr die Liebe aus Angst zurückgewiesen hatte, bevor sie sich ereignen konnte.
Als die wunderschöne, unerschrockene Jägerin Atalante vorgeschlagen hatte, die Argonauten zu begleiten, hatte Jason sie aus Angst vor dem, was die Leidenschaft bei Menschen auslöst, davon abgebracht – er wollte keine Frau an Bord, er wusste nicht, was er sich von ihr erwarten sollte, er glaubte, Eros sei Krieg und nicht Bündnis.
Jetzt würden sich der Anführer der Argonauten und die Königin von Lemnos zum ersten Mal treffen.
Sie einte dieselbe Einsamkeit und dieselbe Feigheit – und das Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden.
Eines Sommermorgens unterhielt ich mich mit einem Freund, der mich schon seit langer Zeit im Handwerk der Sanftheit unterrichtet, einem Handwerk, bei dem ich noch ein Lehrling bin.
Ich erzählte ihm, ich sei unfähig zu weinen und verspüre stets Trauer und Müdigkeit. Ich fühlte mich immer so.
„Dich beschwert vieles“, hat er gesagt.
„Und wie werde ich es los?“, fragte ich umgehend.
Er hat mit einem einzigen Wort geantwortet, einem Wort mit einem wunderbaren Klang, das keinen Widerspruch duldet:
„Liebe.“
Ahnungslos machte sich Jason in die Stadt auf, einem schimmernden Stern gleich – wie der Vollmond, den Frauen und Männer in Sommernächten staunend betrachten, um sich lebendig zu fühlen.
Und nachdem sie also durch die Tore und in die Stadt getreten waren, drängten sich die Frauen des Volkes von hinten heran, voll Freude über den Fremden. Der aber ging, die Augen auf die Erde gerichtet, ohne Scheu, bis er zum prangenden Palast Hypsipyles kam.
Die Königin saß auf ihrem Thron.
Als sie ihn sah, errötete sie und ihre Wangen färbten sich in der Farbe des Granatapfels. Hypsipyle war lebendig wie eine nature morte: eine Gattung der Malerei und der Fotografie, die auf Deutsch und Englisch mit einem entgegengesetzten, wunderbaren Namen bezeichnet wird: Stillleben, still life. Wortwörtlich „regloses Leben“, nicht Tod, sondern noch Leben, denn in diesen saftigen Früchten ist noch viel Leben, sie liegen jedoch unbeweglich vor einem undefinierten Hintergrund und niemand kann in sie hineinbeißen. Ihren Geschmack kann man nur anhand des Spiels von Licht und Schatten erahnen, so wie sich die Gefühle der Frau zunächst nur durch ihr Erröten offenbarten.
Doch nun redete sie ihn mit sorgfältig gewählten Worten an.
Aus Scham zog die Königin es vor zu lügen.
Sie zog es vor, fast die Wahrheit zu sagen – unter diesem fast verstecken wir aus Verlegenheit oder aus Angst vor dem Urteil der anderen unsere Aufrichtigkeit, weshalb wir letzten Endes nicht mit leidenschaftlicher Genauigkeit, sondern mit einstudierter Beliebigkeit von uns sprechen.
Hypsipyle erzählte dem Fremden zwar von der Einsamkeit und der Traurigkeit der Frauen auf der Insel, sagte jedoch, dass die Männer ausgewandert seien, um das schneereiche Ackerland Thrakiens zu pflügen. Auch die Söhne seien ihnen in die Fremde gefolgt.
Gleich darauf bot sie Jason das Königsamt auf der Insel an, sofern er sich bereit erklärte, gemeinsam mit seinen Gefährten hierzubleiben und sie zu bewohnen: Lemnos würde ihnen gewiss gefallen, denn die Insel hat hohe Saat, mehr als andere Inseln, so viele im Ägäischen Meer bewohnt sind.
Die Königin rühmte also die Fruchtbarkeit ihres Landes, verschwieg aber die Unfruchtbarkeit eines Lebens ohne Liebe.
Tatsächlich sprach sie nicht in Worten über das Unglück Lemnos’, sondern in Form von Andeutungen, die die Worte verbergen.
Wir, die wir keine Worte mehr haben, sind heutzutage aufgerufen, uns zu dekonstruieren statt aufzubauen. Unseren Nächsten in Einzelteile zu zerlegen, um ihn besser zu verstehen – als ob er ein Puzzle oder ein Legoturm wäre – ein Turm aus Bausteinen, die die Fantasie in eine Form pressen. Nicht zufällig erinnert mich der Name immer an ein unregelmäßiges griechisches Verb λέγω (lègõ), das reden bedeutet.
Wie der Philosoph Wittgenstein sagte, sind die Grenzen unserer Sprache auch die Grenzen unserer Welt, unsere Worte schaffen sie, machen sie klein oder riesig groß, wie die bunten Landschaften, die wir als Kinder bauten.
Wir müssen uns selbst und die anderen anhand winziger, fast unbedeutender Gesten interpretieren, denn die Andeutung ist mittlerweile die einzige wirklich aufrichtige Sprache, während wir bewusst stumm bleiben.
Wir seufzen allein und glauben, niemand würde uns im Nebenzimmer hören.
Wir entschuldigen uns übermäßig, auch wenn gar nichts Schwerwiegendes vorgefallen ist – in Wirklichkeit entschuldigen wir uns für etwas, von dem der andere nichts wissen kann.
Ein Schweigen, das nicht Friede, sondern eine Kriegserklärung ist.
Eine neue Kunst macht sich breit, die Philologie der SMS, sie wird von Freunden praktiziert, die wir wie in ein Konklave rufen, damit sie die Botschaften unserer Lieben entziffern. Die Worte, die auf dem Bildschirm leuchten, bringen nie und nimmer die Gedanken des Absenders zum Ausdruck – wir vertrauen ihnen nicht, wir suchen das Gesagte im Nichtgesagten, denn das wollen wir hören.
Oft haben wir recht. Und tun gut daran, nicht zu vertrauen.
Aufgrund einer merkwürdigen Ironie vertrauen wir unsere wahren Gedanken den Postskripta an, als ob sie uns abhandengekommen wären wie ein abgerissener Knopf – denen wir dann weitere ungesagte Worte, weitere P.P.S. usw. hinzufügen.
Post Scriptum ist ein lateinischer Begriff, der hinzugefügt bedeutet, danach geschrieben, nachdem der Brief bereits unterzeichnet wurde, nachdem man sich bereits verabschiedet hat, danke und auf Wiedersehen.
Als ob wir davor nicht reden wollten und konnten und die Realität uns instinktiv entglitte – erst danach, nie davor. Vor allem.
‚Hypsipyle, gern möchten wir die herzfreuende Hilfe annehmen, die du uns, die wir deiner bedürfen, gewährst. Ich aber werde wieder zur Stadt zurückkommen, wenn ich alles im Einzelnen der Reihe nach berichtet habe. Um die Herrschaft aber und um die Insel sollst du selbst besorgt sein!
Ich jedenfalls leiste ohne Geringschätzung auf sie Verzicht, doch mich drängen traurige Mühsale.‘ Sprach’s und berührte ihre rechte Hand.
Jason war der Königin für ihr Angebot dankbar, doch er war entschlossen, nach dem kurzen Aufenthalt auf der Insel weiterzufahren.
Das ferne Kolchis und das Goldene Vlies warteten auf ihn, er konnte nicht den Thron von Lemnos besteigen, der nicht der seine war: Er war unterwegs, um den Thron von Iolkos zurückzuerobern.
Doch er zögerte nicht, die Königin mit einer zärtlichen Geste zu trösten, einer Geste, die besser tröstet als tausend Worte: Er berührte zart ihre Hand.
Eine Liebkosung. Die erste in Hypsipyles Leben.
Erinnern Sie sich noch daran, als jemand zum ersten Mal Ihre Hand in die seine genommen und Sie fortgeführt hat?
Egal, ob er Sie über den Gang einer Schule, in einen kleinen Park oder im Sommer an einen Strand geführt hat, Sie haben seinen selbstsicheren Blick geliebt, Sie haben sich von jemandem irgendwohin führen lassen.
Jason kehrte zu seinen Gefährten auf die Argo zurück, während die jungen Frauen ihn voller Freude umdrängten.
Gleich darauf brachten sie Gastgeschenke an den Strand, Südfrüchte und einladende Liebesbriefe.
Endlich verstanden die Argonauten die Aufforderung der Mädchen. Apollonios von Rhodos stellt nahezu ironisch fest:
Aber auch die Gefährten selbst führten sie mit Leichtigkeit zu ihren Häusern, um sie gastlich aufzunehmen. Denn Kypris* hatte süßes Verlangen erregt.
Es wurde Abend und die ganze Stadt erfreute sich an Reigentänzen und Festgelagen. Und vor allem stimmten sie Aphrodite, die Göttin der Liebe, mit Gesängen und Opfern milde.
Nur ein Argonaut war auf dem Schiff geblieben, hatte sich aus Vorsicht abgesondert und dachte an die bevorstehende Fahrt.
Herakles, der stärkste von allen, war der Einzige, der die Nacht allein verbrachte.
Die Tage vergingen, einer nach dem anderen, endlich fruchtbar. Endlich glücklich.
Der Wind war wieder günstig, doch die Argonauten ignorierten ihn und verschoben von Tag zu Tag den Aufbruch.
Am liebsten wären sie auf der Insel bei den verliebten Frauen geblieben, doch Herakles versammelte die Gefährten und rüttelte sie mit spöttischen und vorwurfsvollen Worten auf:
Unselige, schließt uns das vergossene Blut eines Verwandten vom Vaterland aus? Oder sind wir aus Mangel an Ehen von dort hierher gekommen, weil wir die Frauen unseres Volkes tadeln? Und gefällt es uns, hier zu wohnen und das fruchtbare Ackerland von Lemnos zu durchfurchen? Wahrlich, wir werden jedenfalls in keinem guten Ruf stehen, wenn wir uns so lange mitfremden Frauen einschließen. Auch wird durchaus nicht von selbst ein Gott das Vlies nehmen und es uns auf unsere Gebete hin geben. Wir wollen ein jeder wieder zu seinem Besitz gehen! Diesen [Jason] aber lasst den ganzen Tag über in den Betten Hypsipyles, bis er Lemnos mit Kindern männlichen Geschlechts bevölkert hat und großen Ruhm erwirbt.
Keiner wagte, den Blick zu heben oder etwas zu sagen.
Jason schämte sich mehr als alle anderen: Er wusste, wenn sie nicht aufbrachen, würden sie nie ihr Ziel erreichen.
Er hatte vergessen, dass man das Ziel nicht erreicht, wenn man die Fahrt nach wenigen Tagen angesichts der ersten verführerischen Bequemlichkeit am Festland unterbricht, die einen den Grund des Aufbruchs vergessen lässt.
Niemand anderer würde das Goldene Vlies erobern.
Niemand außer ihm würde die Heldenhaftigkeit unter Beweis stellen, die jeden Menschen ruft.
Schon zwei Tage nach dem heldenhaften Aufbruch hatten die Argonauten ihre Fahrt auf der Insel Lemnos unterbrochen.
Verlockt von der trügerischen Sicherheit der Monotonie hatten sie sofort angehalten.
Sie ließen sich treiben, wie die Argo vergessen im Hafen trieb.
Kaum hatten sie Herakles schneidende Worte gehört, machten sie sich geradewegs von der Versammlung aus bereit, eilends abzureisen.
Jahrelang hatte ich riesengroße Angst davor, Schriftstellerin zu werden.
Ich hatte Angst vor dem Schreiben.
Und ich war wütend auf mich, weil ich Angst hatte.
Ich wollte unbedingt schreiben, das war mein persönliches Goldenes Vlies.
Aber ich verstand nicht, dass ich vergebens kämpfte, dass ich den Grund für meinen Kampf falsch formuliert hatte. Ich hatte nie darüber nachgedacht, was mich daran hinderte. Ich änderte ständig den Kurs, verirrte mich bei der ersten Flut.
Heute kenne ich den Namen dessen, was mich daran hinderte: es war ein Alibi, eine Ausrede, eine Ausflucht.
Oder ein Anderswo, denn alibi besteht aus der Verbindung zweier lateinischer Worte, alius, anderer, und ubi, hier.
Ich wollte unbedingt schreiben, doch immer, wenn ich in Richtung Schreiben aufbrach, fand ich tausend Ausflüchte, um woanders zu landen, ich flüchtete mich in den ersten sicheren Hafen und vergaß bald darauf, wieder aufzubrechen.
Wenn mich jemand auf meine Unzulänglichkeit aufmerksam machte, zeigte ich ihm stolz das Auto, das ich mir gerade gekauft hatte, und das Inventar aller meiner zukünftigen Pläne – doch gleich darauf ließ ich mich ablenken und legte sie beiseite.
Ich verschob das Schreiben im Namen einer vorgeblichen Ernsthaftigkeit, als ob Worte bloß Spiel und Zeitvertreib wären.
Ich war schrecklich streng zu mit – manchmal bin ich das noch immer.
Und ich war unglücklich.
Eines Sommers kam einer meiner wertvollsten Freunde, der ebenfalls seine eigenen Wege geht, in meine damalige Heimatstadt und sagte zu mir, ich vergeudete mein Leben.
Er war mein Herakles.
Ich wünsche allen, einen Freund zu haben, der sich die Mühe macht, zu euch nach Hause zu kommen und euch aufzurütteln, wenn ihr euch verirrt habt.
Natürlich schämte ich mich, genau wie Jason. Aber ich verstand, dass ich mich vor allem von meinen Ausreden befreien musste, um aufbrechen zu können.
Wenn ich an meiner Angst festhielt, fühlte ich mich unabhängig, und verwechselte die Unabhängigkeit mit Freiheit.
Als Kompromiss hatte ich eine Zeitlang für andere geschrieben, das Schreiben ist mir immer sehr leichtgefallen.
Heute weiß ich, ich war feig.
Die Worte waren schon immer mein Leben, meine Art und Weise gewesen, die Welt zu verstehen und sie Wirklichkeit werden zu lassen.
Als Ghostwriter erzählte ich nicht von meiner Welt, sondern von der von Menschen und Unternehmen, für die ich arbeitete. Es war eine irreale Welt.
Ich hatte kein Gesicht und keinen Namen, niemand kam und zog mich zur Verantwortung, niemand schickte mir Briefe, um mir seine Freude oder seinen Schmerz anzuvertrauen, die schwer waren wie Felsen.
Ich schrieb und durfte nicht antworten, das lag nicht in meiner Verantwortung.
Ich verweigerte mir das Recht, das in der Antike den befreiten Sklaven als Erstes gewährt wurde, das erste Recht des freien Mannes: einen Namen zu haben.
Jahrelang habe ich mich verleugnet.
Ich habe mich von der Angst und aus der Anonymität befreit, ich habe meinen Namen wiederentdeckt.
Ich habe mich erkannt und habe aufgehört, wie ein Orakel von mir zu sprechen.
Ich habe Verantwortung übernommen und das Risiko auf mich genommen, ein Publikum zu haben, denn das war mein wahres Ziel.
Da habe ich begonnen, zur See zu fahren und mich nicht immer anderswo über Wasser zu halten.
Fahr davon, und mögen dich die Götter wiederum mit den unversehrten Gefährten bewahren, während du das Goldene Vlies für den König bringst, so wie du willst und es dir lieb ist! […] Denke freilich, zugleich wenn du doch abivesend und wenn du schon zurückgekehrt bist, an Hypsipyle!
Mit diesen Worten verabschiedete sich die Königin von Jason – und endlich konnte sie einen Wunsch an die Götter richten: wieder lieben zu können und Mutter zu werden.
Die Frauen von Lemnos begleiteten die Helden weinend zum Ufer – doch das waren keine Tränen der Trauer, sondern der Aufrichtigkeit.
Ihr Weinen galt den Göttern, damit sie den Argonauten eine glückliche Rückkehr ermöglichten.
Jason betrat als erster das Schiff, die Gefährten taten es ihm nach, setzten sich in Reih und Glied und ergriffen die Ruder.
Das Meer kennt weder Straßen noch Richtung, nur Schwellen, die man überschreiten muss.
Und du allein hast die Aufgabe zu entscheiden, wohin du fährst, der du zur See fährst wie wir alle.
Am Festland kannst du tagelang oder jahrelang zögern und so tun, als würdest du nicht verstehen, während du in Wirklichkeit nicht verstehen willst.
Du kannst dich weigern, dich an die zu erinnern, die du nicht lieben konntest, weil dir der Mut dazu fehlte, oder die du betrogen hast.
Du kannst den Gedanken an all das verdrängen, was hätte sein können und nicht war, weil du es nicht wolltest – Dinge und Menschen passieren nicht einfach, man muss sie suchen und dann lassen sie sich auch finden.
Du kannst deine Leidenschaft kleinreden, dich darüber lustig machen, um nicht gezwungen zu sein, wirklich daran zu glauben – und dich als dumm oder verblendet bezeichnen, wenn du wagst, daran zu glauben.
Du kannst jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust, schummeln, die Karten der Realität und der Irrealität beliebig mischen, die Karten dessen, was bereits zu Ende ist, und dessen, was gerade angefangen hat, obwohl du es nicht wolltest, du es nicht erwartet hast.
Deine Liebesgeschichten, deine Arbeit, deine Reisen, deine Tränen – das alles ist für dich nichts Besonderes, wenn du anderen davon erzählst, auf diese Weise verhinderst du, dich ernst zu nehmen und ernst genommen zu werden.
Die Gesetze der Physik sind nicht die des Lebens.
Ein menschlicher Körper hat die Fähigkeit, sich über Wasser zu halten, ohne dass er sich bewegt – man muss nicht schwimmen können.
Doch das archimedische Prinzip gilt nicht für das Leben: Wenn man sich Tage, Monate, manchmal sogar Jahre über Wasser hält und sich trügerischen Gewissheiten, falschen Überzeugungen, billigen Wortspielen hingibt, bedeutet das, unglücklich und ohnmächtig zu sein – in diesem Fall muss man wirklich schwimmen können.
Wenn wir ruhig am Festland verweilen, genauso starr und unbeweglich wie dieses, können wir uns bücken, wenn wir uns nicht auf der Höhe unserer Leidenschaften fühlen, uns klein machen, uns wegducken und in einem Winkel verstecken, anstatt uns auf die Zehenspitzen zu stellen, die Hände auszustrecken und den Blick zu heben, sobald uns das Leben mit Namen ruft.
Auf dem Meer nicht.
Die Entscheidung lässt sich nicht mehr aufschieben wie etwas Lästiges, Nebensächliches.
Man kann nicht antworten, so was passiert eben, und mit den Schultern zucken.
Es ist bereits passiert.
Die Traurigkeit, das Gefühl der Unzulänglichkeit werden morgen nicht verschwinden, auch wenn man dir das angesichts deiner labilen Psyche immer prophezeit hat – du wirst schon sehen, morgen ist alles anders, sicher, doch es kommt darauf an, was zurückbleibt.
Die Griechen kannten einen Begriff für diese Frustration.
Als Ἀμηχανία (Amechanìa) bezeichneten sie die Unfähigkeit, die jeglichen Elan lähmt. Das personifizierte Unvermögen war Schwester und Freundin einer der schmerzhaftesten menschlichen Zustände, der Armut: Sie hieß Πενία (Penìa).
Elend und Unzufriedenheit galten im antiken Griechenland als größte Gefahr für die Menschen, denn sie brachten sie dazu, sich klein zu machen, anstatt sich zu erheben.
Den Griechen zufolge machte Amechanìa den Wunsch zunichte, den alle Irdischen haben: sich nach eigenen Maßstäben als Held zu erweisen.
Alkaios von Lesbos schrieb in seinem Fragment 364:
Penìa, die Armut, ist etwas Schlimmes, ein unbeherrschbares Übel. Und gemeinsam mit ihrer Schwester Amechanìa schwächt sie ein großes Volk.
Zweitausend Jahre später denke ich: Wie hoch legen wir unsere persönliche Latte für unsere Erwartungen an das Leben, und vor allem für das, was wir bereit sind zu akzeptieren?
Was für ein Volk sind wir geworden?
Sich von den alten Gewissheiten zu lösen, ihnen mit einem weißen Taschentuch nachzuwinken und dabei den Blick in Richtung der endlosen Überraschungen des Lebens zu wenden: Das ist eine uralte, überaus befreiende Geste, die ein erfülltes Leben verspricht.
Sie ist notwendig, um zu verstehen, um den Menschen kennenzulernen, der du geworden bist – sie ist letztendlich notwendig, um dich zu akzeptieren und dich aufrichtig zu fragen, wie geht es dir?
In Lemnos bricht der Morgen an, es ist Zeit, in See zu stechen.
Und die Hecktaue löste ihnen Argos vom meerumflossenen Felsen.
*= Aphrodite