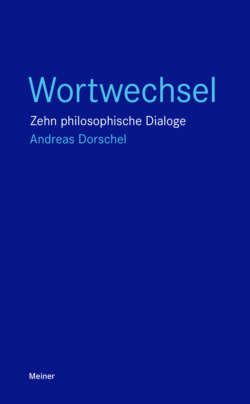Читать книгу Wortwechsel - Andreas Dorschel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LAUT DENKEN
Оглавление1 Dialog und Vorlesung: diese beiden gegensätzlichen Gattungen, unter anderen, verdankt Europa den Griechen.1 Im Dialog Gesagtes soll ein Gegenüber zum Reden bringen, in der Vorlesung Gesagtes den Studenten zum Schweigen. Die griechische Erfindung der Vorlesung wäre unverzeihlich, machte nicht die Erfindung des Dialogs sie wett.
2 Einst war der platonische Dialog »gleichsam der Kahn, auf dem sich die schiffbrüchige ältere Poesie sammt allen ihren Kindern rettete«2. Längst muß sich die Poesie nicht mehr retten. Immer noch eignet sich aber der Kahn des Dialogs in Fällen von Seenot – der über Bord Gegangenen der modernen akademischen Philosophie.
3 Die Schulphilosophie des 21. Jahrhunderts ist verengt in ihren Genres. Beinah ihre einzigen Äußerungsformen sind der Journalartikel sowie die Abhandlung ; von sonstigem, Tagungsberichten etwa, werden nicht einmal ihre Herausgeber erträumen, daß sie das Denken weiten. Die Abhandlung unterscheidet sich vom Artikel nur in der Länge; in der Weise, in der sie abgefaßt ist, gleicht sie ihm. Was nicht in diese Form paßt, fällt ins Wasser. Lernt es schwimmen oder ertrinkt es?
4 Philosophieren heißt: nachdenken und unabhängig bleiben. Unabhängig bleibt das Nachdenken, solange es frei von Furcht vor dem ist, was sich aus ihm ergeben könnte. Die beiden Forderungen sind insofern zwei Seiten der selben Sache. Und zu ihnen paßt Freiheit nicht nur der Inhalte, sondern auch der Formen. Frühere Philosophien, insbesondere jene der Renaissance und der Aufklärung, bedienten sich etwa auch des Briefes, der Erzählung, des Monologs und des Dialogs, um philosophische Positionen einzuführen und dann, in der Entfaltung des Gedankengangs, mittels dramatischer sowie epischer Ironie in unterschiedlichem Maß Abstand von ihnen zu nehmen. Den Veranstaltern des modernen akademischen Exorzismus solcher Formen mag vor Ironie bange gewesen sein. Letzte Sicherheit vor ihr erlangen sie vielleicht nur in der ihnen ganz eigentümlichen Form des Dialogs, der Podiumsdiskussion auf dem Philosophiekongreß.
5 Unter den philosophischen Gattungen, die sich einer Heuristik der Fiktion bedienen (¶ 4), bietet der Dialog die besonderen Gelegenheiten – verknüpft, wie alle Gelegenheiten, mit speziellen Grenzen – eines Schauspiels für Leser: übrigens nicht unbedingt für geneigte (¶ 36). Auf den Dialog kam die Philosophie nicht, um sich aufs Gefälligsein zu verlegen.
6 In den Schauspielen für Hörer und Zuschauer hat man verpaßt, was man verpaßt hat. Es gibt kein Zurück, wie bei den Schauspielen für Leser (¶ 5). Diese erlauben auch Innehalten, Nachdenken. Sie können daher andere Schwierigkeiten zumuten. Das Schauspiel für Leser, das philosophische Dialoge bieten, wird zum Theater des Verstandes. Gespräche dieser Art, Schauspiele ohne Schau und Show, inszenieren Begriffe; diese umkreisend, führen sie vor, wie Bedeutung zwischen Redenden entsteht und vergeht. Im Hinblick auf die Begriffe wird manches gesagt; dies zählt zum Inhalt des Dialogs (¶¶ 34–35). An seiner jeweiligen Form aber zeigt sich etwas, das nicht mehr gesagt wird.
7 Die philosophischen Begriffe (¶ 6) sind zwar »Griffe«3 – aber nicht Griffe der Hand, unmittelbar am Einzelnen, sondern Griffe des Kopfes, abgelöst vom Einzelnen. Diese Selbständigkeit verleihtihnen höhere Verfügung, nämlich allgemeine. Darum sagt man, Herrschaftliches andeutend, das Einzelne sei unter dem Begriff begriffen, subsumiert. Keine Verfügung über den Begriff sucht der ihn umkreisende Dialog; er löst sich seinerseits ab von diesem Element der Ablösung.
8 Wofür die definitionshungrigen Abhandlungen (¶3) anfällig sind, dem müssen Dialoge sich entziehen: in Terminologie zu erstarren.4 Sie sind Wortwechsel nicht nur in dem Sinne, daß das Wort hinüber und herüber wechselt, sondern auch in dem Sinne, daß etwas an den Worten wechselt. Da Dialoge vorführen, wie Bedeutung zwischen Redenden entsteht und vergeht (¶ 6), will ihre Sprache fließen.
9 Ein Schauspiel für Leser (¶¶ 5–6): Imaginiert ist, daß die Figuren laut denken. So macht der Dialog Leser zu Zeugen, statt zu Empfängern eines Berichts.
10 Ein Kind, das eine Puppe in der Hand hält, findet Sätze, die es ohne die Puppe nicht hätte sagen können. Philosophische Dialoge arbeiten diese Situation aus – bis sie erwachsen wird.
11 Nur in und an Widerständen denkt jemand. Wer ganz im Einklang mit sich und anderen wäre, bräuchte nicht mehr zu denken. Die Kunst des philosophischen Dialogs liegt darin, vom Satz zum Gegensatz zu gelangen. Das gilt bis zum Finish: Erst Reibung verleiht Gedanken Politur. Satz und Gegensatz indes reichen nicht; zu Figuren (¶ 9), mit Worten agierenden und reagierenden, muß der dem Denken unentbehrliche Widerstand im Dialog werden. Das Genre fordert vom Autor, ehe er den Gedanken schreibt, erst einen Jemand zu finden, der fähig ist, den Gedanken zu äußern, und –unter Vorbehalt (¶ 46) – andere, die fähig sind, ihn zu begreifen.
12 Des Widerstands halber ist indes Begreifen (¶ 11) nie genug. Wenn Denken sich nicht einfach in einem Denker, sondern zwischen Sprechern ereignet (¶ 8), dann müssen die Figuren eines Dialogs in der Lage sein, einander zu irritieren; nur so bleibt das Gespräch lebendig. Jede einzelne der Figuren zählt, aber nichts zählt so sehr wie ihre Zusammenstellung. Das Bild, das sich aus ihr ergibt, braucht nicht schön auszufallen. Zuweilen ist die Sau nötig, der einer seine Perlen hinwerfen kann; die Sau irritiert den Liebhaber der Perlen durch deren Geringschätzung, die Perlen irritieren die Sau durch Unverdaulichkeit. Lebendig muß das Bild sein, das sich ergibt, und wäre es auch in solchem Falle.
13 Ein Ort, Figuren dieser Qualität (¶¶ 11–12) zu finden, ist die Geschichte. Aber Finden geht hier einher mit Erfinden – »historical fiction«.5 »Der historische Mensch ist gewissermaßen ein Magnet, und um ihn herum ist ein Feld, in dem man sich erfindend bewegt«, sagt Daniel Kehlmann, seinen Roman Die Vermessung der Welt erläuternd; es gilt auch für imaginäre Konversationen in der Nachfolge Walter Savage Landors. Einerseits ist es nicht Sinn der Sache, solche Dialoge nur aus belegten Äußerungen, etwa in Briefen und Tagebüchern, zu montieren. Rückt man andererseits den Gestalten der Geschichte so fern, »daß die Kraft ihres Feldes nicht mehr spürbar ist, so hat man das künstlerische Recht verloren, diese Namen zu verwenden«6 – das künstlerische Recht nämlich im Roman, das philosophische Recht im Dialog.
14 Das Verhältnis von Figur und Gedanke im philosophischen Dialog ist prekär. Um Dialog zu sein, muß er von Personen geführt werden, nicht von Personifikationen; wer eine menschliche Figur lediglich dazu benutzt, eine Abstraktion zu vertreten, behandelt sie unter ihren Möglichkeiten, den literarischen und den philosophischen. Zur Person, und nicht bloß Personifikation, wird eine Figur in dem Maße, in dem sie eine eigene Stimme gewinnt. Nur dann wird es auch zum Ereignis im Dialog, wenn sie diese verliert, nämlich verloren gibt, etwa weil sie sich opportunistisch anpaßt an die, mit denen sie spricht.
15 Jede Stimme sagt mehr als ihre Sätze.
16 Wenn zwei miteinander reden und ein paar Einsichten gewinnen, haben beide gewonnen. Folglich ist es eine Dummheit zu glauben, Gespräche seien Spiele, die der eine gewinnt, sofern der andere sie verliert. Aber diese Dummheit, und nicht nur diese, widersteht Einsichten, besonders der genannten. Und sie kann eigentümlich fruchtbar werden. Das stellt den Dialog unter Wittgensteins landschaftliches Gebot: »Steige immer von den kahlen Höhen der Gescheitheit in die grünenden Täler der Dummheit.«7 Diese können, denn es ist ein metaphorisches Grün, auch in der Stadt liegen, ja sie liegen, was das Dialogische betrifft, fast nur dort.8
17 Statt die Dummheit der Rivalität (¶ 16) in Gestalt eines idealen Gespräches zu unterdrücken, muß der philosophische Dialog das Beste aus ihr machen. Also ist sein Bestes ein Zweitbestes, deuteros plous9.
18 Polizeiliches oder richterliches Ausfragen ergibt keinen Dialog. Und doch: Die dialektischen Figuren (¶¶ 9, 11–12, 14) agieren, im Kräftemessen und über dieses hinaus, wechselseitig als Erkennungsdienst; die sachdienlichen Hinweise, die sie einander geben und von einander entgegennehmen, tragen zur Identifikation der Personen bei. Sie tun es selbst dann, wenn sie über die Person täuschen sollen, denn man täuscht auf die eigene, persönliche Art.
19 Kraft ihrer Figuren (¶¶ 9, 11–12, 14, 18) vergegenwärtigen Dialoge. Wenn sie in der Vergangenheit (¶ 13) spielen, wird auch diese zur vergegenwärtigten – als ereigne sich das Gespräch hier und jetzt. Solch eine Gegenwart kann nur Hokuspokus sein: Geisterbeschwörung. Aber sie taugt als Korrektiv gegen den Trug der Abhandlungen (¶ 3). Diese legen philosophische Fragen ab in einem abstrakten Irgendwo – einem Nirgendwo –; Gespräche haben einen Ort. In ihnen kommt es nicht nur darauf an, was gesagt wird, sondern auch darauf, wo es gesagt wird, wie es gesagt wird und wer es sagt. Sie können, dürfen, sollen vom Gelegentlichen ausgehen. Den Fragen, die das Denken aufwirft, geben Dialoge ihren Sitz im Leben zurück, indem sie bestimmte Personen, mit ihrer je eigenen Stimme (¶¶ 14–15), in Situationen sprechen lassen ; Abhandlungen hingegen reklamieren, jenseits von Raum und Zeit, die eine Stimme der Menschheit, der Vernunft, des Seins oder als wessen Bauchredner Philosophen sonst noch auftreten mögen.
20 Daß der Ort des Dialogs (¶ 19) die Öffentlichkeit sei, ist ein Gerücht. Weil sie alles und nichts ist, gibt Öffentlichkeit nur den Ort ab für sogenannte Dialoge. Deren Teilnehmer bestätigen mittels sprachlicher Fertigteile den einen die Zusammengehörigkeit und bestreiten anderen die Zugehörigkeit zu den Anständigen – etwa durch öffentliches Ausrufen von Skandalen. Wo es ein Publikum gibt – in der Öffentlichkeit – endet das Gespräch und beginnt das Spektakel, die Sabotage am Gespräch.10 Sofern die folgenden Dialoge an öffentlichen Orten stattfinden, etwa in einem Museum, auf der Straße, in einem Kaffeehaus, sind diese so beschaffen, daß sie die Redenden einem Publikum entkommen ließen. Öffentlicher Raum kann am Stand der dialogischen Gnade teilhaben, solange er Nischen aufweist, die vor Öffentlichkeit eben noch verschonen. Fiktive Zeugnisse solcher Gnade zu veröffentlichen ist das Paradox des Genres Dialog (¶¶ 4–9, 12).
21 Zum Publikum (¶ 20) reden Demagogen mit nachtwandlerischer Sicherheit. An aller Sicherheit ist etwas von Nachtwandeln. In dem Maße, in dem das Bewußtsein heller wird, schwindet die Sicherheit, mehrt sich der Zweifel.
22 ›Zweifel‹ (¶ 21) ist etymologisch, was sich zweimal falten läßt, und Dialog ist Zwei-, Drei-, Viergespräch. Der Abstand, den jeder Text als Text zur Welt hält, dehnt sich im Dialog um den Abstand des Autors zu seinen Figuren sowie um den Abstand der Figuren zu einander. In der Form selbst steckt ein Element der Skepsis,11 das freilich durch den Inhalt des Gesagten entfaltet oder, sofern Dogmatiker am Werke sind, vernichtet werden kann. Diese, notorisch nur den eigenen Gedankengängen folgend, hören schlecht zu, ja hören am Ende den anderen überhaupt nicht mehr zu12 und entziehen so dem Dialog die raison d’être, auch wenn tatsächlich noch das Wort hin und her geht. Übrig bleiben dann abwechselnde Monologe.
23 »In der Form selbst« (¶ 22)? Grenzen hat der Dialog allerdings; sind sie eng gezogen, schadet ihm das nicht. Denn Philosophie fordert Genauigkeit, Deutlichkeit, Sorgfalt. Diesen tut Demarkation keinen Eintrag, im Gegenteil. Um alles zu sagen, braucht der Dialog nicht mehr als zwei Leute in einem Raum; was darüber hinausgeht, ist bereits Luxus.
24 Dialoge, die etwas taugen, sind mit Überlegung gestaltet ; in diesem weiteren Sinne werden sie geformt sein – jedoch zu Formen, entzogen allen einheitlichen Schemata, die gegen die Inhalte der Erörterung gleichgültig wären. Von einer Dialogform in dem engeren Sinne, in dem es etwa (bei allen Varianten) eine Sonettform gibt, kann hingegen keine Rede sein. Auch insofern ist Philosophieren im Dialog fluide (¶ 8). Selbst eine Debatte wie über die Zahl der Akte im Drama wäre mit Blick auf sie – Soll ein guter Dialog drei oder fünf Abschnitte haben? – kaum denkbar.
25 Platon verbrannte seine Tragödien vor dem Dionysostheater zu Athen, ehe er sich dem sokratischen Dialog zuwandte.13 Mit dem Drama (¶ 24) teilen Dialoge die Literarisierung von Mündlichkeit (¶¶ 5–6). Doch jenes ist dazu da, auf der Bühne gespielt und gesprochen zu werden ; diese hingegen eignen sich kaum für eine Aufführung14 – nach üblichen Begriffen des Dramatischen geschieht im Grunde nichts. Aber: »Worte sind auch Taten«15 – die Tat besteht jeweils darin, sie zu äußern. Dem Denken (¶¶ 9, 11) können die Worte, die auch Taten sind, eine neue Richtung geben. Ja selbst der Folge der Worte zuzuhören (wie es denjenigen im Dialog zuzuschreiben ist, die jeweils nicht reden) ist eher ein Akt als ein Zustand, in dem man passiv bleiben könnte. Hören kann unaufmerksam sein; Zuhören entspringt der Aufmerksamkeit.
26 Dialogfiguren sind vor allem durch das, was sie sagen, zu charakterisieren (¶ 18). Entfällt die Aufführung (¶¶ 5–6, 25), dann fehlen die Gebärden, die Sprache des Körpers. Es ist leicht, sich über den Verlust mit der Auskunft zu trösten, die Probleme der Philosophie seien geistige. Tatsächlich gestikuliert ein Mensch ja desto wilder, je schlechter sein Argument und je vitaler sein Verlangen nach dem, wofür er argumentiert, ist. Und doch kann es in bestimmten Partien eines Dialogs entscheidend werden, jenen Verlust ein Stück weit aufzufangen. Die Sätze müssen an solchen Stellen etwas Gestisches annehmen.
27 Die Sprachgebärde des Dialogs (¶ 26) gehört der Sphäre an, in der Begriffe inszeniert werden (¶ 6). Aller Naturalismus verfehlt sie. Auf Papier zu stammeln, zu seufzen und zu stöhnen ist meist unfreiwillig albern. Wert haben Albernheiten im Dialog nur, sofern sie freiwillig begangen werden.
28 Im ersten Wortwechsel seines Coloquio que pasó entre Cipión y Berganza distanziert Cervantes die »términos de naturaleza«16. Die Kunstsprache des Dialogs erzeugt sich aus einer Spannung zwischen Sprechsprache und Schriftsprache. Gelingen werden Dialoge nicht dem, der sie zu Abbildern wirklicher Gespräche macht. Solche werden eben nicht gelesen, sondern geführt. Da gesprochene Worte in dem Moment, in dem man sie ausspricht, verschwinden, stellt oft erst ihre Wiederholung sicher, daß sie ins Ohr gehen. Den weißen Sprachschaum, der Konversationen schmiert, muß ein Dialogautor wegwischen. Wo die Anspielung nicht genügt, erübrigt sich der Dialog. Rutschen Gespräche ins Geplauder, dann reden alle weiter, auch wenn sie nichts mehr zu sagen haben. Derlei Nichtssagendes muß der geschriebene Dialog erst recht abstreifen. Ausnahmen sind nur erlaubt, wenn Begriffsstutzigkeit zur Charakteristik gehört ; denn dann besagt das Nichtssagende nicht nichts, sondern etwas über jemanden.
29 Im Dialog gilt es, Wirkliches und Erfundenes, statt sie zu panschen, genau auf einander zu beziehen (¶ 13). Eine Beziehung dieser Art ergibt sich kaum je von selbst; sie ist nicht natürlich (¶¶ 27–28). Autoren von Dialogen müssen den Mut zur Künstlichkeit aufbringen, und ihre Leser Langmut mit der Künstlichkeit. Das Leben (¶ 19), in dem Dialoge den philosophischen Fragen ihren Sitz verschaffen, ist nicht das Leben, wie es geht und steht. Es herrscht in ihnen zum Beispiel stets Feierabend. Denn wer arbeitet, sagt zwar vielleicht etwas, oder sogar eine Menge, führt aber keine Dialoge. Ihre paradoxe schriftliche Mündlichkeit (¶¶ 5–6, 25, 28) macht Dialoge artifiziell und umständlich – so artifiziell und umständlich wie, aus anderen Gründen, Sonette von Góngora oder Filme von Visconti. Sie sind dies bereits in ihren Anfängen bei Platon,17 und sobald ein Autor sie ins Schlichte zwingen will, wie Heidegger auf dem Feldweg,18 überzieht Monologisieren lähmend die erhaltene äußere Form. Seiner Brechungen beraubt, wird das Zwiegespräch einfältig.
30 In Berlin umkreiste eines Nachts ein Betrunkener eine Litfaßsäule, wankte immer aufs Neue an ihr entlang, tastete sie ab, bis er endlich zu Boden sank und schluchzte: »Hilfe! Man hat mich eingemauert!« Dieser Satz ist zu denken als der vorläufig letzte eines ausgedehnten Selbstgesprächs.
31 Hamlet, Macbeth, Wallenstein: Der Monolog ist die Redeweise des Unseligen. Er redet sich ins Unheil. Wo eine zweite, ein zweiter da sind, die mit sich reden lassen, im Dialog also, ist ein Glück als möglich gesetzt – nicht unbedingt, wie auch das Leben lehrt, als wirklich.
32 Allerdings läßt sich der Gegensatz des Dialogs zum Monolog (¶¶ 22, 29–31) überdehnen. Es gilt vielmehr, das Monologische am Dialog und das Dialogische am Monolog zu sehen. Einerseits spricht in der Unterredung jeder ein Stück weit für sich, und mit sich. Andererseits imaginiert derjenige, der ein Selbstgespräch führt, oft genug den mit, der an seinen Lippen hängt, oder er zerlegt sich selbst in die Rollen eines Redenden und eines Zuhörenden respektive (im Fall des monologischen Tagebuchs) eines Schreibenden und eines Lesenden. Jemandes Zeichen ist immer ein – mögliches – Zeichen für jemand anderen. Wer spricht, will gehört, wer schreibt, will gelesen werden. Zwar schaffen Zuhören und Lesen noch keinen Dialog. Erst mit der geäußerten Antwort entsteht Zwiesprache. Aber Zuhören und Lesen sind bereits unterwegs ins Dialogische.
33 Daß er elliptisch ist (¶ 28), macht den Dialog nicht weniger umständlich. Umständlich ist, wer viele Einzelheiten einer Sache berücksichtigt. Diese aber rückt der Dialog außerdem noch in zwei oder mehr Blickwinkel.19 So wird er nicht nur umständlich, sondern umständlicher. Die Figuren stehen um den Gegenstand herum, sofern sie jeweils ihren Blickwinkel beibehalten, oder sie gehen um ihn herum, sofern sie den Blickwinkel während des Gesprächs wechseln. Sie umschleichen ferner einander sowie das, was die anderen ihnen jeweils sagen: Die Replik auf eine Bemerkung deutet diese, und deutet sie um. Solcher Umgang macht noch mehr Umstände.
34 Philosophische Dialoge sind in ihren Inszenierungen von Begriffen (¶ 6) nicht auf einen durch das Wahre, Gute, Schöne umrissenen Themenkreis festgelegt; aus dem Weizenhandel schlug Galiani Funken des Gedankens.20 Geist hat ein Gespräch nicht, weil Geistiges sein Sujet ist, sondern weil Geist in ihm nicht lockerläßt und den Gedanken weitertreibt. Schlagen muß man, der Funken wegen – selbst so von der Metaphysik verhätschelte Kreaturen wie das Wahre, Gute, Schöne.
35 Man spricht über etwas; ein Dialog hat ein Thema (¶ 34). Das Thema verwandelt der Dialog in eine Frage. Aber das ist noch zu wenig. Ginge es nur um die Sache, sei’s auch fragend, wäre wirklich eher die Sachlichkeit der Abhandlung (¶ 3) angezeigt als das Spiel der Personen eines Dialogs. Wie beim Essay ist der Gegenstand im Dialog, der einerseits anzieht, ebensosehr dazu da, sich von ihm abzustoßen – ihn zum Vorwand zu nehmen. Tricks, Abschweifungen, Ausschweifungen, Paradoxien, Frech- und Albernheiten manövrieren um ihn herum. Denn, noch einmal: Personen sind zu schade dafür, an ihnen logische Schlüsse vorhersehbar durchzuexerzieren (¶ 14). Und, auch dies noch einmal: Dialoge gehören in Gegenden, die nicht kahl sind (¶ 16). Jene Manöver weisen dem Gegenstand seinen Platz an; er mag weniger respektabel sein, als man vor dem Gespräch meinte.
36 Der philosophische Dialog, als Genre, trägt in sich eine Spannung aus zwischen disziplinären, disziplinierenden und disziplinierten Qualitäten wie Progression, Genauigkeit, Deutlichkeit, Sorgfalt (¶¶ 23–24), Beharrlichkeit (¶ 34) und kritischer Schärfe einerseits, undisziplinierten und antidisziplinären Haltungen wie Hang zur Digression, Paradoxie, Frech- und Albernheit (¶ 35) andererseits. Das Resultat kann eine ordentliche Unordnung sein, organisiertes Chaos. Es ist nicht auf die einfache Formel eines Kontrapunkts des Schweren und des Leichten zu bringen. Denn einer Lektüre bequemen Verbrauchs bietet sich der eine Zug so wenig an wie der andere. Unbeschadet dieser Gemeinsamkeit bilden sie einen Gegensatz; George Berkeley21 und Lukian von Samosata22 markieren die Pole, Platons Symposion die glückliche Balance.
37 Sofern Philosophie ein Gespräch der Nachdenklichen ist, läßt sich mit ihr kein Staat machen. Auffallend am auffallendsten Versuch, es doch zu tun, dem Platons, ist sein Scheitern. Im Unterschied zu Militärmusik, Triumphbogen oder Herrscherportrait bildet der Dialog kein repräsentatives Genre. Staaten lieben Löwen in ihren Wappen. Im Leben solcher Raubkatzen wechselt kurze Jagd mit langer Verdauung. Dösend bieten sie den Anblick erhabener Langeweile. In die Not, vor anderen Tieren weglaufen zu müssen, geraten sie nie. Könnte der Dialog sich Heraldik leisten, müßte er Hasen aufs Schild bringen. In Rede und Widerrede vollzieht sich eine Flucht. Sie beginnt zweckmäßig als Flucht nach vorne. Doch nur sofern in jedem Moment eine Wendung nach links, rechts, selbst zurück erfolgen kann, wird Monotonie, die Lähmung des Dialogs, vermieden. Dem Lepus europaeus steckt Ironie in den Läufen. Die Lehre des Hasen lautet: Haken schlagen. Das ist alles. Der Dialog kann und will sich keine Heraldik leisten. Man soll seine Haken nicht auf Schilden ankündigen.
38 Das Gespräch nähert sich der Sache Schritt für Schritt, und dann plötzlich mit einem Sprung, oder es entfernt sich mit Schritt, Sprung und Hakenschlag (¶ 37) von ihr. Es gibt verschiedenen Ansichten der Sache fair play, und dann wieder unfaires. Dialogiker arbeiten gegen das Vorhersehbare, das Chloroform des Dialogs.
39 Reden, das sich in seinen Thesen erschöpft, ist erschöpft. Hinter dem Vordergrund des Gesprächs begibt sich in einem sinnreichen Dialog immer noch etwas anderes. Dieser Hintersinn ist aus den Abschweifungen des Dialogs (¶¶ 33, 35) meist eher zu entziffern als aus seinem logischen roten Faden.
40 Vom Hintersinn (¶ 39) her zerfällt in einem Dialog manchmal bereits, woran im Vordergrund noch gebaut wird. Zwar kommt auch das Umgekehrte vor. Aber wer für das objektive Element des Destruktiven und für das subjektive Element des Boshaften keinen Sinn hat, dem ist mit dem Genre Dialog schlecht gedient. Zu sich selbst gelangt es, dem großen Boëthius zum Trotz, in größtmöglichem Abstand von den Gattungen geistlicher Erbauung, der Trostschrift und der Predigt.
41 Das weltliche Gegenstück zur Predigt (¶ 40), dem Monolog des Pfarrers, ist die Vorlesung (¶ 1), der Monolog des Professors. Beide wollen nicht unterbrochen werden. Vor der Erfindung des Buchdrucks dienten Vorlesungen der Dissemination der Bücher. Der vorlesende Professor redet wie ein Buch, weil er aus seinem Buch liest.
42 Aus einem Dialog oder einer Reihe – vielleicht untergründig verwobener – Dialoge ist seit langem dann und wann ein Buch hervorgegangen (¶ 4). Vom einzelnen Unterredner im Dialog sollte indes besser nicht gelten, er rede wie ein Buch. In diesem Punkt kann die Literatur doch einmal vom Leben lernen. Wie in wirklichen Gesprächen ist auch in der Kunstform des Dialogs die Unterbrechung – der »plaisir de interrompre«23 – ein probates Gegenmittel. Dem professoralen Redestrom in der Vorlesung (¶¶ 1, 41) sind die Studenten ausgeliefert, nur unter widrigen Folgen gibt der Gefreite dem Befehl des Offiziers Kontra, selbst gegen Anwürfe in einem Brief vermag sich der Empfänger nicht auf der Stelle zu verteidigen. Den seltenen Vorzug, sich gleich wehren zu können, eröffnet einem der gesprochene Dialog; der geschriebene hat diesem Vorzug, wenn auch vielleicht nichts anderem auf der Welt, Ehre zu erzeigen.
43 Man kann unterbrochen werden (¶ 42), aber auch sich selbst unterbrechen; in jenem Fall ergreift der andere das Wort, in diesem fällt es ihm zu. Daß die Rede vom einen auf den anderen übergeht, versteht sich nie von selbst. (Sogar eine Frage könnte, wer sie gestellt hat, selbst beantworten.) Wer das Wort ergreift, ortet eine Leerstelle und setzt dazu an, sie zu füllen. Wann und wie die Rede zwischen den Redenden wechselt, kann so bedeutsam sein wie das, was sie besagt.
44 Der Wirklichkeit nach werden Gespräche, dem Leib sei Dank, etwa durch Müdigkeit beendet oder durch Hunger. Das liegt an den Sprechern, nicht am Besprochenen. An irgendeinem Punkt führt jeder Stoff (¶¶ 34–35) ins Unendliche. Ginge es allein nach dem Geist (¶ 34), wären Dialoge der Möglichkeit nach endlos. Sie könnten stets weitergehen, da es keinen Satz gibt, dem sich nichts entgegnen ließe (¶ 11). Die Position birgt in sich bereits ihre Negation: »Il n’y a pas une idée qui ne porte en elle sa réfutation possible, un mot le mot contraire.«24 Darum kann ein Dialog nicht schließen, sondern nur abbrechen. Mit diesem Akt unterbricht nicht mehr eine Figur die andere (¶ 42), sondern, mittels zweitbester (¶ 17) Kunst, der Autor seine Figuren. Er spricht, als letztes Wort, ein seltsames Machtwort; hinter ihm steht nicht, wie in normaler Macht, die Fähigkeit, Sanktionen zu verhängen, sondern allein der Umstand, daß die Figuren seine Figuren sind. Als Fragment gibt der Autor den Dialog frei. Obschon kein Schauspiel für die Bühne (¶ 25), ist dieser – wie man es von einem Drama sagt, das sich nicht zur Dichtung erhebt – ein »Stück«.
45 Wie enden? In der Tragödie, im Heldenepos, im Roman, im Opernlibretto, im Thriller wird häufig gestorben: nicht nur gegen Ende, aber auch. Das ist vage – denn der Tod ist kein bestimmter Gedanke –, doch effektvoll. Mit ein paar Worten ist es leicht bewerkstelligt. Genaugenommen zu leicht. Als genaunehmendes Genre (¶ 23) verzichtet der Dialog auf das Sterben in Worten; hinter der einen berühmten Ausnahme, dem Schluß des Phaidon, könnte jeder weitere Versuch nur zurückbleiben. Wir sind dem Asklepios immer noch einen Hahn schuldig.
46 Tragödien enden mit dem Untergang des Helden, Komödien mit seiner Hochzeit.25 Die Finalpartie von Dialogen, die insbesondere Lukian so entschieden der Komödie annäherte,26 findet in der Heirat ein besseres Pendant als im Tod. Doch nicht die Übereinkunft ist der Zug der Eheschließung, der sie für die letzten Passagen von Dialogen als – wenngleich ferne – Entsprechung anziehend macht. Dialoge in einen Konsens zu führen, ist öde.27 Anziehend am Komödienschluß ist für Dialoge vielmehr der Zug der wechselseitigen Verkennung. Ein Gespräch gilt es abzubrechen, sobald diejenigen, die es führen, sich in aufschlußreichen Mißverständnissen festgeredet haben. Die Fäden, welche die einzelnen verfolgten, sind dann zu einem Knoten festgezurrt, der allen gemeinsam ist und für den sich darum zugleich jeder und keiner mehr verantwortlich fühlt. Darum ist dem philosophischen Dialog weniges so fatal wie die dialogische Philosophie. Entgegen Buber28 ist Dialog weder die Seinsweise, die den anderen zum authentischen Du werden läßt, noch auch ein Prinzip.
47 Knoten (¶ 46) befestigen, verbinden, speichern potentielle Energie. So weit, so nüchtern. Aber Knoten werden erfunden, nicht einfach gefunden. In der Odyssee ist es die Zauberin, Kirke, die Odysseus die Kunst des Knotens lehrt.29 Zeit im Dialog zu gestalten heißt, die Fäden, aus denen er gewebt ist, nicht zu früh und nicht zu spät zu verknoten. Daß der Knoten sich dann nicht mehr lösen läßt, macht seine eigentümliche Perfektion aus30 – die einzige, die mit Skepsis (¶ 22) zu vereinbaren ist.
48 Skepsis (¶¶ 22, 47), sofern sie das Denken weitertreibt, ist nicht satt. Die vorletzte Maxime von Graciáns Oraculo manual gilt auch für Dialogschlüsse: »Dexar con hambre«,31 »Hunger zurücklassen«.
49 Da die Aufführung entfällt (¶ 25), fehlt dem Dialog ein Vorhang, der, indem er sich schließt, die Vorgänge abschließt. Zwar hat in jedem Dialog irgendeiner das letzte Wort. Doch die Gründe, die gegen ein letztes Wort sprechen, wuchern jenseits des Dialogs unaufhaltsam weiter.
50 Vorworte legen Zeugnis ab vom schlechten Gewissen der Verfasser; gut, wenn sie eines haben.
1 Zur Vorgeschichte des Dialogs Martin L. West, Indo-European Poetry and Myth, Oxford University Press, Oxford 2007, 68–69.
2 Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie [1872], § 14, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, Bd. 1, hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari, 2. Aufl., Deutscher Taschenbuch Verlag – de Gruyter, München – Berlin/New York, NY 1988, 9–156, 93.
3 Bertolt Brecht, ›Über die Art des Philosophierens‹ [1939/40], Werke, Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Bd. 22.1, hg. v. Inge Gellert u. Werner Hecht, Aufbau-Verlag – Suhrkamp, Berlin/Weimar – Frankfurt am Main 1993, 512–513, 513.
4 Vgl. Salomon Maimon, ›Geschichte seiner philosophischen Autorschaft, in Dialogen‹, Neues Museum der Philosophie und Litteratur 2 (1804), H. 1, 123146. Maimon spricht in seinem Dialog von einer abzulegenden – und von ihm abgelegten – »Definitionswuth« (139).
5 Mary Margaret McCabe, Plato and his Predecessors: The Dramatisation of Reason, Cambridge University Press, Cambridge 2000, 10–13; vgl. a. 45, 76–77, 90, 134–135, 199.
6 Daniel Kehlmann, Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen, Wallstein, Göttingen 2007, 26.
7 Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen [1914–51], hg. v. Georg Henrik von Wright, Werkausgabe, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, Bd. 8, 445–573, 557.
8 Vgl. Platon, Phaidros [c. 370 v. Chr.], 23od, Sämtliche Werke in zehn Bänden, Griechisch – Deutsch, hg. v. Karlheinz Hülser, Insel, Frankfurt am Main/ Leipzig 1991, Bd. VI, 9–149, 20.
9 Platon, Phaidon [c. 383 v. Chr.], 99d, Sämtliche Werke in zehn Bänden, Griechisch – Deutsch, hg. v. Karlheinz Hülser, Insel, Frankfurt am Main/Leipzig 1991, Bd. IV, 185–347, 298.
10 Ari Adut, Reign of Appearances: The Misery and Splendor of the Public Sphere, Cambridge University Press, New York, NY 2018, ix–x, 15, 28–29, 41, 121.
11 Johann Jakob Engel, Über Handlung, Gespräch und Erzählung [1774], hg. v. Ernst Theodor Voss, Metzler, Stuttgart 1964, 38, vgl. 37, sowie 48 zu »Situation«.
12 Adam Müller, ›Über die dramatische Kunst‹ [1806], Kritische, ästhetische und philosophische Schriften, hg. v. Walter Schroeder u. Werner Siebert, Luchterhand, Neuwied/Berlin 1967, 139–291, 141.
13 Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers [um 240 n. Chr.], 3.5, hg. v. Tiziano Dorandi, Cambridge University Press, Cambridge 2013, 244–245.
14 – und dies obschon Platons Dialoge Schauspiele, etwa Strindbergs, Wildes, Shaws und Pirandellos, hervorgerufen haben, die auf dem Theater leben; s. Martin Puchner, The Drama of Ideas: Platonic Provocations in Theater and Philosophy, Oxford University Press, Oxford/New York, NY 2010.
15 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen [1951], § 546, Philosophical Investigations, hg. u. übers. v. G.E.M. Anscombe, 2. Aufl., Blackwell, Oxford 1958, 146.
16 Miguel de Cervantes Saavedra, ›Coloquio que pasó entre Cipión y Berganza‹ [1613], Obras, hg. v. Buenaventura Carlos Aribau, Rivadeneyra & Co., Madrid 1846, 205–220, 205.
17 Martha C. Nussbaum, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy [1986], Cambridge University Press, Cambridge 2001, 130.
18 Martin Heidegger, Feldweg-Gespräche [1944/45], Gesamtausgabe, Abt. III, Bd. 77, hg. v. Ingrid Schüßler, Klostermann, Frankfurt am Main 1995.
19 Oscar Wilde, ›The Critic as Artist‹ [1891], The Collected Works of Oscar Wilde, hg. v. Robert Ross, Bd. 8: Intentions, Routledge/Thoemmes, London 1993, 97–224, 193–194 (Gilbert): »By its [sc.: dialogue’s] means he [sc.: the thinker] can exhibit the object from each point of view, and show it to us in the round, as a sculptor shows us things[,] gaining in this manner all the richness and reality of effect that comes from those side issues that are suddenly suggested by the central idea in its progress, and really illumine the idea more completely, or from those felicitous after-thoughts that give a fuller completeness to the central scheme, and yet convey something of the delicate charm of chance.«
20 Fernando Galiano, Dialogues sur le commerce des bleds, Merlin, London 1770.
21 Vgl. Tom Stoneham, Berkeley’s World: An Examination of the Three Dialogues, Oxford University Press, Oxford 2002, 16–30.
22 Vgl. Karin Schlapbach, The logoi of Philosophers in Lucian of Samosata‹, Classical Antiquity 29 (2010), H. 2, 250–277.
23 Rudolf Hirzel, Der Dialog, 2 Bde., Hirzel, Leipzig 1895, Bd. 2, 428.
24 Marcel Proust, La Fugitive [1925], À la recherche du temps perdu III, hg. v. Pierre Clarac u. André Ferré, Gallimard, Paris 1954, 602.
25 George Gordon Byron, Don Juan [1824], III. Gesang, 9. Strophe, The Complete Poetical Works, hg. v. Jerome J. McGann, Bd. V, Clarendon Press, Oxford 1986, 163: »All tragedies are finish’d by a death, | All comedies are ended by a marriage.« Das ist zwar nicht wahr, aber hinreichend für den eng begrenzten Zweck dieser Überlegung.
26 Lukian von Samosata, ›Pros ton eiponta Prometheus ei en logois‹ | ›An den, der mich einen literarischen Prometheus genannt hat‹ [um 170 n. Chr.], Gegen den ungebildeten Büchernarren. Ausgewählte Werke, übers. v. Peter von Möllendorf, Artemis & Winkler, Düsseldorf/Zürich 2006, 74–79.
27 Michael Oakeshott, ›A Conversation‹ [1944], in ders., Notebooks, 1922–86, hg. v. Luke O’Sullivan, Imprint Academic, Exeter 2014, 307–363, 308.
28 Martin Buber, Das dialogische Prinzip [1954], 10. Aufl., Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2006.
29 Homer, Odysseia | Odyssee [8. Jh. v. Chr.], Griechisch – Deutsch, hg. u. übers. v. Anton Weiher, 2. Aufl., Heimeran, München 1961, 8.447–448, 216/217.
30 T. S. Eliot, The Family Reunion, sc. 1, Harcourt, Brace & Co., New York, NY 1939, 21.
31 Baltasar Gracián, Oraculo manual, hg. v. Vincencio de Lastanosa, Blaev, Amsterdam 1659, 199.