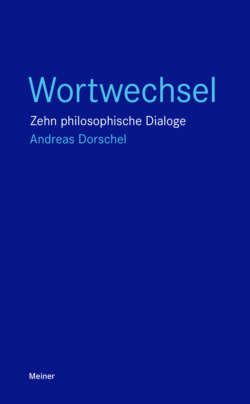Читать книгу Wortwechsel - Andreas Dorschel - Страница 8
ON LE FORCERA Gespräch in Paris
ОглавлениеIm Jahr der Schreckensherrschaft, l’an I de la République française, 1793 gemäß dem Gregorianischen Kalender, hatten sie eines Morgens den Bürger Schlabrendorf, ehemals Gustav Graf von Schlabrendorf, mit Schlägen an die Tür geweckt. Um 5 Uhr früh drangen sie in sein Zimmer ein; Laken und Decken rissen sie von seinem Bett. Zum Ankleiden blieben ihm drei Minuten. Der Anführer des Trupps war einbeinig, einäugig; stolz trug er seine Verstümmelung, gewiß ein Abzeichen der Revolutionskämpfe. »Du bist verhaftet, Bürger. Lang lebe die Vernunft!« herrschte er den Halbwachen an. Dieser wollte etwas erwidern, war jedoch zu matt, den Gegengedanken zu fassen; wie abwesend hatte er den Blick in die Ferne gerichtet, aus der keine Hilfe kam. Man führte ihn ab. Was war denn Vernunft, grübelte Schlabrendorf seitdem, in den Gefängnissen, in die sie ihn nacheinander schleiften, im Kerker der Abbaye, dann in Sainte-Pélagie, schließlich, im Jahr II, zu Beginn des Thermidor, in der Conciergerie. Hier hatte ihn, im siebzehnten Monat seiner Gefangenschaft, die englische Freundin ausfindig gemacht, Mary Wollstonecraft. Ein Rest Freiheit, ein Rest Vernunft: Er durfte sie sprechen.
SCHLABRENDORF: Sie saufen und pissen, sie fressen und scheißen, sie schlafen und schnarchen. Sie fiebern. Sie schwitzen. Sie paaren sich. Sie kommen schreiend zur Welt und krepieren mit aufgerissenen Augen. Tiere! Menschen sind Tiere. Aber, sagen die Denker, der Mensch erhebt sich über das Tier. Was erhebt ihn? Ich sagte es. Er erhebt sich. Doch wodurch? Die Sprache? Haben andere Tiere auch, nach ihrer Art. Die Seele? Ungreifbar. La raison! Sie, wenn irgend etwas, stellt die Menschen höher. Keine andere Kreatur besitzt Vernunft. Und was stellt die einzigartige Kreatur mit ihr an? Sie steckt ihre Mitmenschen zum Verfaulen in ein drekkiges Loch und sagt dazu: »Lang lebe die Vernunft!« Und muß die Vernunft so nicht länger leben als der in ihrem Namen ins Loch Geworfene? Fortdauern bis zum Erbrechen?
WOLLSTONECRAFT: Man kotzt die Welt an, die einen ankotzt.
SCHLABRENDORF: Das verwundert dich?
WOLLSTONECRAFT : Überhaupt nicht. In der Gefangenschaft kommen sich alle Lebewesen abhanden: die Löwen im gräflichen Tiergarten, die Grafen im republikanischen Kerker. Sie verunstalten. Du bist zynisch geworden im Arrest.
SCHLABRENDORF: Eher kynisch.
WOLLSTONECRAFT: Erklär’ dich näher.
SCHLABRENDORF: Ganz einfach: Ich habe eine glänzende Zukunft hinter mir.
WOLLSTONECRAFT: Das Kynische wird mir dadurch nicht klarer.
SCHLABRENDORF: Als Diogenes von Sinope gefragt wurde, wie man ihn begraben solle, sagte er: »Auf dem Gesicht liegend.« Gefragt, weshalb er dies begehre, antwortete er: »Weil in kurzer Zeit das Unterste zuoberst gekehrt werden wird.«
WOLLSTONECRAFT: Ein Wort der Hoffnung?
SCHLABRENDORF: Hoffnung? Für Todgeweihte? Für Tote?
WOLLSTONECRAFT: Die Anekdote ist aus dem sechsten Buch des Diogenes Laërtios; lerntest du sie im Gymnasium?
SCHLABRENDORF: Früher, auf Schulen und in der Stube, hörte und las ich wohl auch Philosophie, aber gelernt habe ich sie erst in den Gefängnissen der Republik. Und die Methode in dieser Hochschule der Weisheitsliebe war in der Tat so ungemein zweckmäßig, daß es mir und meinen Mitgefangenen, oder Schulkameraden, schwergefallen wäre, nichts zu lernen.
WOLLSTONECRAFT: So vor den Kopf gestoßen kann nur sein, wer denselben lange sehr hoch trug. Denn das ist die Malaise der Deutschen, sobald ihnen ›die Vernunft‹ zu Kopfe steigt. Ratio, ragione, razón, raison, reason – das war und ist in Rom, Madrid, Paris, London eine nüchterne Sache. Etwas Handliches. Das Drehen und Wenden des Gegenstandes, bis alle seine Seiten erkannt sind, das Folgern aus Beobachtetem, das Hin und Her von Argument und Einwand – nur darum geht es, wo räsonniert wird. So denkt Europas Westen. Und die Deutschen? Wen man in ihren Ländern ›zur Raison bringt‹, der hört keine Überlegungen. Wer unter Teutonen ›endlich Vernunft annehmen‹ soll, vernimmt in diesem Ausdruck die Drohung. Ein Schritt weiter, und es geht bereits um Leben und Tod.
SCHLABRENDORF: Eben das, beim heiligen Jakob, dem Schutzpatron der Kettenschmiede, scheint eher mein französisches Schicksal zu sein als mein deutsches.
WOLLSTONECRAFT: In deutschen Landen gelangt der Fortschritt immer etwas später an als anderswo, dann aber desto gründlicher.
SCHLABRENDORF: Die Sache in die Zukunft zu verlegen, da du eben noch von Gegenwärtigem sprachst, ist ein schlauer Dreh. Aber ich glaube dir deine unberauschten Franzosen nicht. War es denn nüchternes Volk, das wir rasen sahen auf den Straßen von Paris? War es nicht vielmehr, wie wir mit Verwunderung und Grausen erlebten, trunken vor Vernunft?
WOLLSTONECRAFT: Zugestanden. Massen sind sich selten darüber im Klaren, wofür sie sich einsetzen – oder einsetzen lassen. Doch du wirst einräumen müssen, daß ihr Deutschen Vernunft weit über das erhebt, was Briten und Franzosen das Räsonnieren nennen. Eure Sprache verbucht ja auch den Verstand als ein etwas inferiores Vermögen, um der Vernunft auf den Sockel zu helfen. Daher eure hohen Erwartungen an sie, daher eure tiefen Enttäuschungen. Enttäuschungen bis zum Ekel.
SCHLABRENDORF: Der Ekel weicht dem aus, wovor er sich ekelt. Ich weiche der Vernunft nicht aus. Ich will ihr ja auf die Spur kommen.
WOLLSTONECRAFT: Dann wärest du im Verhältnis zu ihr immer noch in der ersten deutschen Phase: hohe Erwartungen.
SCHLABRENDORF: In London belehrtest du mich, die Emanzipation der Weiber, für dich ein Gebot der Vernunft, könne zur Perfektion des Menschengeschlechts beitragen. Vervollkommnung – gibt es eine höhere Erwartung? Eine gefährlichere? Denn nichts ist gefährlicher, als das graue Ungeheuer der Volksansicht anzugreifen.
WOLLSTONECRAFT: Das allerdings habe ich früh geübt. Vater und Mutter forderten, ich solle mich ihren Befehlen ohne Wenn, ohne Aber unterwerfen – Befehlen, die oft genug miteinander unverträglich waren. Etwas in mir lehnte sich von Anfang an dagegen auf. Das Wort ›Vernunft‹ kannte ich noch gar nicht, aber sie selbst lernte ich in diesem Widerstand kennen. Sie wuchs durch den nötigen Kraftaufwand, dehnte sich gegen die Eltern aus und rieb sich dann an dem, was du die Volksansicht nennst. Ich bin aus diesen Reibereien immer nur gestärkt, ohne Enttäuschungen hervorgegangen.
SCHLABRENDORF: Deinen Frohsinn bewundere ich. Als rundum zufriedenen Insassen dieser Anstalt kann ich mich nicht präsentieren. Meine Stimmung hier pflegt eher flau zu sein. Und das, obschon wir Deutschen im Westen Europas auch als besonders gemütliches Volk gelten. Einer solchen Eigenschaft sollte zwar bloße Haft kaum etwas anhaben können, …
WOLLSTONECRAFT: … aber sie hat, wie ich sehe, dein Gemüt arg strapaziert. Ein strapaziertes Gemüt wird ungemütlich. Schmerz und Vernunft sind füreinander Gift. Und da ein Gefangener im Bezirk des Schmerzes steht, selbst wenn man ihn nicht foltert, bist du der Vernunft gegenüber vermutlich befangen.
SCHLABRENDORF: Im Gegenteil. Wenn wir die Vernunft nicht länger parteiisch sehen wollen, wie es die Kalten, die Indifferenten, die Bureaucraten der Rationalität tun, müssen wir durch den Schmerz hindurch. Du auch. Wir bemerken dann, die Vernunft betreffend, einen Widerstreit, der mir jedenfalls keine Ruhe mehr läßt.
WOLLSTONECRAFT: Und der wäre?
SCHLABRENDORF: Als vernünftig, sagten die philosophes, sollte gelten, wohin man auf vernünftigem Wege gelangte, durch freies Erörtern und öffentliche Kritik. Jetzt haben wir eine politische Ordnung, die sich auf die Vernunft der philosophes beruft, und nichts gefährdet einem so sehr den Kopf wie freies Erörtern und öffentliche Kritik. Kannst du dir einen Reim auf diese ungereimte Wirklichkeit machen?
WOLLSTONECRAFT: Ça ira. Es gibt keine klarere Sache auf der Welt als die Vernunft.
SCHLABRENDORF: Mich verwirrt keine Sache mehr als sie.
WOLLSTONECRAFT: Sie wird es nicht mehr, wenn du selbst mit Vernunft zur Sache – der Vernunft nämlich – schreitest.
SCHLABRENDORF: Gern; ich habe mich hier in der Conciergerie ja spezialisiert auf aussichtslose Angelegenheiten.
WOLLSTONECRAFT: Dann schreite.
SCHLABRENDORF: Wie macht man das?
WOLLSTONECRAFT: Erster Schritt: Was wird der Mensch im natürlichen Zustand wollen?
SCHLABRENDORF: Welchen Menschen meinst du?
WOLLSTONECRAFT: Den Menschen an sich.
SCHLABRENDORF: Hat sich mir bisher noch nicht vorgestellt.
WOLLSTONECRAFT: Man muß ihn sich vorstellen.
SCHLABRENDORF: Und warum gerade im natürlichen Zustand?
WOLLSTONECRAFT: Weil, wenn man die Sache so angeht, alle Vorurteile aus dem Spiel bleiben. Auf diese Weise gelangt man zu vernünftigen Resultaten. Was also wird er wollen?
SCHLABRENDORF: Da er sich mir nicht vorstellt, vielmehr ich ihn mir vorstellen soll, muß ich von mir selber ausgehen. Dann lautet die Antwort: gebratene Wachteleier. Sie waren schon mit zwei Jahren, damals in Schlesien, meine entschiedene Vorliebe.
WOLLSTONECRAFT: Vorlieben sind für den Willen, was Vorurteile für den Verstand sind.
SCHLABRENDORF: Also etwas Unvermeidliches.
WOLLSTONECRAFT: Diogenes verachtete Delikatessen.
SCHLABRENDORF: Idiosynkrasien sind wichtiger als Idole.
WOLLSTONECRAFT: Du wirst allmählich seltsam.
SCHLABRENDORF: Ich bin seltsam.
WOLLSTONECRAFT: Vernunft ist das Vermögen des Allgemeinen. Um meine Frage zu beantworten, mußt du von dir selber abstrahieren.
SCHLABRENDORF: Soviel beginne ich jetzt von der Vernunft zu ahnen: Sie kratzt.
WOLLSTONECRAFT: Ich muß mir also selbst die Antwort auf meine Frage geben: Im natürlichen Zustand will jeder sich selbst erhalten.
SCHLABRENDORF: Das kann nicht ewig gutgehen.
WOLLSTONECRAFT: In der Tat nicht. Denn ewig lebt kein Mensch, sondern, wenn es hoch kommt, neunzig Jahre.
SCHLABRENDORF: Wenn es hoch kommt.
WOLLSTONECRAFT: Darum – zweiter Schritt – will der Mensch im natürlichen Zustand noch etwas anderes als sich selbst erhalten.
SCHLABRENDORF: Jetzt vielleicht die Wachteleier?
WOLLSTONECRAFT: Du scheinst nicht sehr geübt darin, dir Gedanken über das menschliche Zusammenleben zu machen.
SCHLABRENDORF: Ich war ein einsames Kind und habe mir ständig Gedanken über das menschliche Zusammenleben gemacht. Schau dir an, wohin mich das gebracht hat.
WOLLSTONECRAFT: Jetzt redest du immer noch wie ein Kind. Oder wieder.
SCHLABRENDORF: Oft wird kindisch, wem der Tod nahe tritt.
WOLLSTONECRAFT: Der Tod sei fern. Doch mit so wenig Vernunft, wie du sie bisher, das menschliche Zusammenleben bedenkend, an den Tag gelegt hast, kommst du nie mit der Vernunft ins Reine.
SCHLABRENDORF: Daß sie etwas Unreines sei, war schon eine Weile mein Verdacht. Höre etwa Sarastros Verse von der Vernunft: »Wen diese Lehren nicht erfreu’n, | Verdienet nicht ein Mensch zu sein.« Ein unreiner Reim. Für einen reinen müßte es entweder »erfrei’n« oder »seun« heißen.
WOLLSTONECRAFT: Von einem Baß gesungen klingt »seun« besser als »erfrei’n«. Bässe singen die schönsten Us, sogar im Diphthong. Was macht man übrigens mit denen, die ein Mensch zu seun nicht verdienen?
SCHLABRENDORF: Zauberflöte, letzter Auftritt, Königin, Mohr: »Wir alle gestürzet in ewige Nacht.« Sie versinken. Die Opernbühne hat zu diesem Zweck ein Loch. Sarastro besaß noch kein Fallbeil. Die Guillotine versieht das Geschäft ohne Melodrama.
WOLLSTONECRAFT: Aber mit Vernunft?
SCHLABRENDORF: Ich denke, also bin ich, lehrte der Denker der Vernunft im vorigen Jahrhundert. Im jetzigen muß es heißen: Ich denke, und schon bin ich nicht mehr.
WOLLSTONECRAFT: Hat nicht auch die Revolution ihren Denker?
SCHLABRENDORF: Ihr Kopfarbeiter nickt mit dem Kopf dem Köpfen zu. Mit den Worten, die er spricht, kriecht er sodann in den Arsch der Taten.
WOLLSTONECRAFT: Dann wird man sie schlecht vertonen können.
SCHLABRENDORF: Wir leben in einer Zeit, die für die Oper wenig hergibt. Und wir sterben auch in einer solchen Zeit. Es ist der kälteste, platteste Tod, ohne mehr Bedeutung als das Durchhauen eines Kohlhaupts oder ein Schluck Wassers. Doch wir schweifen ab.
WOLLSTONECRAFT: Nicht ganz; sterben muß man sowieso, auch im Naturzustand. Da die Natur der Selbsterhaltung die Grenze setzt, die man Tod nennt, will der Mensch im natürlichen Zustand ferner noch sich vermehren.
SCHLABRENDORF: Wie schön, daß es den Menschen an sich als Mann und Frau gibt. So kann ich ihn mir besser vorstellen. Ihn oder sie.
WOLLSTONECRAFT: Schön ist dieser Umstand besonders für den Mann, denn die Lasten der menschlichen Vermehrung hat die Natur recht ungleich auf die beiden Geschlechter verteilt.
SCHLABRENDORF: Die Natur hat versäumt, den Diskurs über die Gleichheit zu lesen. Sehr unvernünftig von ihr.
WOLLSTONECRAFT: Die Tatsache der Ungleichheit und das Recht der Gleichheit gehören zusammen. Wäre die Gleichheit Tatsache, dann hätte ein Recht der Gleichheit keinen Sinn.
SCHLABRENDORF: Mann und Frau, unterschiedlich involviert, erhalten und vermehren sich also. Könnte das nicht ewig so weitergehen?
WOLLSTONECRAFT: Diese Frage führt uns zum dritten Schritt. Aus den Trieben, sich zu erhalten und sich zu verbinden, ergibt sich nur ein enger Kreis: die Familie. Zur Frage, wie es nun weitergeht, weiß ich meinen Locke auswendig: »The only way whereby any one devests himself of his Natural Liberty, and puts on the bonds of Civil Society is by agreeing with other men to joyn and unite into a community, for their comfortable, safe, and peacable living one amongst another.« Der größere Zusammenhang, Gesellschaft und Staat, bedarf eines neuen Arrangements zwischen den Menschen.
SCHLABRENDORF: Und nun kann selbst ich mir zusammenreimen, es werde ein vernünftiges Arrangement sein müssen.
WOLLSTONECRAFT: Die Individuen werden einen Vertrag schließen.
SCHLABRENDORF: Gibt es nicht auch unvernünftige Verträge?
WOLLSTONECRAFT: Alle, in denen man übervorteilt wird. Und so wird jeder nur einem Vertrag zustimmen, der ihm selbst die Rechte erteilt, die alle anderen genießen.
SCHLABRENDORF: Gleiche Rechte. Ich sehe: égalité. Das Prinzip der Revolution.
WOLLSTONECRAFT: Vernünftig ist, was sich rechtfertigen läßt. Ein Prärogativ kann man nicht rechtfertigen, man kann es nur mit Gewalt behaupten gegen all die, welche nicht in seinen Genuß kommen. Warum sollte jemand Vorrechten zustimmen, etwa jenen, deren sich der alte Adel erfreute?
SCHLABRENDORF: Die von Schlabrendorfs zum Beispiel. Ich empfing eine privilegierte Erziehung. Sonst wäre ich kaum in der Lage, deiner Vorlesung über gleiche Rechte zu folgen. Es fällt mir selbst mit diesem Vorzug schwer genug.
WOLLSTONECRAFT: Manches geht uns schwer ein, nicht, weil wir es kaum verstehen können, sondern weil wir es kaum verstehen wollen.
SCHLABRENDORF: Für die wahre Einsicht in die Beschaffenheit der Vernunft würde ich sogar auf Wachteleier nach schlesischer Art verzichten.
WOLLSTONECRAFT: Da sie auf dem Speiseplan dieser Anstalt fehlen, wird deine waghalsige Behauptung nicht auf die Probe gestellt.
SCHLABRENDORF: So glaubst auch du nicht mehr an ein Leben nach der Conciergerie?
WOLLSTONECRAFT: Verzeih mir. Aber dein Zynismus steckt an.
SCHLABRENDORF: Kynismus. Und er hat dich bislang nicht genügend angesteckt.
WOLLSTONECRAFT: Die Diagnose macht sich woran noch gleich fest?
SCHLABRENDORF: Nach deiner Beweisführung verwirklicht die Revolution, die unter anderem auch diese Stätte jenseits jedes »comfortable living« betreibt, die Vernunft. Und da sind wir eben bei meiner Schwierigkeit zu verstehen. Vernünftig ist die Ordnung der Gleichheit. Allerdings darf der Einbeinige mich Zweibeiner verhaften, nicht aber ich ihn. Kyniker räumen allenfalls Vierbeinern Vorrechte ein. Wenn sie danach bellen.
WOLLSTONECRAFT: Der Einbeinige würde dir sicher antworten, daß zwar alle gleich seien, du aber etwas gegen die Ordnung der Gleichheit unternahmst oder sagtest oder jedenfalls dachtest; deshalb müsse er dich ungleich behandeln und ins Gefängnis werfen. Es geschehe ja alles nur, um die Ordnung der Gleichheit zu retten.
SCHLABRENDORF: Die Beseitigung alter Ungleichheit schafft Platz für neue.
WOLLSTONECRAFT: So würde es der Einbeinige nicht sagen.
SCHLABRENDORF: Nein, so würde er es nicht sagen. So sage ich es. Er würde vermutlich sagen, aus Liebe zur Menschheit müsse er gegen deren Feind vorgehen.
WOLLSTONECRAFT: Das würde er vermutlich sagen.
SCHLABRENDORF: Glaubst du es auch?
WOLLSTONECRAFT: Ich glaube es nicht, aber die Logik ist zwingend.
SCHLABRENDORF: Ja, zwingend. »Ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre.« Robespierre hat stets ein Exemplar des Contrat social auf seinem Tisch. Und es bezeichnet den Verlauf der Revolution, daß der Gerechte, der Mann der Phrase, seine elf Kollegen im Wohlfahrtsausschuß, vorwiegend Männer der Tat, in den Schatten stellt. Keine Tat ist so schlecht, daß man nicht gute Gründe für sie auftreiben könnte. Sie aufzutreiben ist die unverzichtbare Gabe und Aufgabe des Manns der Phrase, pardon, des Anwalts der Vernunft.
WOLLSTONECRAFT: Nun bin ich etwas verwirrt. Wo stehen wir mit unserer Erörterung?
SCHLABRENDORF: Das Zwischenergebnis scheint mir, daß die Vernunft zu unvernünftigen Resultaten führen kann. Und zwar zwingend. Ganz so, wie die Freiheit exekutiert wird von einem Mechanismus, der machine politique, wie Lazare Carnot die Revolutionsregierung nannte, und wie der Comité de Salut public, dem Carnot angehört, die Plagen mehrt, damit die allgemeine Wohlfahrt gedeihe. In deiner Sprache, mit Hamlet: »This was sometime a paradox, but now the time gives it proof.« Das zeitgemäße corpus delicti der vernünftigen Beweisführung bin, unfrei und geplagt, ich selber.
WOLLSTONECRAFT: Deine Darlegung wäre, falls sie denn bündig ist, wert, sie der Menschheit zu überliefern. Gerade ein Deutscher sollte, wie Luther, sein Tintenfaß auf den Leibhaftigen werfen, sonst verschwindet er nie.
SCHLABRENDORF: Den Teufel regten Luthers hundert Bücher nur zu hundert neuen Teufeleien an. Die protestantischen ergänzen seither die katholischen. Von mir sind keine papierenen Werke zu erwarten. Sie kämen auch niemals an gegen jene, die machine politique, Comité de Salut public usw. erzeugen. Verwaltung ist erstarrte Politik: zu Akten erstarrte.
WOLLSTONECRAFT: Dabei wüßte ich bereits einen originellen Titel für dein zu schreibendes Buch: Dialektik der Aufklärung. Oder, wenn es etwas populärer ausfallen soll: Logik für Teufel.
SCHLABRENDORF: Falls das originelle Vorschläge sind, bedanke ich mich, aber meine Werke sind meine Gespräche. In ihnen verschenke ich mich.
WOLLSTONECRAFT: Der Aristokrat schenkt und raubt. Keinesfalls rafft er sich, wie der Bürger, dazu auf, zu arbeiten, zu kaufen und zu verkaufen. Das ist ihm zu vernünftig.
SCHLABRENDORF: Wohl wahr. Weder raffe ich, noch raffe ich mich auf. Ich kenne meine Schwächen.
WOLLSTONECRAFT: Und willst damit sagen, sie seien Stärken. Reden wir uns also weiter durch diese Bescherung hindurch: Haben wir den paradoxen Vorgang mit dem Gesagten schon erklärt?
SCHLABRENDORF: Die Vernunft wäre nicht, was sie ist, ohne den Anspruch auf Zustimmung. Ein Mensch, der die Vernunft auf seiner Seite hat, wie jener Einäugige, kann sich kaum vorstellen, daß man ihm nicht zustimmt, es sei denn aus Dummheit oder Bosheit ; gegen beide hat er Maßnahmen parat: Erziehung oder Strafe.
WOLLSTONECRAFT: Nun abstrahierst du zu resolut. Wie verwirklicht sich solche Vernunft in dem, der dich bestraft?
SCHLABRENDORF: Nicht schwer zu erschließen. Daß er ein Krüppel an seinem Leib ist, macht ihm keine Schande ; Schande liegt darin, daß er sich zu einem Krüppel des Geistes gemacht hat. Er findet seinen furchtbaren Trost darin, immer mehr Tote um sich zu sehen. Denn der Krüppel besitzt etwas, das der Tote nicht mehr hat: Leben. Dieser Trost ist die Vernunft des Einäugigen, eine einäugige Vernunft. Je mehr Tote sich häufen, desto weniger Stimmen widersprechen ihr, und ihm. Darum bricht er aus in sein Totschlagwort: »Lang lebe die Vernunft!« Du verstehst: Die Extreme – Tod und Leben – berühren einander; doch diese Berührung ist Schlag, ein Anschlag des Todes auf das Leben.
WOLLSTONECRAFT: Das Motiv des Fanatikers wäre also Rache am Leben?
SCHLABRENDORF: Des Fanatikers der Vernunft, ja. Aber dies Motiv bliebe ohne Folgen, würden keine Konditionen walten, die dem Mann Gelegenheit bieten, es auszuleben. Er, die andern der Dummheit oder der Bosheit verdächtigend, mag selber dumm sein, er mag böse sein oder auch nicht – das spielt kaum eine Rolle. Ist die Situation nicht danach, vermag Dummheit oder Bosheit wenig auszurichten. Das Verkehrte auf der Welt geschieht, weil die Situation verkehrt ist. Und ist sie es, dann geschieht es notwendig.
WOLLSTONECRAFT: Strenge Konsequenz: Da es dem Einäugigen nicht gelang, dich für dumm zu halten, traf dich seine Strafe.
SCHLABRENDORF: Sie erspart mir seine Erziehung.
WOLLSTONECRAFT: Zwei Weisen, den Dissens auszuräumen.
SCHLABRENDORF: Mit einem Haufen einander mehr oder minder widerstreitender Leute, wie man sie an jeder Straßenecke findet, oder vor dem Terror fand, begnügt Vernunft sich nicht. Sie will nicht weniger als: sie umfassen. Gemeinschaft ist ihr Ideal.
WOLLSTONECRAFT: Wäre das aber in Wahrheit nicht etwas Gutes: einem Ideal zu folgen, statt das Reale nur so hinzunehmen?
SCHLABRENDORF: In jeder Revolution gibt es noch etwas Fürchterlicheres als den Kampf, der ihr Ideal zu realisieren sucht, und das ist ihr Sieg, der es realisiert. Ich fürchte, der Schrecken, inmitten dessen wir uns wiederfinden, ist eben das real gewordene Ideal der Revolution.
WOLLSTONECRAFT: Gibst du Vernunft als Prinzip der Politik auf, welches willst du dann an seine Stelle setzen ? Etwa Unvernunft? Absurdität? Wahnsinn?
SCHLABRENDORF: Mit der Realität der Vernunft hat es eine eigentümliche Bewandtnis. Ihre Ideale, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sind nicht Zustände, die, wie der Wasserstand an der Marke des Meßbechers, irgendwann erreicht wären. Man kann ihnen nie Genüge tun. Deshalb läßt sich immer mehr von ihnen fordern, und es findet sich, wie die Revolution zeigt, auch immer eine Schar, die Nutzen daraus zieht, mehr von ihnen zu fordern – mehr bis zur Absurdität, auch zur gewaltsamen. Ihre Ansprüche zehren von innen jedes Verhältnis auf, in das sie eingeführt werden. Es handelt sich nicht um Absurdität statt Vernunft, sondern um jene als Konsequenz dieser.
WOLLSTONECRAFT: Weißt du ein Korrektiv gegen einen Fanatismus der Vernunft?
SCHLABRENDORF: Die Vernunft ist wenig wert ohne etwas, das nicht Vernunft ist; sie muß auch lachen können, wie in Sokrates’ Ironie den Sophisten gegenüber. Und, wichtiger noch: wie in Sokrates’ Ironie sich selbst gegenüber.
WOLLSTONECRAFT: An diesen Gefängnisinsassen wirst du nicht herankommen.
SCHLABRENDORF: Ich weiß. Darf ich aber, statt auf deine Fragen geradewegs zu antworten und statt, gleich dir, etwas aus Begriffen zu konstruieren, eine Geschichte erzählen?
WOLLSTONECRAFT: Gerne, falls sie gut ausgeht. Es wäre zu traurig, im Kerker zu sitzen, wo so vieles schlecht ausgeht, und dann auch noch eine Geschichte zu erzählen oder zu hören, mit der es sich ebenso verhält.
SCHLABRENDORF: John Locke zu lesen gewöhnt einen ja an Optimismus. Für den guten Ausgang werde ich also sorgen.
WOLLSTONECRAFT: Das klingt verheißungsvoll.
SCHLABRENDORF: So klang vor kurzem auch das Wort ›Revolution‹
WOLLSTONECRAFT: Ich bin der Verheißung noch nicht ganz entwöhnt. Man kann auf dem rechten Wege irren und auf dem falschen recht gehen. Beginne!
SCHLABRENDORF: Des Adlers und der Schlange war Sarastro überdrüssig geworden. Er war nun bequemer als früher, gemütlicher, auch beleibter. Eines Tages aber überfiel ihn noch einmal, vielleicht zum letzten Mal, der alte Tatendrang. Oder war es gar ein neuer? Wie auch immer – er begab sich an diesem Tag in die Ortschaft Hébécrevon, von der die Geschichte der Menschheit bislang wenig Aufhebens gemacht hatte, und verkündete den Dörflern: »Von jetzt an soll dieses Dorf Communauté de Raison heißen.«
WOLLSTONECRAFT: Spielst du auf den Benennungseifer der Pariser revolutionären Comités an, die sogar die Monate tauften?
SCHLABRENDORF: Fünf Sätze habe ich erzählt und du suchst bereits eine Absicht hinter der Erzählung, um über sie verstimmt sein zu können.
WOLLSTONECRAFT: Weil ich dich kenne.
SCHLABRENDORF: Etwas verdächtig hat noch jeder Tragödiendichter seinen Helden gemacht.
WOLLSTONECRAFT: Es wird eine Tragödie?
SCHLABRENDORF: Ja, aber mit gutem Ausgang.
WOLLSTONECRAFT: Trotz eines verdächtigen Helden?
SCHLABRENDORF: Vielleicht trotz, vielleicht wegen.
WOLLSTONECRAFT: Woran genau würdest du den Verdacht festmachen, den du geweckt hast?
SCHLABRENDORF: Etwas verdächtig ist es doch, daß einer an einen Ort kommt, den er nicht kennt, und als erstes sagt, was dieser ist.
WOLLSTONECRAFT: Es ist des Menschen Vorrecht auf Erden, daß er die Dinge beim Namen nennt. Dann schlagen sie die Augen vor ihm nieder, wenn er sie anruft. Name ist Macht.
SCHLABRENDORF: Nichts anderes wollte ich sagen mit dem Anfang meiner Erzählung.
WOLLSTONECRAFT: Nun kenne ich deine Absicht. Fahr also fort.
SCHLABRENDORF: In der Communauté de Raison zu leben statt in Hébécrevon gefiel den Dörflern; edler als der alte klang der neue Name. Doch der Erleuchtete rief aus: »Ihr müßt euch diesen Namen erst verdienen. Sonst seid ihr seiner nicht würdig.« Die Leute fragten ihn: »Wird es schwierig sein, ihn sich zu verdienen?« Die Frage verschwindet von selbst, wenn ihr sie nicht stellt, dachte Sarastro. Aber er sprach: »Folgt ihr der Vernunft, wird es leicht sein für euch. Ihr dürft nicht meinen, die Vernunft sei etwas im Kopf des einzelnen. Das glaubten die Meister des Denkens früher, doch sie haben sich getäuscht. Die Vernunft ist gleichsam zwischen euch. Logos, das Wort, nannten die Griechen die Vernunft, und das Wort ist euch allen gemeinsam zu eigen. Bindet es euch aber kraft der Vernunft, die in ihm waltet, dann folgt, daß ihr nicht jeder einzeln für sich in den Himmel zu kommen vermögt, wie ihr bisher glaubtet, sondern nur alle gemeinsam. Begeht dein Nachbar Unrecht, so wirst du nicht ins Paradies eingehen.« Der Blick des Mahners schlug durch sie hindurch. Ersichtlich war dies nicht der Zeitpunkt für weitere Erkundigungen. Die Leute sagten: »Wir wollen es glauben um des edlen Namens willen.« Sie boten Sarastro Wein an, um den feierlichen Anlaß zu begehen. Doch er lehnte den Trank ab.
WOLLSTONECRAFT: Es ist wirklich die Geschichte einer Revolution. Vermutlich war Sarastro trunken vor Vernunft.
SCHLABRENDORF: Ich fürchte, er war von gar nichts trunken. Den Wein lehnte er übrigens nur anfangs ab.
WOLLSTONECRAFT: Immerhin. Wie weiter?
SCHLABRENDORF: Seitdem lebte man im Einklang miteinander in Hébécrevon, das nun Communauté de Raison hieß. Jeder der Dörfler fühlte sich verantwortlich für jeden anderen. »Alle für einen, einer für alle«, skandierten die Kinder morgens in der Schule. Die Lehrer, die Eltern, ja zuweilen Sarastro, der Künder, selbst erklärten ihnen, was das bedeutete: »Wenn einer stiehlt, falsch schwört, betrügt, mordet oder den Herrn lästert, tragen die anderen die Schuld mit. Die Vernunft will nichts Halbes, und jeder ist Teil des Ganzen. Das Ganze aber ist nicht besser als sein kleinster Teil. Wie könnte es anders sein? Wie dürfte es anders sein?« Jeder, was immer er gerade tat, mußte an die Gemeinschaft denken. So schien es vernünftig. Und die Gemeinschaft mußte an jeden denken, was immer er tat. Dies allerdings wurde manchen, je länger, desto stärker, unheimlich.
WOLLSTONECRAFT: Unheimlich?
SCHLABRENDORF: Einige waren früher einmal in der großen Stadt gewesen. Mit verhohlenem Neid gedachten die Dörfler nun gelegentlich der Städter. Diese wohnten so nah bei einander und doch so unbehelligt. Der Nachbar fragte nicht nach dem Nachbarn. Der Logos, dessen Grundgestalt die Frage ist, war dort schwach. Gesellschaft eben, nicht Gemeinschaft.
WOLLSTONECRAFT: Auch die große Stadt läßt sich zur Gemeinschaft erheben. Will nicht die Revolution Paris in eine große Brüderschaft wandeln?
SCHLABRENDORF: Das will sie. Deshalb klopfte ja der Einäugige im Jahre I an meine Wohnungstür und fragte nach mir. Aber so fortgeschritten war man zu Sarastros Zeiten in der großen Stadt noch nicht.
WOLLSTONECRAFT: Wäre man es gewesen, dann hätte dies deine Geschichte ja auch der Kontrastfolie beraubt.
SCHLABRENDORF: Kein Erzähler mag es, wenn man mitten in seinem Erzählen dessen Technik zergliedert.
WOLLSTONECRAFT: Muß ich immer Dinge sagen, die du magst?
SCHLABRENDORF: Häftlinge besucht man ihnen zum Trost. Gerade jemand wie du, deren Seele, comme une exception, nicht ungreifbar ist.
WOLLSTONECRAFT: Dann also etwas Tröstliches. Alle Revolutionen lassen sich, so lehrt die Philosophie der Geschichte, als notwendige Folgen eines früheren Stillstandes ansehen, als gewaltsamere Bewegungen, die ein lange unterlassenes Fortschreiten wieder einholen. Sie haben insofern auch immer ein Gutes: Selbst die arge Revolution erspart eine noch ärgere.
SCHLABRENDORF: Einfühlsame Trostworte an den Insassen eines Revolutionsgefängnisses. Geschichtsphilosophie verheizt eben stets das Individuum. Dank der dabei entstehenden Wärme steigt der Heißluftballon der Allgemeinheit desto rascher seiner höheren historischen Bestimmung entgegen. Aber immerhin nimmst du die Taktik meines Fabelns nicht weiter auseinander.
WOLLSTONECRAFT: Fahre also unanalysiert fort.
SCHLABRENDORF: Unbedingt, denn nun folgt die Peripetie. Fremde, zwei Frauen, erwarben ein Anwesen in der Nähe des Weilers. Bislang hatten sie in der großen Stadt gewohnt. Deren Lärms und Getriebes waren sie müde geworden. Die beiden blieben für sich; selten nur kamen sie in die Siedlung. Da sie nicht zur Gemeinschaft der Vernunft zählten, brauchte man sich um sie nicht zu scheren. Doch eines Abends, den Kehricht vors Haus tragend, sah einer seinen Nachbarn zum Hof jener beiden Fremden schleichen. Erschreckt und um die paradiesische Bestimmung der Gemeinschaft besorgt, meldete er den Vorfall dem Dorfältesten. Von Stund an begannen alle Dörfler den Verdächtigen zu beschatten. Der Dorfälteste hatte Ermahnungen an die Türen nageln lassen: Ein jeder Dorfbewohner möge sich seiner Verantwortung bewußt sein. Für die Gemeinschaft.
WOLLSTONECRAFT: Die vernünftige.
SCHLABRENDORF: Alle suchten ihre Ohren zu spitzen; alle mühten sich, die Augen offen zu halten; kaum einer schlief mehr des Nachts. Indes waren manche, die besonders Vernünftigen, eher vigilant als andere, und so gerieten auch die weniger Wachsamen unter den Dörflern in Verdacht. Männer, Frauen, Kinder fingen an, jeden anderen zu bespitzeln. Jeden außer den Propheten, der mitten unter ihnen hauste, einen munteren Briefwechsel mit Pamina pflegte und es sich auch sonst wohl ergehen ließ. Sarastro war ja selbst die Vernunft, und der Vernunft ist nicht zu mißtrauen. Sonst aber ließ sich viel entdecken, nachdem einmal Argwohn aufgeflakkert war. Eine holte etwas mehr Reisig aus dem Wald, als ihr zustand. Ein anderer ließ etwas mehr Wasser, als vereinbart war, auf seinen Acker fließen. Früher hätte man ein Auge zugedrückt oder gar zwei; doch nun stand die Seligkeit aller auf dem Spiel. »Alle oder keiner, im Namen der Vernunft.« Mit dem Argwohn regte sich Angst. Und mit der Angst regte sich Haß. Man spürte eine auf, die schwer gefrevelt haben sollte. Sie zu töten, genügte nicht. Um die Schuld von der Erde zu tilgen, fackelten die besonders Vernünftigen, grimmig begeistert, das Dorf ab. Viele kamen in Rauch und Feuer um. Ein hölzernes Schild, am Rande eingepflockt, verbrannte nicht. Auf ihm war zu lesen: La Communauté de Raison.
WOLLSTONECRAFT : Nun ist die Geschichte doch schlecht ausgegangen.
SCHLABRENDORF: Keine Sorge, sie geht gut aus. Sogar lustig. Rechtzeitig hatte Sarastro für seine Sicherheit gesorgt. Er war, die besten Flaschen Wein vor den Flammen rettend, in die große Stadt gezogen. In den heil’gen Hallen von deren berühmter Universität amtete er als Professor für Sozialphilosophie. Pamina, inzwischen von Tamino geschieden, heiratete Sarastro, auch wegen der Altersversorgung. Die Schlange hatte sich wieder eingefunden und verbrachte ihren Lebensabend im Terrarium der Wohnung. Man schätzte Sarastro allgemein als Kritiker des modernen Individualismus. Wie Rauch, pflegte er zu sagen, verflüchtigt sich der Einzelne ins Nichts; allein die Gemeinschaft, verwurzelt im Logos, bleibt. Pries man ihn seiner Tiefe wegen, so antwortete er bescheiden: Ich bin, was meine Erfahrungen aus mir gemacht haben. Vom Himmel sprach er jetzt nicht mehr. Als geachteter Wissenschaftler, der er nun war, fand er andere Worte dafür. Exzellenz zum Beispiel. Oder Drittmittel. Sein liebstes aber blieb: Vernunft.
WOLLSTONECRAFT: Nun könnte es damit weitergehen, daß die Schlange Pamina in Versuchung führt.
SCHLABRENDORF: Hat mein Schluß dich enttäuscht?
WOLLSTONECRAFT: Das nicht. Was für ein Opernfinale hätte Mozart aus ihm machen können! Am Ende unterlegt eine C-Dur-Kadenz mit Harfenglissandi die beiden Silben »Vernunft«.
SCHLABRENDORF: Mozart mochte die Harfe nicht.
WOLLSTONECRAFT: Er konnte auch Sarastro nicht leiden. Ist dir je aufgefallen, daß Mozart ihm, laut Schikaneder der erhabensten Gestalt des Dramas, so einfache Strophenlieder zuweist wie Papageno, dem angeblichen Simpel? Nur sind sie weit langweiliger als jene Papagenos.
SCHLABRENDORF: Desto besser, daß du meine Geschichte kurzweilig fandst.
WOLLSTONECRAFT: Allerdings verleiht Kurzweil noch lange keine philosophische Dignität. Jeder bringt eine Geschichte zusammen, die sich den eigenen Behauptungen fügt. Zähltest du nicht vor zwanzig Jahren zu den Bundesbrüdern des ›Hains‹? »Üb’ immer Treu und Redlichkeit | Bis an dein kühles Grab, | Und weiche keinen Finger breit | Von Gottes Wegen ab.«
SCHLABRENDORF: In Revolutionszeiten sind sogar die Gräber heiß. Und Hölty meinte gewiß nicht, es sei unredlich, durch eine Geschichte einzusehen, wie etwas wirklich beschaffen ist.
WOLLSTONECRAFT: Nein, so gewissenhaft war er noch nicht. Es ist eher so, daß ich mir dies von dir verspreche, zwanzig Jahre nach den Schwärmereien des ›Hains‹.
SCHLABRENDORF: Was ich dir vortrug, war nur eine Fabel, aber sieh’ dich hier um und du hast die Probe auf ihre Wahrheit vor dir. Du kannst sie ertasten an diesen Mauern, sehen im altbackenen Brot in diesem Blechnapf, riechen am Kot der Ratten in den Ecken dieses Baus.
WOLLSTONECRAFT: So ähnlich sieht es in jedem Gefängnis aus, auch dort, wo Herrscher nicht das Wort ›Vernunft‹ im Munde führen.
SCHLABRENDORF: Die Revolution sollte die absolute Freiheit hervorbringen. Aber keine Tat eines Menschen kann die absolute Freiheit schaffen. Damit gerät jede Handlung unter Verdacht. Sie vollbringt nicht die absolute Freiheit; vereitelt sie diese vielleicht? Erst zieht die Tat Argwohn auf sich, dann das Wort, dann der Gedanke – der dem andern unterstellte Gedanke. Auch jedes Nichthandeln gerät unter Verdacht; denn wen soll es decken, was soll es vertuschen? Verdächtigwerden heißt hier Schuldigsein ; wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Nichts weckt stärkeren Argwohn als eines Menschen Beteuerungen. Vernunft, dazu da, Vertrauen zu stiften – die Gründe darzulegen, warum wir etwas tun –, setzt unter solchen Umständen unentwegt Mißtrauen aus sich heraus. »Wer zittert, ist schuldig«, pflegt Robespierre zu sagen, wenn er wieder jemanden denunziert hat. Irgendwann begannen alle zu zittern. Freilich kann man nicht alle guillotinieren, insbesondere Sanson, den Henker, nicht. Also verhaftet und tötet man nach Willkür. Die Vernunft verbürgt es: Nur die Toten kommen nicht wieder.
WOLLSTONECRAFT: In deinem Reden werden Vernunft und Gewalt eins. Aber du weißt so gut wie ich, daß sie nicht eins sind. Es gibt in der Welt manchmal die Parole ohne den Schlag, manchmal den Schlag ohne die Parole, und, allerdings, manchmal die Parole gefolgt vom Schlag. Die Vernunft des Einäugigen siegt, weil sie die Gewalt auf ihrer Seite hat. Doch was etwas auf seiner Seite hat, bleibt immer noch verschieden von ihm. Die Vernunft des Einäugigen siegt, aber sie überzeugt nicht. Überzeugte sie, dann bräuchte sie die Gewalt nicht. Noch der Einwand gegen den Terror im Namen der Vernunft hat Vernunft nötig.
SCHLABRENDORF: Es geht uns im Gespräch oft so, daß etwas hemmt – anders gesagt: daß das letzte, schlagende Wort nicht herauswill. Wir werden dann ungeduldig. Aber vielleicht ist Schlagen nicht der Beruf der Redenden. Die Hemmung ist womöglich das, was ein Gespräch zum Gespräch macht.
Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Aber wie steht es mit dem Sterben? Aus den überfüllten Gängen der Conciergerie war Geschrei zu hören. Die Fleischerhunde im Hof schlugen an. Sansculotten, mit Piken bewaffnet, hatten das Gefängnis betreten, an ihrer Spitze wiederum ›der ruhmreiche Versehrte‹, wie seine Anhänger ihn nannten, der schmissige Krückengänger, in seiner Hand eine Liste. Vor Schlabrendorf machte er Halt: »Wir führen dich zur Guillotine, Bürger Schlabrendorf. Du hast die Revolution verraten. Ci-devant eben. Lang lebe die Vernunft!« »Kann man zu leben auffordern, was man im selben Moment umbringt?«, entgegnete der Angeredete. Ein Hieb traf Schlabrendorf am Schädel, aber er hielt sich aufrecht. Die Sansculotten und ihr Anführer schritten weiter durch die Zellen; seine Liste war lang. Für den würdigen Gang auf den Richtplatz brauche ich meine Langschäfter, dachte Schlabrendorf, zumal es regnet. Keine Exekution ohne Schuhe, auch das ist Sache der Vernunft. Wo sind sie bloß hingekommen? Ich kann mich nur enthaupten lassen, wenn ich meine Stiefel finde. Doch sie waren nirgends zu entdecken.