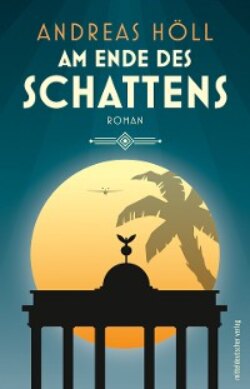Читать книгу Am Ende des Schattens - Andreas Höll - Страница 6
1
ОглавлениеUnmerklich hatte der Novemberhimmel die Farbe gewechselt, vom hellen Grau des Zements zum dunkleren von nassem Beton. Eine minimale Verschiebung des Lichts, als ob jemand einen Regler bediente und die Netzhaut verschattete. Segal Dolphin fiel es schwer, die Augen offen zu halten. Er lag fast waagrecht in seinem Schreibtischstuhl und sah zu, wie das Tiergartenviertel im Nebel verschwand. Unten auf dem Trottoir wurden Kohlen in den Keller geschaufelt. Ein störrisches Geräusch, von langen Pausen unterbrochen.
Er richtete sich auf, fuhr mit dem Zeigefinger über die Tasten der Schreibmaschine, um die Kühle des Metalls zu spüren. Das deutsche Wort Fingerspitzengefühl traf ungefähr seine Empfindung. Mit der Zärtlichkeit eines Pianisten strich er über die Imperial Good Companion, die erst kürzlich in der Berliner Redaktion des Daily Standard eingetroffen war, samt einer Karte mit Grüßen von Lord Bakerfield. Er schätze, so schrieb der Verleger, modernste Technik und – hier hatte er einen raumgreifenden Bindestrich eingefügt – gierige Reporter. Warum dann dieser Anruf?
Aus heiterem Himmel hatte der Lord ihm mitgeteilt, er werde ihn bald nach London zurückberufen und zum Chefkorrespondenten in Westminster machen. »Drei Jahre reichen«, nuschelte er in den Hörer, »Sie müssen etwas Neues kennenlernen.«
Dolphin war wie benommen und wusste nicht, was er sagen sollte. Der Herausgeber deutete sein Schweigen als freudige Überraschung und sprach von dem nächsten Schritt in der Karriere eines jungen Journalisten, für den es nun an der Zeit sei, sich mit der britischen Innenpolitik vertraut zu machen.
»Lord Bakerfield«, brach es schließlich aus ihm heraus, »das geht nicht. Es gibt noch so viel hier zu tun. Kapitale Geschichten. Sie müssen mir vertrauen.«
»Sachte, sachte«, sagte der Verleger nun deutlich kühler, »überschätzen Sie sich nicht.« Er wisse besser, was Dolphins Karriere zuträglich sei. Er halte ihn für ein Talent, doch das bedürfe zunächst einmal der weiteren Ausbildung. Erst Berlin, dann London, und wer weiß, vielleicht gehe es in ein paar Jahren nach New York, Sydney oder Kapstadt. Außerdem habe er schon einen Nachfolger. Einen Doktor der Germanistik, frisch aus Oxford.
»Also, liefern Sie mir noch das Stück über das Kaiser-Wilhelm-Institut, und am ersten Januar sind Sie hier.«
Dolphin holte Luft. »Meine Mission ist noch nicht beendet«, sagte er, ohne zu wissen, woher diese Worte kamen.
»Werden Sie nicht pathetisch, Dolphin.«
Er stand auf und öffnete das Fenster. Mit mechanischen Bewegungen zündete er sich eine Zigarette an und sah lange dem Rauch nach, wie er sich im Grau auflöste.
Um die Reportage über das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik hatte Bakerfield ihn erst vor Kurzem gebeten, und bis jetzt hatte Dolphin sich vergeblich um einen Termin bemüht. Kein Geringerer als Winston Churchill hatte den Lord auf diese Berliner Forschungseinrichtung hingewiesen, als sie, wie er berichtet hatte, über die Malaise der Gesundheitspolitik gesprochen und dabei auch das Problem der Geistesschwachen und Verrückten gestreift hätten, welche ohne Frage Wohlstand, Vitalität und Kraft der britischen Gesellschaft bedrohten. Der Politiker sei sogar so weit gegangen, Segregation und Sterilisierung als unverzichtbar zu bezeichnen, damit der Fluch mit diesen Menschen aussterbe und nicht an nachfolgende Generationen weitergegeben werde. Offenbar verfolge jenes Institut in Berlin eine ganz ähnliche Richtung, um mit gezielter Bevölkerungspolitik die Degeneration des eigenen Volkes abzuwenden. Außerdem hätten die Wissenschaftler im früheren Deutsch-Südwestafrika Mischlinge aus Weißen und Eingeborenen vermessen, um den Einfluss von Umwelt, Erbe und Rasse zu untersuchen, was gleichfalls interessante Erkenntnisse für die britische Kolonialpolitik bringen könne. Und dann hatte er ein zerstreutes good luck in den Hörer genuschelt und aufgelegt.
Dolphin machte das Fenster zu. Der Nebel war so dicht geworden, dass er die Stadt dahinter fast völlig zum Verschwinden brachte. Ebenso gut könnte man in London sein. Doch eines wusste er: Er würde nicht nach London gehen.
Wie immer, wenn Dolphin die Dinge zu entgleiten drohten, beschloss er, sich zu rasieren. Vielleicht war es zu einem Tick geworden, doch ihn verlangte nach jener Form der Konzentration, die das Schweifen der Gedanken mit dem Gefühl der Reinigung verband, und so fuhr er vom Büro in seine Wohnung in der Knesebeckstraße.
Auf dem Weg ins Badezimmer passierte er den Rundfunkempfänger, der auf einer Anrichte thronte. Er zwang sich, einen Moment innezuhalten, schaltete behutsam den Apparat ein. Das Summen der Röhren beruhigte ihn. Und dann vernahm er die Stimme des Ansagers, der das Vormittagsprogramm verkündete.
Während er den Rasierschaum auftrug, wurden vom Flur her Fetzen eines Schlagers hereingeweht. Ja, bei den Hottentotten, sang Efim Schachmeister, da tanzt man den Black Bottom, als Dolphin die Klinge über die Wange zog. Einer strengen Symmetrie folgend, vollendete er erst einen Sektor auf der linken, dann auf der rechten Gesichtshälfte, bis mit jeder Links-rechts-Kombination ein weiteres Stück seiner Haut freigelegt wurde.
Er widmete sich nun seinem Kinn, das Ella besonders männlich fand. Dann betrachtete er die fein geschwungene Oberlippe, die im Kontrast zur Unterlippe durchaus etwas voller hätte ausfallen können. Mit seinem dunklen, leicht gewellten Haar konnte er zufrieden sein.
Jenseits des Spiegels, in den Tiefen des Radioapparats, tanzten die Hottentotten weiter ihren Black Bottom zu den Klängen des Jazz-Symphonie-Orchesters, und als jene Stelle mit den schwarzen Puppen kam, die man beim Tanzen nicht bezuppen darf, klatschte er sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht und griff zu dem Handtuch, das seine Hauswirtschafterin bereitgelegt hatte.
Fräulein Herrmann kam dreimal die Woche, und hinterher war immer alles frisch, duftend und hell, wie die Schleiflackmöbel, die sich Dolphin in einem Anfall von Neusachlich-sein-Wollen hatte aufschwatzen lassen, gleich im Einrichtungsgeschäft um die Ecke. Seitdem überlegte er hin und wieder, wie er das Bauhausartige in seiner Wohnung mildern und ihr mehr das Gepräge eines britischen Gentlemans verleihen könnte. Er hatte bereits Brennholz und Reisig in dem offenen Kamin aufgeschichtet, doch dann begannen die Straßenschlachten und Schießereien, und er entschloss sich, einen alten Kupferstich vor die Öffnung zu stellen, um nicht mehr in das dunkle Loch starren zu müssen.
Das Telefon klingelte. Er schaltete den Rundfunkempfänger aus. Es war Ella, die ihn am Abend treffen wollte.
Als er aus der Haustür trat, schlug ihm dichter Nebel entgegen. Er stellte den Mantelkragen hoch und bewegte sich durch schlierige Streifen und Felder verschwommener Dinge.
Das Licht der Laternen versickerte im Wasserdampf, die Auslagen in den Schaufenstern, die Plakate an der Brand-mauer gegenüber, alles schien hinter einer Schicht aus Glas zu verschwinden. Beim Näherkommen erkannte er einen verblichenen Anschlag, der Das indische Grabmal annoncierte.
Ella mochte exotische Monumentalfilme. Zum Glück fand sie wenigstens an den gemeinsamen Kinobesuchen Gefallen, auch wenn sie sich ansonsten weigerte, mit ihm in das Berliner Nachtleben einzutauchen. Für ihn war es unbegreiflich, wie man den Verlockungen der Varietés oder dem Rausch eines Sechstagerennens widerstehen konnte, wenn sich alles in der Ewigkeit des Augenblicks drehte, bis man am Ende der Nacht auf die seltsamsten Geschichten stieß, die britische Leser interessieren mussten. Ella wollte nichts davon wissen. Sie bestand darauf, mit ihm allein zu sein, wozu auch intime Essen oder die Abende im Lichtspieltheater zählten. Vor allem aber wollte sie reden. Doch was sie zu sagen hatte, kreiste zunehmend um Verlobung, Heirat und Kinder, und vermutlich waren es genau diese Themen, denen Dolphin immer häufiger ausweichen wollte.
Er kam am Milchladen vorbei, sah das Licht durch die Fenster schimmern und freute sich an der Tautologie der Milchglasscheiben. Auf einer war ein Strichmännchen aufgemalt mit der Aufschrift Trink Milch, du Knilch. Und dann hörte er tief in seinem Innern die Stimme des Milchmanns und das Scheppern der Flaschen, wie er es zum ersten Mal vernommen hatte, als er endlich, ein Jahr vor Kriegsende, mit seinen Eltern nach England ausreisen durfte. Die Londoner Geräusche kamen ihm damals, nach all den Kriegsjahren als feindliche Ausländer in Berlin, so unendlich fremd und zivilisiert vor.
Mit einem Mal verlangte ihn nach einem Glas Milch, das er, kaum dass es vor ihm auf der Theke abgestellt worden war, in der atemlosen Art eines Jugendlichen leer trank.
Wie so oft ging Dolphin zum Kiosk am Savignyplatz, wo er die Mittagsblätter kaufte. Sie kamen noch feucht aus der Druckerpresse und rochen nach Petroleum und Neuigkeiten. Mit dem Zeigefinger strich er über eine Schlagzeile und verwischte die Blockbuchstaben. Er konnte nicht sagen, warum er das tat, vielleicht, um sich in einem magischen Akt die Druckerschwärze einzuverleiben, vielleicht war es auch eine Kampfansage an die Konkurrenz.
Er griff in seine Manteltasche, holte ein paar Münzen heraus und bezahlte. Er achtete stets darauf, Kleingeld für den Kriegsinvaliden übrig zu haben, der ein paar Meter weiter auf dem Boden saß und mit dem Rücken am Sockel eines Hauses lehnte. Seinen Beinstumpf hatte er auf die Holzleisten seiner Krücke gelegt, daneben waren auf einer Decke Heftpflaster, Bindfäden, Reißverschlüsse und Sicherheitsnadeln ausgebreitet. Aus Verlegenheit kaufte Dolphin eine weitere Packung Sicherheitsnadeln, die sich nutzlos mit den anderen in der Nachttischschublade stapeln würde.