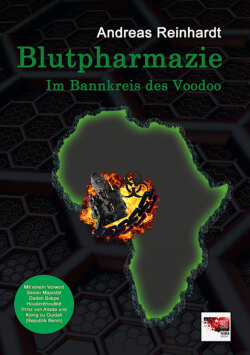Читать книгу Blutpharmazie - Im Bannkreis des Voodoo - Andreas Reinhardt - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 5
Ankunft in Cotonou
- Dr. Djayéola Biassou -
Der „Cadjehoun International Airport Cardinal Bernardin Gantin“ von Cotonou befand sich inmitten der Hauptstadt, wenngleich fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die Fassadenarchitektur des Hauptgebäudes, aus dem Bonifacius Kidjo gerade trat, wirkte mit ihrer dominanten Glasfront und der asymmetrischen Formensprache ansprechend modern. Mehr Charme hatte das Areal hier draußen unter dem Abendhimmel jedoch nicht zu bieten. Weder ein funktional ästhetisches Vordach noch eine großzügig begrünte Fläche mit Palmen erfreuten die Sinne. Auf der anderen Straßenseite schloss sich lediglich ein trister Parkplatz an.
Dem Journalisten ging der Namensgeber des wichtigsten Flughafens des westafrikanischen Landes im Kopf herum, ein vor Jahren verstorbener Würdenträger der römisch-katholischen Kirche. Der Mann war nicht nur Erzbischof von Cotonou gewesen, auch in Rom hatte er eine bemerkenswerte Karriere hingelegt, war im Jahr 1977 von Papst Paul VI. zum ersten dunkelhäutigen Kurienkardinal ernannt worden. Das ließ den Agenten unweigerlich schmunzeln. Ein Sohn Benins, aus dem Schoß des Voodoo, hatte Karriere im Vatikan gemacht. Doch wie hatte schon sein Adoptivvater einmal gesagt, am Tag besuchten die Menschen vielleicht eine Kirche oder Moschee, doch nach Sonnenuntergang gehörten sie ganz ihren noch älteren Göttern. Man war tolerant und flexibel genug, wenn es darum ging, beides zu leben.
Genießerisch nahmen seine Sinne alles in sich auf. Es war wie die Umarmung eines geliebten und lange vermissten Menschen. Bestimmt schon ein Dutzend Mal war Bonifacius in Benin gewesen. Das erste Mal hatte ihn sein Ziehvater hierher mitgenommen, kurz nachdem der damals Sechzehnjährige die leiblichen Eltern durch ein Zugunglück verloren hatte. Bei seiner Ersatzfamilie, in einem Dorf nordwestlich der Stadt Abomey, hatte seine Seele trauern können und er den tiefen Sinn und die Bedeutung des Todes zu verstehen gelernt. Den Traditionen entsprechend, hatte man ihn den Ahnen der Familie vorgestellt und um Aufnahme des neuen Familienmitgliedes in die Gemeinschaft gebeten. In Gedenken daran hielt der Journalist das damals erhaltene Amulett um seinen Hals fest umklammert. Er war kein praktizierender Anhänger etwa des Voodoo, war nicht in alle Aspekte eingeweiht. Nichtsdestoweniger respektierte er die Traditionen seiner zweiten Familie, hatte Hochachtung vor der Jahrtausende alten Geschichte dahinter. Es hatte keinerlei Überwindung oder außerordentlicher Anpassung bedurft, war er doch selbst ein spiritueller Mensch, ohne dabei im Korsett einer einzelnen Religion gefangen zu sein.
Von der unsortierten Ordnung oder auch disziplinierten Unordnung einer westafrikanischen Großstadt spürte man in unmittelbarer Flughafennähe wenig. Die Anzahl an Passanten hielt sich in überschaubaren Grenzen. Hier dominierten gedeckte Töne die Farbenpracht, dezente Bewegung das hektische Pulsieren. Und so fiel es ihm auch nicht schwer, die angekündigte Missionspartnerin auszumachen, die ihn aus einiger Entfernung beobachtete. Als hätte Dr. Biassou seine Gedanken die ganze Zeit über mitgelesen, schien sie geduldig abzuwarten, um ihm Zeit zu lassen. Aber naheliegender war wohl, dass sie sich ein erstes Bild von „Shango“ machen wollte, so wie er sich von ihr jetzt. Selbst auf einem der überfüllten Märkte hätte man diese Frau nicht übersehen können. Ihr Alter entsprach in etwa dem seinen. Mit annähernd einem Meter achtzig überragte sie vermutlich die meisten Männer Benins. Das hell erdfarbene Kleid aus feiner Naturfaser, welches weit geschnitten auch Schultern und den größten Teil ihrer Oberschenkel bedeckte, wurde komplettiert von einem ledernen Gürtel in braun mit kunstvoll graviertem Verschluss aus Gold. Um Füße und Waden schmiegten sich leichte, aber robuste Schnürsandalen. Und es war wohl nicht nur dieser tiefe Ernst, der ihre einzigartige Aura ausmachte. Keiner der offenkundig Einheimischen blickte sie direkt an oder wagte es gar sie anzusprechen. Vielmehr wurde überraschend großer Abstand gehalten.
Als Dr. Djayéola Biassou schließlich mit aristokratischer Würde auf ihn zuschritt, hatte Bonifacius wiederholt das unbestimmte Gefühl des Wiedererkennens.
»Willkommen in Benin, „Shango“, es ist mir eine Ehre«, fiel die Begrüßung knapp aus, und selbst das Beugen ihres Hauptes ließ jede Herzlichkeit vermissen.
Er nahm es sportlich, machte aus seiner Faszination kein Geheimnis, was ein gewinnendes Lächeln belegte: »Die Ehre ist ganz auf meiner Seite.«
Doch die herbe schwarzafrikanische Schönheit entsprach ganz dem spröden Eindruck der Fotografie. Seine Charmeoffensive lief entgegen aller gewohnten Erfahrungen mit Frauen ins Leere: »Wir fahren ins Hotel. Es liegt ganz in der Nähe des Pharmaunternehmens ERHC. Das spart uns morgen Zeit im Verkehr. Für den Vormittag ist dort ein Interviewtermin mit dem Geschäftsführer und eine Laborbesichtigung vorgesehen. Ich begleite dich ganz offiziell als Mitarbeiterin des Gesundheitsministeriums, die dir für deine journalistischen Recherchen zur ausgebrochenen Epidemie zur Seite gestellt ist.«
Du bist wirklich eine harte Nuss, was? Na wenigstens sind wir gleich beim Du gestartet, wenn du schon kein Lächeln zustande bekommst. Ist es dir in deiner Organisation nicht gestattet, menschliche Gefühle zu zeigen? Man könnte fast meinen, du wärst eine … – Nein, das ist nicht war, oder?! Aber klar, du könntest glatt aus meinem letzten Albtraum entsprungen sein. Eine Amazone? Ich glaube, langsam schnappe ich über. Die sind doch schon vor einer Ewigkeit zu Staub zerfallen. – Komm schon, Bonifacius, vergiss den Quatsch. Vielleicht gehört Herzlichkeit nur nicht zum Repertoire von Frau Doktor. Oder du bist einfach nicht ihr Typ.
Während die promovierte Mikrobiologin den robusten SUV souverän durch den chaotischen Verkehr der Innenstadt steuerte, nutzte der Beifahrer die Chance, sie weiter zu betrachten. Die Sache mit der Amazone ließ ihm einfach keine Ruhe.
»Willst du mich etwas fragen?«, eröffnete die neue Partnerin das Gespräch, ohne die Augen von der Straße abzuwenden.
In genau dem Moment wurde ihm klar, dass diese Frau rein gar nichts beiläufig oder unbeabsichtigt tat. »Ja, will ich tatsächlich. Du kennst meinen Codenamen. Selber scheinst du keinen zu haben. Jedenfalls ist er mir nicht bekannt. Finde ich ungewöhnlich für die Angehörige einer Geheimgesellschaft im Außeneinsatz.«
»Mein geheimer Name ist mein Intimbesitz. Wer ihn kennt, hat eine machtvolle spirituelle Waffe gegen mich in der Hand. Ich müsste diese Person für immer zum Schweigen bringen.«
Seine Antwort darauf war der Reflex eines Mannes zwischen Unsicherheit und Unglauben. Schließlich konnte er einen humorvollen Hintergrund wohl getrost ausschließen: »Alle Achtung, eine Meisterin der klaren Ansage.«
Überraschung kam hinzu, als er erstmals ein flüchtiges Lächeln wahrnahm – allerdings dermaßen flüchtig, dass man es leicht für eine Sinnestäuschung hätte halten können. Und das Gesagte hatte durchaus einen wahren Kern. Für die Priester und Zauberer des Voodoo war der persönliche Eigenname eines Menschen besonders lebenskrafthaltig, somit gleichsam ein Einfallstor für Magie. Zum Schutz vor Schaden genoss die Privatsphäre deshalb insgesamt einen sehr hohen Stellenwert im Machtbereich des Voodoo. Nur selten wurde Gästen und selbst Nachbarn Einlass in die privaten Wohnräume gewährt. Der bevorzugte Ort der Gastfreundschaft war vor der Behausung. Auch näherte sich niemand mit ehrlichen Absichten einem Haus unbemerkt – ein Tabu. Bonifacius wusste um diese Fragen der Spiritualität und Etikette.
»Du kennst die Bedeutung deines Codenamens „Shango“?«, wollte die Fahrerin wissen.
Der Angesprochene nickte bereitwillig. »Der Voodoo-Gott des Donners. Er schützt seine ehrbaren Anhänger und bestraft Menschen, die sich gegenüber der Gemeinschaft schuldig gemacht haben. Leicht reizbar und gewalttätig. Wenn keine Reue gezeigt wird und keine Wiedergutmachung erfolgt, tötet er auch schon mal, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun.« Ein schelmisches Grinsen huschte über sein Gesicht. »Hochprozentiger Alkohol als Opfergabe soll ganz nach seinem Geschmack sein.«
»Und kennst du die Bedeutung bezogen auf deine Person?«
Was ihm dazu im Kopf herumging, ließ auch ihn die Leichtigkeit ablegen: »Eine Tante sagte mir vor Jahren, ich stünde in besonderer Beziehung zu Shango. Ich hätte seinen Charakter.«
Zum ersten Mal während der Autofahrt sah ihn Djayéola direkt an. »Und, was denkst du darüber?«
Er lächelte matt: »Na ja, bis auf den Alkohol und das Töten …«
»Deine Tante hat weise gesprochen«, kam es postwendend zurück. »Shango gebietet über die Naturgewalten, er wirkt durch auserwählte Menschen.« Wieder sah sie ihn durchdringend an. »Du warst schon immer getrieben von einem tiefen Gerechtigkeitssinn, dem Drang, Unschuldige und Schwache zu beschützen. Du glaubst an die Gemeinschaft und verabscheust rücksichtslosen Egoismus. Da ist auch deine Leidenschaft für körperliche Auseinandersetzung, für den Kampf. Gegen deine Feinde gehst du unerbittlich und ohne Angst vor. Du gehst den Weg des Kriegers.«
Eine Antwort darauf erübrigte sich, so treffend war er soeben beschrieben worden. »Und du, gehst du den Weg der Kriegerin?«
»Ich kenne mein Schicksal seit ich denken kann und wurde von klein auf darauf vorbereitet. Es ist untrennbar mit der Geschichte meines Landes verbunden. Eine Geschichte, die mir und meinesgleichen Grenzen im Handeln setzt. Grenzen, denen du nicht unterliegst.«
»Weshalb ich bei dieser Mission die Führerschaft übernehmen soll, korrekt?«
»Unsere Priester und Wahrsager haben das Fa-Orakel befragt. Die Zeichen waren eindeutig.«
Dem „Wächter der Schöpfung“ war die überlieferte Macht des Fa-Orakels nicht unbekannt. Ein Voodoo-Priester, „hounon“ genannt, konnte über das Orakel mit den Ahnen und Göttern in Verbindung treten, um Rat und Entscheidungen für die Lebenden einzuholen. Ein „bokonon“, also ein Wahrsager der Voodoo-Religion, nutzte das Orakel, um die verborgenen bösen Machenschaften von Hexen und Zauberern zu offenbaren oder um in die Zukunft zu blicken. „Fa“ war die Gottheit des Schicksals, die sich als Kugel oder Ölpalme manifestieren konnte. Symbolisch bedeutsam waren daher auch je acht Schalen von Ölpalmennüssen, die an zwei Schnüren hingen. Fallen gelassen konnten diese 256 Zeichen ergeben, die es mit Hilfe großer Erfahrung, entsprechender Orakelsprüche sowie anhand von Mythen und Legenden zu deuten galt. Es war das umfangreichste und komplizierteste je von Menschen genutzte Weissagungssystem und beinhaltete das ganze Wesen der Voodoo-Religion sowie der darauf basierenden Kultur.
Schon seine nächste Frage auf den Lippen, kam Djayéola ihm zuvor: »Was du sonst noch über mich wissen musst, wirst du erfahren. Wenn es an der Zeit ist.«
Also hielt Bonifacius seine Ungeduld im Zaum und gab sich dem bunten Treiben auf den abendlichen Straßen Cotonous hin. Dort dominierten eindeutig die Fortbewegungsmittel auf zwei Rädern – zum einen Motorräder und Mopeds, von denen die Taxis an den gelben T-Shirts ihrer Fahrer zu erkennen waren, zum anderen Handkarren, die nicht selten so hoch mit Ware vollgepackt waren, dass man sich fragen musste, wie es damit überhaupt jemand fertigbrachte Kurs zu halten. Überall am Straßenrand standen Händler, die unversteuertes Benzin aus Plastikkanistern an dankbare Abnehmer verkauften. Das Schmuggelgut aus Nigeria wurde je nach Bedarf noch vor Ort mit Motoröl gemischt. Und um das Wirrwarr perfekt zu machen, überquerten routinierte Fußgänger die Fahrbahn, welche alle die lokale Wirtschaft anzukurbeln schienen – als Händler mit Lebensmitteln und Textilien in Plastiksäcken auf dem Kopf, oder als Konsumenten mit vollen Tüten in Händen. Während auf beiden Seiten Fahrzeuge aller Art abwechselnd an Bonifacius und Djayéola vorbeizogen oder diese von ihnen überholt wurden, jagte vor ihnen ein Spurwechselmanöver das nächste, ohne dass das ungeübte Auge imstande gewesen wäre, ein Regelsystem daraus abzuleiten.
Der Journalist beim Konstantin Verlag drehte die Radiomusik lauter. Es lief das Tanzstück eines beninischen Musikers, getragen von brasilianischen Rhythmen. Davon inspiriert, nahmen die Gedanken des Weltbürgers eine neue Richtung: Einst gelangten Musik und Voodoo durch die Verschleppung von Westafrikanern auf die Zuckerrohrfelder und Tabakplantagen der sogenannten Neuen Welt. Über Generationen verselbständigt und verändert, kehrten diese einstigen Repräsentanten afrikanischer Kultur schließlich als neue Einflüsse zu ihrem Ursprung zurück. Besonders prominentes Beispiel für die Auswirkungen der adaptierten Voodoo-Religion, welche sich unter anderem zu Candomblé in Brasilien, Santéria auf Kuba oder Vodou auf Haiti entwickelt hatte, war das Phänomen der Zombies. Zombies waren das Ergebnis böser Zauberei und missbrauchter Gifte aus Mutter Natur, insbesondere praktiziert auf Haiti. Die Ursprünge des Voodoo waren gewissermaßen außer Kontrolle geraten, die Erklärung dafür denkbar einfach. Bei der Auswahl des zu verschiffenden Menschenmaterials hatten die europäischen Sklavenhändler Voodoo-Priester bewusst ausschließen wollen. Die Angst vor einer Fortführung der Voodoo-Traditionen und des damit einhergehenden ungebrochenen Widerstandswillens unter den Sklaven war enorm gewesen. Aber weder konnte jeder „hounon“ identifiziert werden, noch eine animistische Religion unterdrückt werden, die über Jahrtausende gereift war. Auf dem amerikanischen Kontinent und den karibischen Inseln hatte man ihnen das Christentum zwar gewaltsam aufgezwungen, doch im Geheimen hatten die Voodoosi weiter zu ihren Göttern gebetet und ihre Rituale zelebriert. Dennoch, weil die Voodoo-Kultur traditionell keine schriftlichen Aufzeichnungen kannte und nur wenige ausreichend qualifizierte Voodoo-Priester die Neue Welt erreicht hatten, musste aus Erinnerungen und Halbwissen geschöpft werden. Auch waren verschiedene Volksstämme mit unterschiedlichen Sprachen und durchaus abweichenden Traditionen aufeinandergetroffen. Im Verlauf ihrer Teilassimilation hatten die afrikanischen Neuankömmlinge des Weiteren christliche Symbolik und Heilige in ihre Kulte aufgenommen. So war die unausweichliche Entwicklung hin zu einem Zerrbild des Ursprünglichen vorgezeichnet gewesen.
Dem Agenten kam ein bedeutender historischer Name in den Sinn – François-Dominique Toussaint. Als Toussaint L'Ouverture sollte dieser Mann als Symbol der berechtigten Angst weißer Sklavenhalter und Herrschender vor der Macht des Voodoo in die Geschichte eingehen. Anno 1743 als Sklavensohn in Haiti geboren, war er Nachkomme eines afrikanischen Königsgeschlechts im damaligen Dahomey gewesen. Nach dem Tod des Vaters hatte sich der Voodoo-Priester Pierre Baptiste Simon seiner angenommen, ihn in Französisch und Latein unterwiesen und in die Geheimnisse und Traditionen des Voodoo eingeführt. Bereits ein freier Mann, schloss Toussaint sich 1791 dem größten Sklavenaufstand der Menschheitsgeschichte unter der Führung einiger Generäle wie Georges Biassou an, was zur haitianischen Revolution führte …
Schlagartig war Bonifacius zurück in der Gegenwart: »Djayéola, du hast nicht zufällig einen Vorfahren mit Namen Georges Biassou?«
Wie ihr überraschtes Gesicht verriet, lockte er sie damit ein erstes Mal aus der Reserve: »Ja. In der Karibik kämpfte er vor zweihundert Jahren gegen die Franzosen, für die Abschaffung der Sklaverei. - Ich bin beeindruckt.«
Zufrieden tauchte er wieder in die Historie ab. Nahezu eine Million westafrikanischer Sklaven waren im 18. Jahrhundert alleine für die Zuckerrohrplantagen Santo Domingos – später bekannt als Haiti und Dominikanische Republik – eingeführt worden. Und es war der einflussreiche Voodoo-Priester Boukman gewesen, der den entscheidenden Sklavenaufstand ausgelöst hatte, an dessen Ende 1793 die Abschaffung der Sklaverei stand. – Zunächst als Kräuterarzt aktiv, hatte sich Toussaint dank spiritueller Führung, herausragender Intelligenz und gerechter Menschenführung zu einem großen Führer entwickelt. Nachdem sich der auch als „schwarzer Spartakus“ gerühmte ehemalige Sklave 1794 siegreich in den Dienst der Franzosen gestellt hatte, gelang Toussaint – im Rang eines französischen Brigadegenerals – bis 1801 die Vertreibung Englands und Spaniens aus der Karibik, und das als militärischer Oberbefehlshaber aller französischen Truppen in der Karibikregion.
Toussaint L'Ouverture war zweifellos ein haitianischer Freiheitsheld, ohne den die erste schwarze Republik im Jahr 1804 nicht denkbar gewesen wäre. In dem einen oder anderen Geschichtsbuch war er seither auch als „schwarzer Napoleon“ tituliert worden. Ein dunkelhäutiger Brigadegeneral der französischen Armee, einstmals Sklave und mit westafrikanischen Wurzeln, hatte drei europäische Großmächte in die Knie gezwungen, einschließlich den großen Bonaparte. Denn der hatte zähneknirschend hinnehmen müssen, dass sein Protegé sich eigenmächtig zum Generalgouverneur von Haiti auf Lebenszeit ernannt und eine auf Autonomie ausgerichtete Verfassung ausgerufen hatte. Nachdem Napoleon daraufhin auch noch in einer verlustreichen Schlacht der Unterlegene gewesen war, hatte er Toussaint eine unrühmliche Falle stellen lassen, basierend auf falschen Versprechungen. Damit hatte sich der große Franzose selber entehrt. Dessen größter Widersacher in der neuen Welt jedoch, wenngleich tot, war zum Märtyrer für die Ewigkeit geworden. – Bonifacius räumte gerne ein, dass ein solcher Lebenslauf nur schwerlich ohne den spirituellen Einfluss des Voodoo erklärbar war.
Sein Auflachen zog den neugierigen Seitenblick der Beninerin auf sich. Gerade ihr wollte er eine Erklärung nicht schuldig bleiben: »Ich musste gerade an den haitianischen Freiheitshelden Toussaint L'Ouverture denken.«
Djayéolas Nicken signalisierte ihr Wissen um jene Persönlichkeit, gleichwohl ließ sie den Beifahrer kommentarlos weitersprechen.
»Ich hätte zu gerne die fassungslosen Gesichter der spanischen, englischen und französischen Obrigkeit gesehen, die von einem afrikanischen Spartakus vom Sockel der Überlegenheit gestoßen worden sind. Der Mann hat die geopolitische und rassenideologische Faktenlage seiner Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Wirklich ein dunkles Sahnestück der Geschichte.«