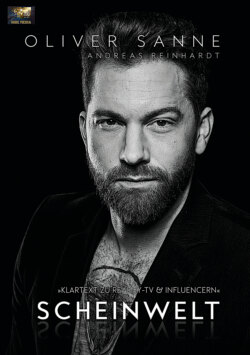Читать книгу Scheinwelt - Andreas Reinhardt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie frühen Jahre – von Warnungen, Übergewicht und Vorbildern
Ganz unspektakulär wurde ich in eine Handwerkerfamilie mit Malereibetrieb hineingeboren, wobei meine Mutter mehr den geschäftsführenden Part innehatte, mein Vater den des ausführenden Handwerkers. Als ich zur Welt kam, waren meine Eltern nicht mehr die Jüngsten, womit sich wohl auch erklären lässt, dass ich mehr „passiert“ bin als geplant war – der letzte Schuss, wenn man so will. Papa war auch Vater zweier weiterer Kinder aus einer früheren Ehe. Für meinen zehn Jahre älteren Bruder Alexander und mich war es ein Leben ohne spürbare Entbehrungen, jedenfalls empfanden wir es nie so. Es gab das angesagteste Spielzeug und keine abgetragenen Klamotten. Tatsache war allerdings auch, dass die Familie zwar von Monat zu Monat halbwegs gut über die Runden kam, ohne jedoch erwähnenswerte Ersparnisse aufbauen zu können. Sicherlich wurde da die eine oder andere D-Mark beziehungsweise der eine oder andere Euro mehr als einmal umgedreht, aber welcher Familie ging es hinter vorgehaltener Hand nicht genauso, zumal mit zwei oder mehr Kindern? Viel entscheidender war, dass in unserem Elternhaus zwar ein strenges väterliches Regiment vorherrschte, jedoch weder geschlagen noch Stubenarrest als Strafmaßnahme eingesetzt wurde. Überhaupt lag die Erziehung vor allem in den Händen der Mama. Sie war die Chefin in den eigenen vier Wänden. Papa beschränkte sich auf die Rolle des regelmäßigen Mahners, der sich mit Gesten, Blicken und Worten Respekt verschaffte. Aufbrausend war er bisweilen auch, schlug schon mal wütend auf den Tisch und erhob die Stimme. Das war dann aber auch das Äußerste. Diesen Charakterzug habe ich zweifelsohne von ihm geerbt.
»Ihr müsst ums Verrecken die Schule vernünftig hinkriegen, damit euch alle Optionen im späteren Berufsleben offenstehen. Ich will, dass Ihr die Schule ernst nehmt. Ihr sollt nicht so arbeiten müssen wie ich, bis es euch körperlich kaputt macht«, pflegte er uns mit allem Nachdruck ins Gewissen zu reden.
Kein Wunder also, dass auf unsere Erziehung und Schulbildung allergrößter Wert gelegt wurde. Mein Bruder Alex erfüllte die Anforderungen mehr oder weniger spielend, ging bei uns in Bonn auf eine angesehene Privatschule, wo er auch sein Abitur machte. Selbstredend sollte ich es ihm gleichtun, was daran scheiterte, dass ich schulisch gesehen zum Totalausfall tendierte. Die katholische Realschule stemmte ich noch gerade so – nach einer „Ehrenrunde“ in der 10. Klasse – aber für eine Empfehlung auf besagtes Gymnasium reichte es nicht. Meine Eltern entsandten mich dann zwar auf ein anderes, aber das war dasselbe, als würde man einen altersschwachen Esel einen steilen Bergpfad hinauftreiben. Meine Leistungen ließen immer mehr zu wünschen übrig, ich verkackte Prüfung um Prüfung, vor allem in den entscheidenden Fächern wie Mathematik, Deutsch und Physik.
Was mein Selbstvertrauen darüber hinaus jeden Tag aufs Neue pulverisierte, war mein Übergewicht. Mit 15 Jahren brachte ich schon satte 100 Kilo auf die Waage, ein Jahr darauf stolze 110 Kilo, und als 18-Jähriger kratzte ich sogar die 120-Kilo-Marke – höchst ungünstig verteilter Speck noch dazu. Dabei habe ich immer leidenschaftlich und viel Sport getrieben, von Taekwondo über Basketball bis hin zur Sport-AG der Schule. Das Dilemma bestand darin, dass ich daneben auch ein leidenschaftlicher Esser mit unbändigem Appetit war – nicht aus irgendeinem Frust heraus, sondern wirklich aus Lust am Essen. Ein typischer Wochentag sah für mich so aus, dass ich nach der Schule zu einem Klassenkameraden ging, um gemeinsam Hausaufgaben zu machen. Dort wurde dann auch warm zu Mittag gegessen. Danach ging es in die Innenstadt, wo nahezu zwanghaft McDonald's angesteuert wurde. Kam ich dann am frühen Abend nachhause, behauptete ich, noch nichts Warmes zu mir genommen zu haben und genoss auf die Art eine weitere deftige Speise. Mein wichtigstes Motto in dem Zusammenhang: Immer große Portionen und immer um Nachschlag bitten. – Meine Eltern hatten ihrerseits keinen Sinn für betont gesunde und vor allem maßvolle Ernährung. Sie entstammten noch einer Generation, deren Hauptaugenmerk darauf lag, dass alle in der Familie überreichlich zu Essen hatten, um im Umkehrschluss gut genährt und folglich gesund zu sein. Nichts anderes wurde mir vermittelt. Kurzum, die Sensibilität für wirklich gesunde Ernährung ging meinen Eltern vollständig ab. Wäre jemand meinem Vater – dem klassischen Handwerker – mit Fitness-Lifestyle, kalorienarmer oder gar Trennkost gekommen, hätte er womöglich Vertreter der städtischen Nervenheilanstalt zu Hilfe gerufen. Zumindest hätte er herzhaft über den vermeintlichen Witz gelacht. Für ihn war nun mal die gutbürgerlich deftige Küche meiner Mutter der einzig wahre Jakob.
Ich erzähle das über meinen Vater ohne jeden Anklang von Verständnislosigkeit oder Ironie. Im Gegenteil, bis zum heutigen Tag empfinde ich tiefsten Respekt und Hochachtung vor der Lebensleistung meines Vaters. Als Kind musste er noch beim Bauern auf dem Feld Kartoffeln stibitzen gehen, um zu einer halbwegs gehaltvollen Suppe zu kommen und satt zu werden. Bereits mit 14 Jahren hat er begonnen, körperlich zu arbeiten. Im Beruf hat er dann zeitlebens gesundheitsschädliche Lacke eingeatmet, ist ohne Knieschutz auf den Böden herumgerutscht, hat ganze Gebäude entkernt und renoviert. Bis ins Rentenalter hinein hieß das auf Baustellen zu schuften und sich so die Gesundheit zu ruinieren, um der Familie das Bestmögliche bieten zu können. Das wollte er seinen Jungs, also meinem Bruder und mir unbedingt ersparen. Und weil er von meinem Lerneifer nach wie vor nicht überzeugt war, nahm er mich nach dem Schulabschluss zum Malochen mit auf den Bau. Drei Monate lang hat er mich gnadenlos Dreck fressen lassen, um mir vor Augen zu führen, dass ein Leben als Handwerker an vorderster Front keinesfalls erstrebenswert war und ich mit meinen zwei linken Händen ohnehin in kürzester Zeit verhungert wäre. Am Ende sprach er einen Satz, der sich mir tief eingebrannt hat:
»Gut, dass du die Schule zu Ende gebracht hast, den Scheiß hier willst du nicht dein Leben lang machen müssen.«
Mittlerweile in den Siebzigern, ist mein Vater ein körperliches Wrack mit einer Krankengeschichte, die sich liest wie das Who is Who der verschiedensten Leiden und Gebrechen, was seine vielen Mahnungen und Appelle an mich im Nachhinein nur umso wertvoller erscheinen lässt. An seiner Seite meine ebenso standhafte Mutter, die in traditioneller Rollenverteilung den Haushalt stets liebevoll organisiert und ihrem Ehemann über all die Jahre hinweg auf bewundernswerte Weise den Rücken freigehalten hat. Für sie waren mein Bruder und ich auch nie fett, sondern lediglich kräftig gewesen. Gerade fällt mir auf, dass ich zumindest die Einstellung meiner Mama zu gesunder Ernährung ein Stück weit revidieren muss. Tatsächlich hat sie das Thema Trennkost und sonstige angesagte Diäten wiederholt an uns Kindern ausprobiert, wenngleich mit überschaubarem Enthusiasmus. Da wurde etliches angefangen und angetestet, jedoch nichts davon konsequent durchgezogen. Soweit ich mich erinnere, verwechselte sie auch gerne Kohlenhydrate mit Fetten und Proteinen. Ja nun, es gab noch kein Google, dem man online auf die Schnelle verschiedene kulinarische und ernährungswissenschaftliche Geheimnisse hätte entlocken können.
Zwar habe ich die Jahre meines massiven Übergewichtes gerade eher humorvoll beschrieben, aber es gab auch die andere Seite der Medaille, nämlich eine unterschwellige Form des Mobbings. In der Schule wurde ich selbst von Freunden so häufig mit „Qualle“, „Fetti“ oder „Dickerchen“ tituliert, als wären es meine regulären Namen. Immer machte ich gute Miene zum bösen Spiel, um nur nicht meine Position als akzeptiertes Gruppenmitglied zu gefährden. Wirklich böse meinten es die Wenigsten. Doch was wirklich in mir vorging, wusste auch niemand. Ich fraß den Frust still in mich hinein und kompensierte die Herabwürdigung, indem ich zum Klassenclown avancierte. Spöttische Kommentare und ironische Bemerkungen gegenüber Lehrern wurden zu meinem Markenzeichen, was regelmäßig für Lacher bei meinen Mitschülern sorgte. Es gefiel mir, ein applaudierendes Publikum zu haben und im Mittelpunkt zu stehen. Immer weiter markierte ich den Starken und Robusten. Irgendwann später verstand ich, dass ich nur ein trauriger und verletzter Clown war, der für Lacher sorgte, um die eigenen Tränen zu verbergen. Das Kuriose daran: Gerade diese harte Schule des Lebens schärfte meinen Sinn für Ironie und Sarkasmus, machte mich früh zu einem eloquenten Redner.
Neben meinen bescheidenen Schulnoten und dem Übergewicht kam mit dem Wechsel auf das Gymnasium noch eine dritte Komponente hinzu, die mir arg zusetzte: Mädchen! Dazu muss man wissen, dass meine katholische Realschule eine reine Jungenschule gewesen war. Das hatte die Begegnung mit Mädchen auf wenige Tanzabende und Feiern reduziert, die mit der nahen Partnerschule – eine reine Mädchenschule, von uns Jungs augenzwinkernd das „Nonnenkloster“ genannt – organisiert worden waren. Auf dem Gymnasium gab es nun überall um mich herum Mädchen, und mir wurde schmerzhaft bewusst, dass meine Freunde und Kumpels bereits seit ihrem 14. Lebensjahr mehr oder weniger feste Freundinnen hatten, teilweise sogar schon über die ersten sexuellen Erfahrungen zu berichten wussten. Nur ich stand da wie die Unschuld vom Lande. Das wurmte mich. Woran das bloß lag? Dabei musste man kein Einstein sein, um zu begreifen, weshalb die Mädels in mir nie mehr als einen guten Kumpel sahen. Ich erkannte es in der Badewanne, vor dem Spiegel, immer wenn ich mich auszog. Gefragt waren athletisch anmutende Jungs, die der holden Weiblichkeit mit der nötigen Portion „Macho“ entgegentraten, kein unförmiges Schwergewicht voller Hemmungen und Selbstzweifel.
Unterkriegen ließ ich mich dennoch nicht. Zu stark war der Rückhalt in der Familie, zu präsent schon damals meine Kämpfer-Mentalität. Belohnt wurde mein Durchhaltevermögen mit Myriam, meiner ersten richtigen Freundin, so mit allem Drum und Dran. Beide waren wir etwa ein Alter, auch für sie war ich der Erste. Neben meinem Bruder sollte sie die wichtigste Zeugin meiner zwei Jahre später einsetzenden Metamorphose werden. Als verliebtes Team harmonierten wir prächtig, blieben beinahe fünf Jahre zusammen, mit kurzen Unterbrechungen. Obwohl seit vielen Jahren nicht mehr liiert, sind Myriam und ich auch heute noch freundschaftlich verbunden.
Wie gut auch, dass es meinen Bruder Alexander gab. Wie schon gesagt war er zehn Jahre älter, und ich sah zu ihm als Vorbild und Helden auf. Früher hatte er für mich Kasperle-Theater gespielt, mir von seinem Taschengeld Figuren von He-Man bis Ninja Turtles nebst Ausrüstung gekauft oder im Sommer ein aufblasbares Schwimmbecken. Sogar im Kreis seiner Freunde war ich als kleiner Steppke geduldet gewesen. Zu Verstimmungen war es zwischen uns eigentlich nur gekommen, wenn er eine Freundin mit nachhause gebracht und vorübergehend das gesamte Zimmer für sich eingefordert hat. Wir haben uns nämlich eines mit Hochbett geteilt. Weshalb die Tür bei solchen Gelegenheiten von innen abgeschlossen und ich ins Wohnzimmer verbannt worden bin, war mir auch mit Engelszungen nicht zu vermitteln gewesen. Es ging zu der Zeit einfach noch über mein Fassungsvermögen. Aber noch etwas zum Thema Freundin. Mit einer war er sieben Jahre zusammen, und von beiden bin ich – ja man kann schon sagen – mit erzogen worden. Und als er mit 18 Jahren den Heavy-Metal-Fan mit verwegenem Bandana-Kopftuch gab und anfing, die Kneipen unsicher zu machen, waren die mitgehörten Geschichten über seine amourösen Eroberungen und irgendwelche Bierspiele für mich noch weitaus spannender, als die Abenteuer eines Robin Hood, Winnetou oder von „Tim & Struppi“. Als Krönung lebte Alex mir vor, wie man mit Biss und Disziplin von seinem Übergewicht herunterkommen konnte, ging dafür regelmäßig ins Fitnessstudio. Er hat es sozusagen vor meinen Augen geschafft, was eine ungeheure Motivation für mich war, mir Mut gab. Und es kam der Tag – ich war selber schon in der gymnasialen Oberstufe, zwölfte Klasse meine ich – da sprach er die entscheidenden Worte:
»Ey Oli, ganz ehrlich, wenn du noch was mehr von der Welt kennenlernen willst und dass dich die Leute anders wahrnehmen, dann komm doch einfach mal mit ins Fitnessstudio.«
He-Man, Hulk Hogan, der unglaubliche Hulk, schoss es mir durch den Kopf. Ich war eh ein großer Wrestling-Fan, wieso musste mich eigentlich erst mein Bruder darauf stoßen? Egal, jedenfalls rannte er damit offene Türen ein. Es sollte mir den Weg in eine viel größere Welt ebnen, meine Zukunft entscheidend definieren.
Einen weiteren Wendepunkt während meiner Jugendjahre sollte ich auch noch ansprechen. Im Alter von knapp 16 Jahren stand ich mit einem Kumpel am Busbahnhof, weil ich zu einer Geburtstagsparty eingeladen war. Zu jener Zeit lebte ich den Tick aus, meine Haare dunkler zu färben – weiß der Himmel wieso. Genau das war der Aufhänger für eine achtköpfige Gruppe von Jungtürken, die sich gezielt näherte.
»Was färbst du dir die Haare? Willst du Türke wie wir sein, oder was?«, provozierte mich der scheinbare Anführer, welcher mit einem zweiten Typen an seiner Seite die aggressive Vorhut bildete.
Auf mein »Nein« folgte direkt sein Fausthieb in mein Gesicht. Schon wurden aus den beiden vier und aus den Vieren schnell alle Acht. Wie ein Rudel Raubtiere umkreisten sie mich, schubsten und bespuckten mich, bevor ich kollektiv mit Fäusten und Tritten bearbeitet wurde. Mein Kumpel musste zwar auch Schläge einstecken, doch das Hauptziel blieb ich. Meine Überraschung, der Schock und die Angst waren zu groß, um mich zu wehren. Stattdessen hieß die Strategie stillhalten, damit es nicht noch schlimmer werden würde. Gegen diese Übermacht ist ohnehin jeder Widerstand wie Selbstmord, dachte ich damals nur, sofern ich überhaupt imstande war zu denken. Dann war der Spuk plötzlich vorbei, die Schläger verschwunden.
Meinem Versprechen treu bleibend, schleppte ich mich trotzdem zur Geburtstagsparty. Im Bus dorthin sprach ich andere Fahrgäste an, ob jemand etwas zur Hand hätte, womit ich meine Wunden kühlen könne. Erst am Zielort konnte ich meine zerbeulte Visage richtig in Augenschein nehmen – einäugig wohlgemerkt. Das andere war nämlich zugeschwollen. Genau wie die Unterlippe auch, dazu eine Platzwunde über dem Auge und diverse sonstige Schwellungen und Schürfwunden. Wenigstens das Nasenbluten hatte ich zwischenzeitlich in den Griff bekommen. Man hätte mich leicht für einen Preisboxer halten können, der seine besten Tage längst hinter sich hatte.
Pikanterweise geschah es ausgerechnet am Wochenende vor meiner zweiten Praktikumswoche in einem Drogeriemarkt. Dort haben mich die schockierten Kolleginnen erst einmal mit Abdeckcreme, Make-up und was weiß ich noch alles bearbeitet, damit ich wenigstens einigermaßen vorzeigbar war. Blaumachen wäre mir nie in den Sinn gekommen. Das war schon damals nicht meine Art, und die Eltern hätten es ohnehin nicht geduldet.
Mein Vater fand sehr deutliche Worte: »Sohn, du darfst dich nie wieder so verprügeln lassen. Du musst immer vorbereitet sein und mit allem was du hast zurückschlagen. Vergiss die Konsequenzen. Sei ein Mann.«
Auch mein Bruder brachte es ähnlich auf den Punkt. Von diesem Tag an war meine ganze Körperhaltung ein andere. Es gab nur noch zwei Optionen: Beim kleinsten Anzeichen von Ärger das Feld zu räumen oder wenn das nicht möglich war, zuzuschlagen, bevor es der Aggressor tun konnte. Würde ich das nächste Mal einstecken müssen, dann der oder die Gegner mindestens genauso hart und reichlich. Aber dazu sollte es nicht mehr kommen. Ich hatte meine Lektion gelernt, gab nie wieder das wehrlose Opfer, kassierte nie wieder Schläge. Hinzu kam zwei Jahre später noch die abschreckende Wirkung meiner Körpermaße: einen Meter 95 groß und über 100 muskulöse Kilo schwer.