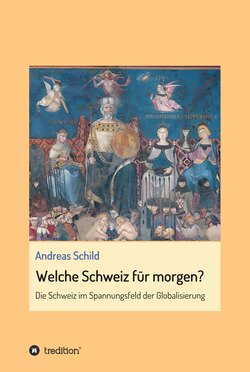Читать книгу Welche Schweiz für morgen? - Andreas Schild - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Die Schweiz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Drei internationale Entwicklungen haben die Schweiz und das politische Denken der Schweizer und Schweizerinnen in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts beschäftigt und geprägt: Der Zweite Weltkrieg, respektive die Nachkriegssituation, der Kalte Krieg und die Globalisierung der Welt.
1.1 Die Nachkriegszeit
Das Resultat des zweiten Weltkrieges könnte salopp als «wir sind noch einmal davongekommen» umschrieben werden. Auch wenn wir unsere Neutralität zelebrierten, können wir doch sagen: Wir gehörten zu den Gewinnern des Weltkrieges. Zwar sind die Meriten der Schweiz durchaus umstritten. Vereinfacht gesagt waren der Bürger, die Bürgerin, das Volk, voll engagiert in der potentiellen Verteidigung der Schweiz. Mobilmachung und Aktivzeit haben eine ganze Generation geprägt: In ihrem Bewusstsein bewirkte der Widerstandswille und die Verteidigungsbereitschaft, dass wir verschont blieben. Je höher man die gesellschaftliche Leiter hinaufsteigt, desto zweifelhafter wird, wie tapfer und verteidigungsbereit die Schweiz wirklich war. Unsere Industrie erbrachte für die deutsche Armee wichtige Dienstleistungen, die Banken verwalteten jüdische Vermögen und die Nationalbank wusch fleissig und wohlwissend deutsches Gold, das teilweise aus den Konzentrationslagern gepresst worden war.
Obwohl der Durchschnittsschweizer als Soldat, die Durchschnittsschweizerin als Hausfrau sich mit Überzeugung für das Vaterland ins Zeug legten, muss die Beurteilung der Schweiz als Ganzes durchzogen ausfallen. Trotzdem prägte die Parole von der geistigen Landesverteidigung, mit der Herr und Frau Schweizer geimpft wurden, eine ganze Generation und die Weltanschauung der Schweizer und Schweizerinnen für den Rest des Jahrhunderts.
Die Neutralität, eigentlich nicht viel mehr als eine Überlebensstrategie des Kleinstaates in einer Zeit grosser Bedrohung, war einer der roten Fäden, die uns erhalten blieben. Von aussen betrachtet sah diese Neutralität weniger rosig aus: Für die Siegermächte war die Schweiz nicht einmal eine Kriegsgewinnerin, sondern eine Kriegsgewinnlerin. Unsere Infrastruktur war intakt geblieben, unsere Unternehmen hatten gut verdient, ja einige Unternehmen wurden im Verlaufe des Krieges sogar zu schweizerischen Unternehmen. Für die späteren Siegermächte war die schweizerische Neutralität schon während des Krieges ein Deckmäntelchen, unter dem die Schweiz Profite machen konnte. Schon während der Kriegshandlungen wurde von den Alliierten Druck auf die Schweiz ausgeübt und nach geschlagener Schlacht forderten diese von der Schweiz massive Kompensation, eine Beteiligung am Wiederaufbau Europas und gewissermassen Reparationszahlungen. Nur den geschickten Verhandlungen des schweizerischen Unterhändlers Stucki, und der Konzilianz von Bundesrat Petitpierre ist es zu verdanken, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind.
1.2 Der Kalte Krieg
Unsere tatsächliche Rettung war allerdings der Kalte Krieg. Er liess die auf Reparationen drängenden Personen in der amerikanischen Administration - vor allem im Finanzministerium - verstummen. Exponenten des Aussenministeriums hatten nun das Sagen. Ab 1948 war der neue Feind die Sowjetunion und es herrschte der Kalte Krieg. Für die Schweiz war klar: Unser Herz schlug für die demokratische Freiheit, von ihr waren wir überzeugt. Wir schlugen uns ins Lager des Westens, blieben aber politisch neutral. Die bewährte Ideologie von der geistigen Landesverteidigung rüstete uns gut für die neue Situation. Die Siegermächte dankten uns dies. Die radikalen Forderungen der Amerikaner verschwanden, respektive fielen, wie sich später zeigen sollte, in einen Dauerschlaf. Wir blieben stramme kalte Krieger und Kriegerinnen bis gegen Ende des Jahrhunderts. Wer sich da nicht einreihte wurde observiert, registriert und womöglich plakatiert. Diese Situation dauerte beinahe bis zum Ende des Jahrhunderts, verlor allerdings in den Augen der nachrückenden Generation viel vom Heiligenschein, mit dem wir uns geschmückt hatten. 1989 glaubten gewisse Kreise, heroisch das 50-Jahr-Jubiläum der Mobilmachung feiern zu müssen, was weder im Ausland noch bei der neuen Generation zu mehr als einem Kopfschütteln reichte. Dass der zweite Weltkrieg bis Ende des Jahrhunderts nachwirkte, zeigte sich beim Thema Rückzahlung der namenlosen Vermögen. Mit dem Ende des Kalten Krieges erhielten in der amerikanischen Verwaltung die Strömungen wieder die Oberhand, die bereits am Ende des Weltkrieges finanzielle Forderungen an die Schweiz gestellt hatten. Der Faden von 1946 wurde wieder aufgenommen und führte zu einer Krise unseres Nationalstolzes, einer gehörigen Verstimmung in der schweizerischen Volksseele - und zu einem unglücklichen Verhalten unserer politischen und wirtschaftlichen Führung. Das Wiedererwachen der amerikanischen Forderungen traf die Schweiz völlig unvorbereitet. Der finanzielle Schaden konnte begrenzt werden, weil er auf die Grossbanken abgeschoben werden konnte. Diese konnten ihn verkraften - sie hatten ja inzwischen international genügend Geld verdient. Aber das ungetrübte Verhältnis des Schweizers, der Schweizerin zu den USA - um nicht zu sagen die Bewunderung - erhielt einen gehörigen Nasenstüber. Wobei allerdings auch - nicht nur im Ausland, sondern auch in den Augen eines Grossteils der schweizerischen Bevölkerung - der Finanzplatz Schweiz einen gehörigen Tolggen im Reinheft fasste. Das Erlebnis des zweiten Weltkrieges und die geistige Landesverteidigung verschafften uns aber innenpolitisch gewissermassen einen lateralen Gewinn. Die innenpolitische Auseinandersetzung zwischen links und rechts wurde in ordentliche, mit politischer Konkordanz versehene Bahnen gelenkt und verlor an Radikalität. Die politische Mehrheit zeigte gesellschaftliche Verantwortung. Der ärmere Teil der Bevölkerung hatte den Krieg besser überstanden als den ersten Weltkrieg. Das Nationale half, die politischen Gegensätze zu relativieren, was in der Nachkriegszeit zu einem sozialen Ausgleich führte. Die beschworene kommunistische Gefahr half uns, den innenpolitischen Solidaritätsschub weiter zu pflegen: Die Sozialdemokratie wurde aktiv an der Regierung beteiligt und die Einführung der AHV ermöglichte der älteren Generation, das Alter besser zu geniessen.
Der innenpolitische Ausgleich war wichtig. Man wollte keine Armut aufkommen lassen, welche die Vernachlässigten in die Arme der Kommunisten getrieben hätte. Der innenpolitische Ausgleich fand seinen Niederschlag auch gegen aussen. Solidarität wurde schon in der Nachkriegszeit auf die Fahnen der schweizerischen Aussenpolitik geschrieben und kam in Darlehen an die kriegsversehrten Nachbarstaaten zum Ausdruck. Engagierte Organisationen der Zivilgesellschaft, interessierte aussenwirtschaftliche Kreise und die verbreitete Furcht vor dem kommunistischen Vorrücken in der «Dritten Welt» bewirkten, dass die Schweiz regelmässig Kredite für die Auslandhilfe bewilligte. Der Ausbau des Sozialstaates machte weiter Fortschritte, führte aber auch zu einer gewissen Entsolidarisierung in der Gesellschaft. In den 80er Jahren wurde die Entlassung von Mitarbeitenden zwecks Erhaltung der Profitabilität einer Unternehmung plötzlich sozialpolitisch akzeptierbar, Profitabilität wurde wichtiger als Vollbeschäftigung.
Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen begannen sich in den 80er Jahren zu verändern. Der Neoliberalismus machte sich breit. Die Idee vom sozialen Ausgleich und der Verteilung der Einkommen wurde ersetzt durch die Ansicht, die Unternehmen müssten gestärkt werden. Das Kapital werde durch erhöhte Rendite Anreize erhalten, Arbeitsplätze zu schaffen. Entwicklungspolitisch war der Auslöser für diese neue Sicht die Finanzkrise Mexikos. Erstmals erklärte ein Staat, dass er die Schulden nicht mehr bedienen konnte. Durch diese Krise wachgerüttelt, wurde die verteilungsorientierte Armutsbekämpfung in Frage gestellt. Strukturanpassungen und makroökonomische Sanierungsmassnahmen rückten nun ins Zentrum.
In den Industriestaaten machte sich die Neuorientierung bemerkbar, indem plötzlich nicht mehr die Vollbeschäftigung ein wirtschaftspolitisches Ziel war, sondern wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen, welche es Kapitalgebern erlaubten, erfolgreich in Unternehmen zu investieren. Diese Tendenz wurde verstärkt durch die zunehmende Automatisierung der Produktion: Man brauchte Kapital, um in die teuren Maschinen investieren zu können, während gleichzeitig der Bedarf an qualifizierten Arbeitern und Arbeiterinnen abnahm. Die Bedeutung des Kapitals und die Kapitaleinkünfte nahmen zu, der Stellenwert der Arbeitenden dagegen ab. Das Lohneinkommen verlor gegenüber den Kapitaleinkünften an Wichtigkeit.
Und man musste ja nicht befürchten, dass Entlassene in ein Loch fallen würden. Um das zu verhindern gab es ja die Arbeitslosenversicherung. Diese und der Shareholder-Value tauchten plötzlich im Gleichschritt auf. Was Werner K. Rey unternahm, nämlich der Aufkauf von Firmen und nachfolgend ein Asset Stripping durch Veräusserung weniger rentabler Teile zwecks Optimierung der Kapitaleinkünfte, wurde damals noch als Skandal empfunden, läutete aber doch ein Umdenken ein. Im 21. Jahrhundert wurde es gang und gäbe, weniger die langfristige Stellung eines Unternehmens ins Auge zu fassen, sondern den kurzfristigen Gewinn des Kapitaleigners, der Kapitaleignerin. Damit fasste die Praxis der USA auch in der Schweiz allmählich Fuss. Entscheidend für die erfolgreiche Führung einer Unternehmung waren nicht mehr der Fachmanager oder die Fachmanagerin, sondern Finanzleute mit einer soliden Ausbildung als MBA in den USA oder wenigstens in St. Gallen.
1.3 Der Übergang ins 21. Jahrhundert
Das 21. Jahrhundert begann möglicherweise bereits mit dem Untergang der Sowjetunion. Für die Schweiz bedeutetet das letzte Jahrzehnt richtiggehend eine Zäsur. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der deutschen Wiedervereinigung verlor die bipolare Welt einen Pol, so wenigstens schien es. Das Ende der Sowjetunion nahm innen- und aussenpolitischen Druck weg. Planwirtschaft und Staat wurden diskreditiert. Freiheit, Eigenverantwortung und Kapitalismus hiessen die Schlagwörter. In der Schweiz erfolgte der Ruf nach einem schlanken Staat, zusammengefasst im Slogan: «Weniger Staat, mehr Freiheit».
Kommunismus und alles, was nach staatlicher Planung roch, wurde zum Anathema. Die Welt trat in die Ära der Pax Americana. Demokratie und Liberalismus gemeinsam mit Kapitalismus galten als goldener Pfad in die Zukunft.
In der Schweiz wurde die Abstimmung über die Beteiligung am Europäischen Wirtschaftsraum anfangs der 90er Jahre knapp verworfen, so dass wirtschaftlich gesehen der bilaterale Weg die einzige Alternative blieb. Die Schweiz wollte neutral und unabhängig bleiben, aber wo immer möglich zeigen, dass sie aktiv an den Weltproblemen mitzuarbeiten bereit sei. Internationales Mainstreaming, das Ende des Sonderfalles Schweiz und eine Relativierung der Neutralität standen plötzlich im Vordergrund. Man wollte das Gleiche tun wie die andern, nur besser und gleichzeitig keine Bindungen eingehen. Da das spezifisch Schweizerische dabei in den Hintergrund zu treten drohte, erfand man die «Swissness» als neue Mode, welche kulturell, politisch und sozial gepredigt wurde. Die Entwicklungszusammenarbeit wurde nun zur Internationalen Zusammenarbeit, welche in den europäischen Ländern in die Aussenpolitik integriert wurde. Tiers-mondisme und partnerschaftliche Zusammenarbeit wurden ersetzt durch konkrete aussenpolitische und aussenwirtschaftliche Interessenpolitik. Die Schweiz passte sich schrittweise dieser Tendenz an. Nach dem Ende des Kalten Krieges musste eine neue Mehrheit für die Internationale Zusammenarbeit gefunden werden. Erst im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zog man mit den likeminded Ländern - den Niederlanden und Skandinavien - gleich und integrierte die alte Entwicklungszusammenarbeit ins Aussenministerium.
Nach der Ablehnung des EWR-Beitritts blieb die Beziehung zur späteren EU die wichtigste aussenpolitische und innenpolitische Herausforderung für die Schweiz. Das Verhältnis zur EU als wichtigstem aussenwirtschaftlichen Partner musste geklärt werden.
Das Ziel der Schweiz blieb, auf möglichst grosse Distanz zur EU zu gehen, aber trotzdem die eigenen Interessen nicht zu beeinträchtigen. Mit der Erweiterung der EU nach Osten erwiesen sich die ständigen Anpassungen als immer komplizierter und das Verständnis für den Sonderfall Schweiz nahm innerhalb der Mitgliedsländer der EU ab. Die EU suchte deshalb ein verbindliches Rahmenabkommen mit der Schweiz. Die Schweiz ihrerseits tat alles, um ihren Zugang zum EU-Markt zu sichern und schwankte zwischen dem autonomen Nachvollzug der europäischen Gesetzgebung und verbindlichen internationalen Verträgen.
Die Zurückhaltung gegenüber der EU wurde seit den 90er Jahren kompensiert durch ein erhöhtes Engagement im Rahmen der Vereinten Nationen. Als Neues Mitglied benahm sich die Schweiz ab 2002 als Musterschülerin. Empfehlungen der UNO wurden von der schweizerischen Aussenpolitik regelmässig übernommen, was zum Anschluss an das internationale Mainstreaming führte. Ende des Jahrhunderts war die Reduktion der weltweiten Armut bis 2015 beschlossen worden und im Anschluss an den Erdgipfel 2012 wurden die Sustainable Development Goals 2030 verabschiedet. Die Schweiz gehörte zu den wichtigsten Promotoren dieser Ziele und ihre Vertreter spielten in den relevanten Gremien eine zentrale Rolle, die allerdings innenpolitisch nicht abgesichert war. Die Schweiz wurde mindestens vorübergehend zur klaren Verfechterin der internationalen Nachhaltigkeitsziele. Obwohl innenpolitisch keine Bereitschaft bestand, diese Ziele auch wirklich umzusetzen, sonnte sich die aussenpolitische Schweiz am internationalen Lichtstrahl, der auf uns fiel.
Die Jahrtausendwende war gekennzeichnet durch die weitere Expansion der schweizerischen Wirtschaft, das Wachstum einzelner Unternehmen in neue Märkte und die damit verbundene Internationalisierung. Die hohe Exportorientierung machte die Schweiz wohl zu der am stärksten globalisierten Volkswirtschaft. Damit verbunden war ein Wandel in den Unternehmungen. Immer mehr Firmen erhielten ausländische Aktionäre, Manager und Kader. Gleichzeitig fand eine Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer statt. In der Schweiz blieben nur die Filetstücke (Forschung, Konzeption und Planung). Günstige Rahmenbedingungen, inklusive Steuern, sowie das unternehmensfreundliche politische und wirtschaftliche Klima zogen und ziehen internationale Firmen an. Die Schweiz verstärkte ihre Rolle als internationale Handelsplattform für die Rohstoffe.
Die zunehmende Globalisierung von Kommunikation, Verkehr, Finanzwesen und Industrie brachte das Land immer mehr in globale Zwänge und Abhängigkeiten. Wegen der innenpolitischen Konzentration auf das Verhältnis zur EU blieben die globalen Trends von der Mehrheit weitgehend unbeachtet. Das Problem der wachsenden Unterschiede zwischen Arm und Reich wurde von den Themen Migration, Endlichkeit der Ressourcen und Klimawandel zurück gedrängt. Von Seiten der USA und der OECD aber auch durch soft laws der UNO entstand ein internationaler Druck, dem sich der Kleinstaat Schweiz nicht entziehen konnte. Das Bankgeheimnis wurde geopfert, die Steuerprivilegien mussten internationalen Standards angepasst werden. Der Umbau der schweizerischen Wirtschaft führte zu einem schleichenden Wandel auch der Gesellschaft. Die Bedeutung des klassischen Industriearbeiters aber auch der fachlich gut vorbereiteten Berufsperson nahm ab. Die Hochschulreform Bologna mit ihrer markanten Akademisierung der Ausbildung wurde Trumpf. Die Bedeutung von Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Schule, Gastronomie nahm zu. Der klassische Mittelstand, Träger unserer Stabilität und unseres Bürgertums, verlor an Bedeutung. Dafür wuchs die Zahl der höheren Kader, der Leute, die konzeptionell und in der Planung arbeiten. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur erlaubte ein weitmaschiges Pendeln. Die Agglomeration wurde zum gesellschaftlichen Siedlungsmittelpunkt. Gleichzeitig ersetzte der Gegensatz Stadt – Land den alten Gegensatz zwischen Arbeitsgebenden und Arbeitsnehmenden. Der Agglobewohner, die Agglobewohnerin sind fortschrittlich, geprägt durch den Beruf, schätzen aber gleichzeitig Brauchtum und Folklore und eine gewisse Bodenständigkeit in einer dynamischen Welt.