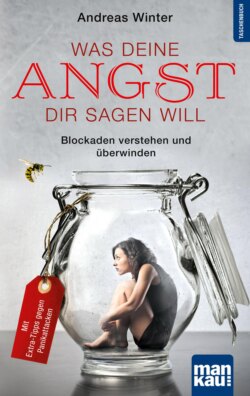Читать книгу Was deine Angst dir sagen will - Andreas Winter - Страница 8
ОглавлениеHaben Sie Angst? Na klar haben Sie Angst! Jeder hat doch irgendeine Form von Abscheu, Vorbehalten, Befürchtungen oder Panik. Über sieben Millionen Deutsche leiden sogar unter einer diagnostizierten spezifischen Phobie, Tendenz steigend. Aber keine Bange, das kriegt man wirklich weg! Ich weiß es, denn ich war der ängstlichste Junge, den Sie sich vorstellen können. Vielleicht nicht in jeder Hinsicht ängstlich, aber ich hatte Angst vor Lehrern, vor Mitschülern, vor Einbrechern, vor Kellern und Spinnen, ja eigentlich vor allem. Damit war ich sicher nicht der Einzige in der Klasse, aber mich quälten meine Ängste so sehr, dass ich mit 15 Jahren beschloss, damit nicht mehr länger leben zu wollen. Ich nahm mir vor, angstfrei zu werden. Es wurde allerdings ein langer Weg. Jahrelang versuchte ich, eine Angst nach der anderen in die Zange zu nehmen, mich zu überwinden, mir Mut einzureden und mich zusammenzureißen oder zu disziplinieren. Doch egal, was ich tat, es tauchten immer neue Ängste in meinem Leben auf: Die Angst, ein Mädchen anzusprechen, die Angst, ein Referat zu halten, später die Angst vor dem Autofahren oder Angst vor Prüfungen. Mein Versuch, mich zu befreien, war fast wie Herakles’ Kampf gegen die schlangenköpfige Hydra. Wurde ihr ein Schlangenkopf abgeschlagen, wuchsen sogleich zwei neue nach. Je mehr man ein Symptom bekämpft, ohne die dahinterliegende Ursache aufzuarbeiten, desto deutlicher zeigt sich der innere Konflikt! Alles wird schlimmer. Sich zusammenreißen brachte also nichts. Eine chronische Bronchitis, chronischer Schnupfen, Schulversagen, Sprachstörungen, Konzentrationsstörungen, psychosomatische Angststörungen, soziale Hemmungen, Begabungsdefizite und Weinerlichkeit waren unerträgliche Folgen meiner Ängste. Lächerlich, peinlich, ein Jammer!
Doch irgendwann, ich war schon 18 Jahre alt und stand kurz vorm Abitur, las ich das Märchen „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“ von den Gebrüdern Grimm. Erinnern Sie sich an das Märchen? Der jüngere Sohn eines Töpfers galt als naiv und dümmlich, weil er sich vor nichts fürchtete. Weder Geister noch Friedhöfe oder Galgen ängstigten ihn. Mich hingegen faszinierte seine Furchtlosigkeit, und mir wurde durch dieses traditionelle Märchen klar, dass man Angst zunächst erlernen muss. Dieser Gedanke ließ mich fortan nicht mehr los. Wenn jemand vor etwas Angst hat, so muss er die befürchtete Situation zunächst einmal in seiner Gefährlichkeit kennengelernt, genauer gesagt emotional erlebt haben. Ich wusste bereits von Konditionierungen, Reiz-Reaktions-Verknüpfungen und Auslösern, und so bestätigte sich in den folgenden Jahren während meines geisteswissenschaftlichen Studiums mein Verdacht. Es war das Gegenteil von dem, was ich an der Uni in den Vorlesungen hörte, denn da hieß es immer, Angst entstünde angesichts des Unbekannten. Aber einmal ehrlich, wenn Sie Angst vor dem Unbekannten hätten, dann hätten Sie auch Angst vor diesem Buch, denn Sie kennen ja den Rest des Inhaltes nicht. Sie müssten gleich morgens nach dem Aufwachen Angst bekommen, denn der Tag, der vor Ihnen liegt, ist unbekannt. „Niemand hat Angst vor ‚Schnirx‘“, sage ich heute bei meinen Vorträgen immer. „Warum nicht? Weil niemand ‚Schnirx‘ kennt.“ Wir haben nur Angst, wenn wir die Gefahr einer Sache bereits kennen oder sie mit einer ähnlichen Situation in Verbindung bringen. Ein Märchen brachte mich auf diesen Zusammenhang; meine Forschung in Sachen Angst wurde eine faszinierende und spannende Arbeit, denn dadurch zeigte sich mir der goldene Schlüssel zur Angstfreiheit, mit dem ich alle meine Ängste vollständig und in Sekunden auflösen konnte.
Zusammenfassung
Ängste und Blockaden basieren auf Erlerntem, haben eine Schutzfunktion und lassen sich durch das Bewusstmachen der ihnen gemeinsamen Ursache mit einer Verhaltensalternative versehen: entscheiden statt reagieren! Angstfreiheit ist somit Entscheidungsfreiheit.
Der gemeinsame Nenner
Fallbeispiel: Ed, Manager
Wochenlang hatte Edmund sich vorbereitet. Doch nun rann dem Manager mit einem Jahreseinkommen von rund 80.000 Euro der Schweiß von der Stirn, als er kreidebleich und mit zitternder Stimme vor der Jahreshauptversammlung sprechen sollte. Ed, wie seine Freunde ihn nannten, schlotterten die Knie. Er stand da wie ein hilfloses Kind. Er hangelte sich von Wort zu Wort, von Satz zu Satz. Seine Hände kneteten verkrampft die Zettel mit dem Redemanuskript. Die Buchstaben verschwammen vor seinen Augen. Immer wieder schaute Ed in die Versammlung und spürte die Blicke, die auf ihn gerichtet waren, deutlich wie Injektionsnadeln. Hier waren nicht seine Freunde, hier waren seine Henker, die nur darauf warteten, ihn endlich verurteilen zu können, so fühlte er sich. Ed war hilflos wie ein Kind.
Endlich, nach einer halben Ewigkeit wrang er den Schlusssatz des Berichtes durch seine Kehle. Er war so froh, sein Manuskript endlich hinter sich gebracht zu haben, dass er vergaß, sich beim Publikum für die Aufmerksamkeit zu bedanken. Den höflichen und verhaltenen Applaus für seine jämmerliche Vorstellung hörte Ed schon gar nicht mehr. Er ging von der Bühne, sank auf seinen Stuhl und stürzte den Rest eines Brandys hinunter. Den weiteren Abend verbrachte Ed vor der Tür, eine Zigarette nach der anderen rauchend, bevor er sich ein Taxi nahm und verschwand.
Fallbeispiel: Marta, Haushaltshilfe
Marta hatte Waschtag. Jeden Mittwoch und jeden Freitag kümmerte sich die junge Polin um den Haushalt ihrer Nachbarin, einer 82-jährigen Kriegerwitwe. Heute war also wieder Waschtag, und die alte Waschmaschine im Keller tat ihre ratternde Pflicht. Es war Mai, und Marta würde die Bettwäsche, die Handtücher und die große Tischdecke im Garten aufhängen. Die Frühlingssonne wärmte schon seit Tagen die Luft und ließ keinen Zweifel daran, dass es bald Sommer wurde.
Marta ging mit dem leeren Wäschekorb die dunklen Betonstufen der Kellertreppe hinunter. Lichtstrahlen fielen durch das vergitterte Kellerfenster, der Staub der Kellerluft teilte die Strahlen in ein flirrendes Muster. Bewegte sich da etwas über der Waschmaschine? Der große schwarze Fleck dort, war das ein Schatten, oder war es das, was Marta befürchtete? Das kleine Tier der Gattung Eratigena atrica machte sich mit seinen acht behaarten Beinen über eine fette Stubenfliege her, die soeben zappelnd in sein Netz gegangen war. Es wickelte sein bewegungsunfähiges Opfer in einen festen Kokon ein, in welchem es durch den mit dem Biss injizierten Verdauungssaft langsam von innen her zersetzt wurde.
Marta schrie, ließ den Wäschekorb fallen und rannte die Treppe hoch. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Oben angekommen, schüttelte sie sich vor Ekel, bevor sie begann, sich für ihre alberne Angst zu schämen. Es war schließlich nur eine Spinne.
Fallbeispiel: Ines, Arzthelferin
Die 65-jährige Rentnerin Renate würde vielleicht noch leben, wenn Ines in ihrem Auto nicht vor Angst erstarrt wäre. Renate wollte eigentlich nur ihren Plastikmüll etwas tiefer in die gelbe Mülltonne stopfen und übersah dabei, dass vorher irgendjemand eine zerbrochene Glasvase in den Müll geworfen hatte.
Mit der bloßen Hand und mit hochgekrempeltem Ärmel griff Renate in die großen, senkrecht stehenden Glasscherben, die zwischen Joghurtbechern und Gemüseverpackungen nicht zu sehen waren, und schnitt sich damit den ganzen Unterarm auf. Die Scherben schnitten tief in das Gewebe hinein und hielten den Arm wie Widerhaken fest. Das Blut quoll aus dem Arm der hilflosen Frau. Bis eine aufmerksame Nachbarin den Notarzt alarmierte, lag Renate bereits ohnmächtig vor der Mülltonne. Der Abtransport der Schwerverletzten erfolgte dann professionell und zügig, bis zur großen Kreuzung kurz vor dem Krankenhaus, wo er vor Ines’ Kleinwagen zum Halten kam.
Trotz Blaulicht und Sirene blieb Ines an der Ampel wie angewurzelt stehen und blockierte die Weiterfahrt. Die junge Frau am Steuer blickte mit weit aufgerissenen Augen und wie hypnotisiert in den Rückspiegel, das Dröhnen des Martinshorns hinter sich, und war unfähig, über die Kreuzung zu fahren – schließlich zeigte die Ampel ja rot. Als es endlich grün wurde, fuhr Ines mit quietschenden Reifen los, hatte aber leider in ihrer Panik den Rückwärtsgang eingelegt und krachte gegen den Krankenwagen. Wie bei jedem normalen Verkehrsunfall stieg Ines aus dem Auto, statt zunächst einmal schnellstmöglich die Kreuzung zu räumen und den Krankenwagen passieren zu lassen.
Schließlich konnte im Krankenhaus nur noch der Tod der Rentnerin festgestellt werden. Ines war durch das Ereignis so geschockt, dass sie sich fortan nicht mehr ans Steuer eines Autos setzte.
Fallbeispiel: Jörg, Auszubildender
Jörg war ein hervorragender Tischler und der Beste seines Jahrgangs in der Berufsschule. Für sein Gesellenstück, eine Spiegelkommode mit Schubfächern, wollte er nur die edelsten Hölzer verwenden.
Die drei Spiegel waren angeordnet wie ein mittelalterliches Triptychon, bei dem die dreigeteilten Kunstgemälde das mittlere Bild auf besondere Weise betonen. Man kennt das von zahlreichen religiösen Darstellungen: Jesus in der Mitte, und die Apostel links und rechts um ihn herum angeordnet.
Die Betrachterin im Spiegel würde durch Jörgs Triptychon zum künstlerischen Mittelpunkt, während sie sich frisiert und schminkt. Größere Schubkästen sollten Platz für Fön und Haarspraydosen bieten, mittlere für Parfüm und Abschminktücher und kleine Schubfächer zur Aufbewahrung von Schmuck dienen. Eher ein Meisterwerk als ein Gesellenstück, denn Jörg hatte hohe Ansprüche.
Den kompletten Entwurf hatte der 18-Jährige fix und fertig im Kopf. Nur mit der Umsetzung, für die er zwei bis drei Monate Zeit eingerechnet hatte, tat er sich schwer. Irgendetwas lenkte ihn immer wieder ab. E-Mails beantworten, ins Kino gehen, die Wohnung aufräumen, Freunde treffen, Faulenzen oder Joggen – es gab viel zu tun.
Und so verschob Jörg die Arbeit, die über seine Zukunft entscheiden sollte, immer wieder, bis er nur noch eine Woche Zeit bis zur Abgabe hatte. Als der Ausbildungsleiter zum wiederholten Mal nach dem Stand der Dinge fragte, entdeckte Jörg eine Katastrophe: die seltenen Hölzer, die er für sein Möbelstück ausgesucht hatte, waren wurmstichig! Aus den Zuschnitten rieselte Staub. Die Bretter standen monatelang unbeobachtet im Lager – nun waren sie gespickt mit kleinen Löchern und damit praktisch unbrauchbar.
Kein Holz, keine Kommode, kein Abschluss! Das Zögern des Auszubildenden ist bei Weitem keine Seltenheit in unserer Gesellschaft und hat sogar einen Namen: Prokrastination (Aufschieberitis) – eine Form von Perfektionismus, die Jörg nun beinahe seinen Arbeitsplatz kostete. Perfektionismus ist nicht etwa ein hoher Qualitätsanspruch, sondern die Angst, Fehler zu machen.
All diese Fallgeschichten haben eines gemeinsam: Es ist die erlernte Angst, oder genauer, der Versuch, eine bedrohliche Situation zu vermeiden. Ein in der Kindheit erlebter Stress ist die dahinterliegende Ursache dieser Angst.
Mit der Aufdeckung der Ursache beginnt auch die Umformung. Man muss allerdings genau an den Datenspeicher im Gehirn herankommen, in welchem die Ängste entstanden sind: die Emotionen. Das ist aufwendig und geht nicht immer schnell. Doch der Aufwand lohnt sich: Dass Ed nun ohne Schwitzen Vorträge hält, Marta Spinnen sogar nach draußen bringt, Ines mittlerweile wieder Auto fährt und Jörg rechtzeitig seine Aufgaben erledigt, spricht für sich und sollte Ihnen Hoffnung machen!
Das Besondere an der Angst ist nämlich, dass sie nur dann Macht über Sie hat, also Ihr Verhalten steuert, wenn sie im Unbewussten wirken kann. Sobald die genauen Angstauslöser bewusst sind, haben sie keinen Einfluss mehr auf das, was Sie tun oder fühlen. Mein langjähriger Freund und Mitarbeiter Darius Sobhan-Sarbandi formulierte es folgendermaßen, als wir einmal miteinander über Angst philosophierten:
Hast Du die Angst oder hat die Angst Dich?
Damit wird deutlich, dass der Besitzer einer Angst diese folgerichtig auch wieder loswerden kann – ein neuer Gedanke! Bislang glaubte man nämlich, man wäre seinen Ängsten ausgeliefert und könne nur mit extremer Disziplin oder Beruhigungsmitteln etwas dagegen tun. Aber brauchten Sie Disziplin, um Ihre Angst zu entwickeln? Nein! Und Angst lässt sich wie eine „Seifenblase zum Platzen“ bringen. Das genau ist es, wozu Ihnen dieses Buch verhelfen soll!
Mit einem kleinen Beispiel sei das verdeutlicht. Es handelt von Klaus, dem Klaustrophobiker aus meinem Buch „Heilen ohne Medikamente“: Klaus suchte mich auf, nachdem er als Erwachsener Angst vor Aufzügen entwickelte. In einer ersten Ursachenanalyse fiel ihm ein, dass er als Vierjähriger zusammen mit seinem Freund beim Spielen auf einer Baustelle in einem Erdloch verschüttet wurde. Dort bekam er – im Gegensatz zu seinem Freund – einen Panikanfall. Der Grund, warum das für ihn so unerträglich war, lag weiter zurück: Seine Geburt dauerte sehr lang, sodass er dabei fast gestorben wäre.
Wenn einem Klaustrophobiker bewusst wird, dass ein Geburtstrauma die Kriterien eng, dauert lange, ist lebensgefährlich, kann nicht kontrolliert werden und Licht oder Weite rettet lieferte, die er auf den Fahrstuhl übertragen hat, dann wird damit schlagartig klar, dass es nicht der Aufzug war, sondern die Geburt, die ihn bei Sauerstoffnot stresste.
Klaus verlor seine Angst innerhalb weniger Minuten durch meinen Hinweis, dass seine Klaustrophobie nur eine emotionale Erinnerung an ein Trauma darstellt, um ihn vor einer Wiederholung des Geburtstraumas zu warnen. Die Geburt kann sich aber nicht wiederholen, und der Aufzug stellt keine größere Gefahr dar als eine Treppe. Durch diese Information wird der Ursprung des Angstgefühls in unser rationales Bewusstsein gehoben, und damit kann die Angst verschwinden. Sie kehrt dann auch nicht mehr zurück.
Wir fuhren anschließend zum Test in einem klapprigen Lift mit flackernder Beleuchtung fünf Stockwerke auf und ab, doch Klaus lachte nur noch befreit. Sich bewusst zu machen, dass nicht nur ein Aufzug, sondern auch eine Treppe, ein Gehweg oder sogar die eigenen vier Wände gefährlich sein können, führt im Gehirn zu der Erkenntnis, dass Angst unwirtschaftlich ist. Die Psyche kann gar nicht anders, als auf das Angstmuster zu verzichten, sobald ihrer Wirksamkeit der Boden entzogen ist.
Ein brandaktuelles Beispiel habe ich vor wenigen Tagen in meinem Institut erlebt. Während der fünftägigen Ausbildung zum Coach demonstrierte ich den Teilnehmern, wie man über eine 15 Meter hohe Balkonbrüstung balanciert. Ich ging über den schmalen Steg und schaute nicht einmal auf meine Schritte, weit unter mir die Straße und die Autos, klein wie Spielzeug. Heike, einer jungen Frau aus Hamburg aus meinem Kurs, stockte fast der Atem, sie bekam Angstschweiß und Unruhegefühle – allein beim Zusehen durchs Fenster. Doch nach circa 15 Minuten ging sie selbst beherzt und lachend über die Balkonbrüstung, nachdem ihr in einer kleinen Hypnose klar geworden war, dass ihre Angst mit den Ängsten ihrer Mutter zu tun hatte – die ist nämlich als Baby aus dem Kinderwagen gefallen und hat die Tochter stets überbehütet behandelt und vor Höhe gewarnt. So versteckt und dennoch so logisch können Angstursachen sein.
Ein älteres Beispiel stammt aus einem meiner Vorträge, den ich mehrmals in meiner Wahlheimat Iserlohn gehalten habe. Dort wollte ich vor versammeltem Publikum mit einem Freiwilligen demonstrieren, wie ich eine Höhenangst auflöse. Karl-Heinz, ein Mann Anfang 60, meldete sich spontan. Seine Angst, die er seit dem zehnten Lebensjahr hatte, störte ihn enorm. Er musste auf Reisen mit seiner Frau oft bei Ausflügen auf Aussichtsplattformen und sogar beim Eiffelturm einfach passen und fühlte sich natürlich dabei wie ein Spielverderber. Nach vier Wochen schickte er mir ein Handyfoto aus einem 48 Meter hohen Riesenrad, das er selbst aufgenommen hatte. Seine Höhenangst war nach einer kleinen Reflexion im Anschluss an meinen Vortrag vor hundert Menschen verschwunden, und das innerhalb von weniger als 20 Minuten. So einfach kann das sein.
Ein physikalisches Gesetz macht den Ansatz zur Angstfreiheit zuverlässig. Es ist das Gesetz des geringsten Widerstandes. Es besagt, dass sich jedes Potenzial auszugleichen versucht, und zwar möglichst ohne Kraftaufwand und Energieverlust. Strom fließt stets durch die Leitung mit dem geringsten Widerstand. Wasser fließt nur einen Berg hoch, wenn eine Staumauer oder ein Unterdruck verhindert, dass es bergab fließen kann.
Genauso verhält sich auch unser Gehirn. Es fällt seine Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden, immer nach dem Gesetz des geringsten Widerstandes. Nun kommt es nur noch darauf an, was man als den geringsten Widerstand bezeichnet. Für den einen sind Spielregeln hilfreich, für den anderen sind sie Bevormundung. Der eine mag die Nachfrage nach dem Befinden, der andere empfindet dies als Einmischung oder Heuchelei. Der eine braucht Risiko und Herausforderung, der andere stirbt dabei fast vor Furcht. Wenn man ganz genau weiß, was der subjektiv empfundene Widerstand eines jeden Einzelnen ist, dann hat man den Hebel, mit dem man die Angst besiegen kann!
Der Algorithmus der Psyche
Den Algorithmus der Psyche habe ich einmal die Formel genannt, die unser Bestreben bestimmt. Sie lautet:
Die eigene Absicht widerstandsfrei verwirklichen.
Einfacher: Jeder Mensch will seine Bedürfnisse ohne weiteren Stress befriedigen. Wer müde ist, wird schlafen, es sei denn, das Bett brennt. Wer Appetit hat, wird essen, es sei denn, das schlechte Gewissen hat es ihm verboten. Niemand will, dass man sich in seine Absicht einmischt. Wenn Sie einem Kind sagen, dass es ins Bett gehen soll, wird es sich nicht für den guten Tipp bedanken, sondern sich über Sie ärgern – selbst wenn es sinnvoll wäre, ins Bett zu gehen. Es geht also immer darum, dass wir selbst entscheiden wollen, welchen Weg wir zu unserem Ziel einschlagen.
Jedes der drei Elemente der oben genannten Formel – eigene Absicht, widerstandsfrei, verwirklichen – hat eine eigene Größe, die gegen unendlich geht und nie gegen null gehen darf. Ist die Absicht verwirklicht, herrscht für einen Augenblick ein Zustand der Bedürfnislosigkeit.
Alle streben danach, die eigenen Absichten zu verwirklichen. Wir nehmen unglaubliches Leid in Kauf, nur weil wir den leichteren Weg zur Bedürfnislosigkeit nicht kennen. Der Algorithmus erklärt, warum Menschen lieber sterben, als ihr Verhalten zu ändern. Eine Verhaltensänderung würde mehr Stress erzeugen, als der Tod, so glauben sie.
Die Absicht von Klaus in oben genanntem Beispiel war, ins oberste Stockwerk zu gelangen. Dem stand die Angst zu ersticken entgegen. Er konnte sein Ziel nur erreichen, wenn er die Treppe nahm und den Aufzug mied. Obwohl die neunzehn Stockwerke ein enormer Aufwand waren, erschien ihm dieser Widerstand geringer als der unterbewusst befürchtete Verlust der Kontrolle über das Leben. Erst als er die Ursache seiner Angst reflektiert hatte, konnte er sein subjektives Empfinden kontrollieren und die Angst vor einem Aufenthalt im Aufzug überwinden.
Wenn ein Raucher wüsste, dass er auch ohne Zigaretten das Gefühl von Erleichterung bekommen kann, dann könnte er die fünf Euro pro Packung sparen, müsste weder Krankheiten befürchten noch Erniedrigungen durch das Rauchverbot in Kauf nehmen. Aber er weiß es nicht, deswegen raucht er beim Auslöser Bevormundung.
Wenn ein aufgrund der derzeitigen Migrationswelle verängstigter Bürger wüsste, dass die Menschen, die Tausende Kilometer hinter sich haben, viel mehr Angst haben als er selbst, dann wäre er ganz entspannt. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie zum Beispiel nach Singapur emigrieren würden, dort weder die Kultur kennen noch wissen, wie man seinen Wohlstand und seine Existenz sichert? Wenn die Menschen dann noch wüssten, dass der Islam keine trostspendende Religion ist, sondern ein uraltes politisches Konzept, dazu eines, das in einer humanistischen Welt kein Zukunftsmodell darstellt, und diese Menschen nun zu Tausenden in genau die Länder ziehen, in denen autoritäres Einschüchtern, Gewaltbereitschaft, Respektlosigkeit keine zeitgemäßen Werte darstellen, dann wären sie nicht nur entspannt, sondern könnten sich ihrer wichtigen Vorbildfunktion bewusst sein. Genauer, wenn Sie wüssten, dass man von Ihnen sogar gerne lernt, wie man ohne Gewalt und Bevormundung glücklich in Sicherheit erfolgreich wird, hätten Sie keine Angst vor einer islamischen Invasion (die es auch sicherlich nicht gibt). So einfach kann Angst verschwinden. Doch wie entsteht Angst überhaupt?
Angst entsteht durch Konditionierung
Ein Mensch kann vor allem, was ihn real oder eingebildet umgibt, Angst haben: vor Fremden, vor dem Tod, vor Spinnen, Prüfungen, Homosexuellen und Schokolade. Aber nur, wenn er durch genau diese Dinge irgendwann einmal in Gefahr geriet, sie also einen großen Widerstand für ihn darstellen. Da weder Tod noch Spinnen oder Schokolade gefährlich sind, sondern wir das immer nur befürchten, haben wir es genau genommen mit einer Konditionierung zu tun!
Was ist eine Konditionierung?
Stellen Sie sich vor, Sie bekämen in Ihrem Büro einen neuen Teppich. Weil Ihr Chef stets auf die Finanzen achtet, hat er einen besonders günstigen Teppich ergattert. Dieser besteht zu 100 Prozent aus Polyacryl und verträgt sich nicht mit Ihren Polyesterschuhsohlen vom Discounter (höchstwahrscheinlich werden Sie bei einem solchen Chef auch auf Ihr eigenes knappes Budget achten müssen). Die beiden Kunststoffe laden sich also bei jedem Schritt elektrostatisch auf.
Jedes Mal, wenn nun ein Kunde in Ihr Büro kommt und Ihnen seine feuchte Hand gibt, bekommen Sie durch die Entladung einen Stromschlag. Das passiert Ihnen drei-, viermal hintereinander, und Sie beginnen zu beten, dass niemand mehr Ihr Büro betreten und Ihnen die Hand geben möge. Durch das ständige Zusammentreffen beider Reize – Entladung und Handschütteln – wird die emotionale Bedeutung des einen Reizes auf einen bislang neutralen Reiz ausgeweitet.
Die gesamte Welt der Symbole hat diese Struktur. Ein Symbol besteht immer aus zwei Elementen: Etwas, das ist, und seiner Bedeutung. Die Ursprungsbedeutung des griechischen Wortes Symbállein (συμβαλλειν = Zusammenwerfen) deutet das bereits an.
So kommt es, dass Menschen tatsächlich glauben, Zigarettenrauch würde das Ausschütten von Glückshormonen erzeugen, obwohl ihnen jeder Nichtraucher beim Einatmen von Qualm etwas hustet und bestätigt, dass Qualm keineswegs glücklich macht. Der Raucher aber ist darauf konditioniert, dass Rauchen offenbar nur Erwachsenen erlaubt ist und in kleinen Pausen stattfindet: Er fühlt sich, sobald er qualmt, frei von Erwartungsdruck.
Dabei zeigt sich, dass wir voller Konditionierungen sind. So bekommen fast alle Menschen einen Adrenalinstoß, wenn man sie anschreit – dabei ist eine laute Stimme keinesfalls bedrohlich, wie jeder bestätigen kann, der schon einmal einen Operntenor live singen hörte. Noch nicht mal beim Gesang des Rocktenors Peter Hofmann (* 22.08.1944 – † 29.11.2010) bekamen die Menschen Angst. Laute Stimmen an sich erzeugen nämlich keinen Stress!
Das eigentlich Bedrohliche an einer lauten Stimme haben Menschen oftmals bereits während der Entwicklung im Mutterleib erfahren, wenn die eigene Mutter von Eltern, Partnern oder jemand anderem angeschrien wurde oder selbst Grund zum wütenden Schreien hatte. Mütterliche Stresshormone werden zeitgleich mit der lauten Stimme (die das Kind im Bauch ab etwa dem fünften Schwangerschaftsmonat hören kann) ausgestoßen – und das auch nur, weil früher bei der Kindeserziehung nicht nur geschrien, sondern auch geschlagen und verletzt wurde. Lernprozesse erhalten sich auf diese Weise durch die Mütter über Jahrhunderte hinweg!
Sie können bereits allein durch diesen Hinweis nun etwas gefasster bleiben, wenn man Sie anschreit.
Ein Erlebnis meiner Studentin Maria-Theresia Niegel aus Wettringen zeigt, wie differenziert sich Konditionierungen auswirken können – im folgenden Fall war eine brennende Waschmaschine Auslöser für drei Symptome:
Fallbeispiel: Brennende Waschmaschine
Vor ein paar Monaten führte Maria-Theresia ein Telefonat mit der Sachbearbeiterin ihrer Krankenkasse. Die freundliche und interessierte Mitarbeiterin fragte sie im Gespräch, wie denn die Arbeit als Coach genau aussehe. Meine Kollegin erzählte ihr von Ursachenanalyse, Symptomauflösung usw., woraufhin die Frau Hilfe suchend ein Gespräch über ihren 7-jährigen Sohn begann, der seit langer Zeit unter Neurodermitis, Asthma und einer besonderen Form von Autismus leide.
Sie hatten über die Jahre mehrere Therapeuten unterschiedlicher Art aufgesucht mit mäßigem Erfolg. Maria-Theresia stellte ihr am Telefon eine für uns Coaches klassische Analysefrage: ob während der Schwangerschaft irgendein tief greifendes Ereignis stattgefunden hätte. Das machte die Frau nachdenklich. Nach kurzer Überlegung sprach sie von einem Brand in ihrem Haus, bei dem sie fast umgekommen wären, da sich alle im Schlaf befanden. Ein Kurzschluss der Waschmaschine im Keller hatte den Brand ausgelöst. Maria-Theresia analysierte weiter:
Ich erkundigte mich daraufhin, ob bei ihrem Sohn die Symptome permanent auftauchen oder ob diese auftreten, wenn er unter starkem Stress oder Druck stehe. Sie bestätigte bereits meine Annahme und betonte noch, dass selbst der Autismus sich nur in solchen Situationen bemerkbar macht. Ich klärte sie darüber auf, dass Babys im Bauch ihrer Mutter über die Nabelschnur nicht nur mit Nährstoffen versorgt werden, sondern auch sämtliche Neurotransmitter, also auch Stresshormone abbekommen. Das Baby im Bauch geriet beim Hausbrand also ebenso wie die Mutter unter Stress. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was einem Menschen in so einer akut dramatischen Situation widerfährt. Todesangst, Panik, Hektik – oft kann man keinen klaren Gedanken mehr fassen und ist nur noch bemüht, das eigene Leben zu retten. Überforderung, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, das Ohnmachtsgefühl, allem ausgeliefert zu sein. Allein der Gedanke an so eine Tragödie erzeugt in uns oftmals bereits Stress.
Nun weiß ein kleines Baby aber nicht, dass es sich im Bauch seiner Mutter befindet und es deren Gefühle sind, von denen es da gerade überwältigt wird. Es wird wie von einem Blitzschlag aus heiterem Himmel davon getroffen. Was würde man selbst wohl machen, wenn man in einer solchen bedrohlichen Lage wäre? Nur raus hier und weg!
Daraufhin sagte die Frau am Telefon: „Oh mein Gott, jetzt weiß ich auch, warum ich plötzlich heftige Wehen bekam und in Panik geriet!“ Das Drama hatte also offenbar noch kein Ende. „Jetzt wird mir auch klar, warum mein Sohn, als er anfing zu laufen, immer zur Waschmaschine gegangen ist, auch wenn wir bei Freunden oder Verwandten waren!“ Das Kind hatte offenbar gelernt, dass das Geräusch einer funktionierenden Waschmaschine beruhigend ist.
„Irgendwann hat er dann damit aufgehört“, sagt sie. Ich vermutete, dass der Junge vielleicht einen Ersatz für die Waschmaschine gefunden hat. Vielleicht etwas, das so ähnlich klingt? „Das ist mir jetzt unheimlich!“ sagte die junge Mutter besorgt und fragte weiter: „Was kann man denn da machen?“
Ich entgegnete: „Das ist nicht unheimlich, das ist unterbewusster Stress. Um ihn zu überwinden, muss Ihr Sohn nur verstehen, dass es Ihr Stress war, nicht seiner, und er heute nicht mehr ‚gefangen‘ ist, sondern ihm andere Möglichkeiten zur Stressbewältigung offenstehen.“ „Das ist alles?“ „Ja, das ist alles und es ist nicht mal schwierig“, entgegnete ich.
Soweit ein Analysebeispiel meiner Kollegin Maria-Theresia Niegel. Die therapeutische Konsequenz wäre in diesem Falle, dem Kind in einer Traumreise diese Zusammenhänge imaginär zu zeigen, um ihm dann eine alternative emotionale Schlussfolgerung zu ermöglichen, damit seine stressbedingten Symptome abklingen können.
Wir sehen also, Konditionierungen können sehr differenziert sein. Man kann sogar ein und denselben Reiz mit verschiedenen Bedeutungen belegen.
Wenn Primarstufenschüler im langweiligen Unterricht sitzen, mit dem Schlaf kämpfen (weil ihnen vor lauter Disziplindruck der wertvolle Botenstoff Serotonin ausgegangen ist, jenes Hormon, das uns zur Aufmerksamkeit befähigt) und es läutet zur Pause, dann atmen sie erleichtert auf, sind wieder hellwach und rennen lärmend auf den Schulhof. Nachdem sie dort 15 Minuten lang Fangen, Gummitwist und Fußball gespielt haben, läutet es erneut. Rennen die Kinder nun wieder gröhlend in die Klasse? Nein! Sie verdrehen die Augen, stöhnen und schleppen sich wieder an ihren Platz.
Der gleiche Reiz kann eine völlig andere Bedeutung bekommen und damit eine völlig andere Reaktion auslösen. Das ist auch der Grund dafür, warum der eine Mensch dick wird, wenn er Schokolade isst, und der andere abnimmt. Letzterer macht etwa die sogenannte Schokoladen-Diät, hat somit nach drei Tagen die Nase gestrichen voll von Schokolade und fühlt sich nach dem Verzehr anders als ersterer.
Das bedeutet zugleich: Je mehr Angst und Stress ein Mensch dabei empfindet, seine geliebte Schokolade zu essen, desto dicker wird er, weil er sie mit einem komplizierten Stoffwechselbefehl zu Fett umbaut. Übergewichtige sind Menschen mit einer speziellen Angst vor Mangel. Wie man diese auflöst, habe ich in meinem Buch „Abnehmen ist leichter als Zunehmen“ beschrieben.
Geiz und Übergewicht sind Ausdruck ähnlicher Ängste. Geiz ist ein verzweifeltes Festhalten an etwas, das rar und selten erscheint und dessen Wert hoch eingestuft wird. Geiz ist somit ebenfalls eine erlernte Angst vor Mangel. Nicht selten sind „Messies“, also Menschen mit einer Wegwerf-Hemmung, auch übergewichtig.
Da Kinder ganz besonders lernfähig und noch sehr unkritisch sind, sollten wir im Umgang mit ihnen behutsam sein. Kinder sind leicht zu konditionieren und folgern nach kurzer Zeit automatisch, dass zwei völlig voneinander unabhängige Dinge „A“ und „B“ zusammengehören. Kinder glauben den abstrusesten Unsinn, wie etwa dass man sich anstrengen muss, um erfolgreich zu sein, dass man gut in der Schule sein muss, um später Geld zu verdienen, dass Fremde einem Böses wollen oder dass man, wenn man krank ist, zum Arzt gehen muss. Derart konditioniert gehen viele durchs Leben, ohne jemals kritisch zu prüfen, ob das überhaupt stimmt, was die halbe Welt denkt, und das, obwohl solche Gedanken großes Leid erzeugen und es Millionen Ausnahmen davon gibt. Die hartnäckigsten falschen Glaubenssätze, wie etwa „kalte Füße machen Schnupfen“ oder „Essen macht dick“, „nachts muss man schlafen“ usw. resultieren aus solchen Konditionierungen in der Kindheit. Die Konditionierung ist leider ein unglaublich mächtiger Faktor beim Erlernen von Verhaltensweisen – sie begleiten einen Menschen oft ein Leben lang. Solche selbst geschaffenen Verhaltensmuster haben ihren Ursprung in der Kindheit und werden durch Wiederholung, Bestätigung und tiefe emotionale Eindrücke verstärkt und unterbewusst auf weitere Reize übertragen. Da Stressreize für uns eine viel höhere Bedeutung haben, als alles andere, geschehen Konditionierungen dadurch wesentlich effektiver, nachhaltiger und schneller als mit Glücksgefühlen. Wir lernen schneller durch Schmerzen!
Viele Menschen sind überrascht, wenn ich ihnen erkläre, dass sie als Kind in den ersten drei Jahren ihres Lebens Erlebtes rein emotional erfahren haben und es daher auch nicht zeitlich einordnen konnten. Die Konsequenz, dass Bedrohliches als Situation von ewiger Dauer abgespeichert wird und somit ein Angstmuster erzeugen kann, verblüfft zwar viele, dennoch leuchtet es den meisten Klienten ein. Da dieses Ur-Trauma vom Kind als existenzbedrohlich empfunden und unterbewusst neuronal verschaltet wird, kann es ein Leben lang durch entsprechende Trigger – also Erinnerungen – aufgerufen werden, die dann den gleichen körperlichen Stress auslösen wie das Ursprungserlebnis.
Genau das ist der Grund, warum Angehörige häufig ratlos sind, wenn sie sehen, wie bei einem erwachsenen Menschen durch einen harmlosen Fahrstuhl, eine bevorstehende Flugreise oder einen Zahnarzttermin eine überschießende Angstreaktion ausgelöst wird. Ein Erwachsener empfindet Situationen mit einem ganz anderen kontextuellen Verständnis als ein Kleinkind – er weiß, dass Dinge wieder vorbeigehen und man sie auch aushalten kann. Ein Kind weiß das nicht! Dinge, bei denen ein Erwachsener nur gelassen mit den Achseln zuckt, erscheinen einem Kind wie eine lebensbedrohliche Katastrophe – und umgekehrt: Dinge, bei denen ein Kind glaubt, sein Leben sei in Gefahr, empfindet ein Erwachsener meist als Lappalie. Da die Logik der Symptome aber auf der Reife und der Macht eines Säuglings oder Kleinkindes basiert, welches sich vor der Wiederholung einer Traumatisierung schützen will und dieses Schutzmuster nicht bewusst entwickelt, wird ein Symptom immer deutlicher und stärker, je öfter die zu vermeidende Befürchtung eintritt.
Je häufiger ein Mensch re-traumatisiert wird, desto schlimmer wird seine stressbedingte Störung! Wenn jemand einfach nur Angstsymptome bekämpft oder mit Medikamenten unterdrückt, fürchtet er unterbewusst den Verlust seines Schutzkonzeptes, und das Symptom verschlimmert sich. Daher ist die sogenannte Konfrontationstherapie, bei welcher der Patient absichtlich in eine Angst machende Situation versetzt wird, oft von zweifelhaftem Erfolg.
Natürlich können Sie durch ständige Konfrontation mit Ihrer Bedrohung lernen, dass diese letztlich nicht so dramatisch ist, aber zum einen könnte man diesen Vorgang verkürzen, zum anderen etwas mehr methodisieren, und außerdem ignoriert die Konfrontationstherapie arroganterweise, dass eine Angst keine Dummheit ist, die man beseitigen muss, sondern ein intelligentes, aber eben irrationales Schutzkonzept gegen etwas, an das der Angstauslöser unterbewusst erinnert!
Wenn ich Ihnen immer wieder eine Spinne vor die Nase halte und Sie auffordere, die Spinne zu berühren, lernen Sie vielleicht, dass diese konkrete Spinne nicht gefährlich ist. Vielleicht lassen Sie sich dann das Tier sogar über die Hand laufen, aber Sie lernen vor allem, dass Sie zuvor offenbar ein Idiot oder eine Memme gewesen sein müssen, sonst wäre ja nicht alles so einfach aufzulösen. Warum Sie aber Angst vor Spinnen hatten – und diese hat einen ernsten Hintergrund –, wissen Sie dann noch immer nicht.
Unser Denken beginnt also bereits weit vor der Geburt (was viele Menschen nicht wissen). Darüber hinaus kann unser Gehirn nichts vergessen und jederzeit alles Datenmaterial durch das Antriggern von Emotionen abrufen.
Erforscht wurde die immense Verknüpfungsfähigkeit des Gehirns bereits Anfang des letzten Jahrhunderts vom russischen Naturforscher und Nobelpreisträger Iwan Pawlow (1849–1936). Er stellte fest, dass immer dann, wenn er seine Laborhunde füttern wollte, die Tiere in freudiger Erwartung aufsprangen, noch bevor er die Näpfe gefüllt hatte. Er untersuchte diese Beobachtung wissenschaftlich. Dazu operierte er einem Hund, der als Pawlowscher Hund ein Begriff wurde, ein Glasröhrchen in den Unterkiefer ein, sodass man sehen und messen konnte, ob und wie viel Speichel dem Hund im Maul zusammenfließt. Dann stellte Pawlow seinem Hund einen Futternapf hin, der Hund bekam Speichelfluss. Irgendwann schlug Pawlow ein kleines Glöckchen an. Was geschah nun mit dem Hund? Nichts. Dem Tier bedeutete das Gebimmel nichts. Doch dann schlug Pawlow das Glöckchen immer kurz bevor er seinem Hund etwas zu fressen gab an. Und nach nur drei Wochen konnte er beobachten, dass die Hunde bereits auf den Glockenton mit Speichelfluss reagierten. Der Körper des Hundes zeigte eine Reaktion. Pawlow hatte nur das Glöckchen angeschlagen und gar kein Futter ausgeteilt, trotzdem bekamen die Hunde Speichelfluss – eine Verknüpfung zwischen Glöckchen und Futter hatte stattgefunden. Dem Tier lief das Wasser im Mund zusammen, weil es erwartete, es gäbe gleich etwas zu fressen.
Eine erlernte Erwartung erzeugte eine körperliche Reaktion! Fällt Ihnen dabei etwas auf? Angst mit Herzrasen, Zittern, Schwitzen und Übelkeit ist ebenfalls eine körperliche Reaktion. Erwartungen lassen sich leicht automatisieren, denn das spart für das Gehirn eine Menge Energie. Und nicht nur der Hund ist aus diesem Grund ein Gewohnheitstier, sondern jedes Wesen mit einem Gehirn – auch der Mensch. Dieses Gehirn ist zwar unfassbar lernfähig und in seinen Rechenoperationen präzise, arbeitet aber leider zum überwiegenden Teil im Verborgenen – eben unbewusst. Es heißt, nur etwa drei bis fünf Prozent unserer gedanklichen Leistung würde ins Bewusstsein geraten. Dafür, dass wir uns alle für so rationale Wesen halten, ist das eher beschämend gering. Das große Problem unserer fleißigen grauen Masse unter der Schädeldecke ist, dass es alles wahrnimmt und nichts vergisst. Das Gehirn ist ein Hochleistungs-Großrechner, der hauptsächlich aus Wasser besteht. Es kümmert sich um sämtliche Zellen und Funktionsvorgänge im Körper und schläft nie! Dennoch ist das Gehirn der am meisten unterschätzte Körperteil. Es ist unsere Kommandozentrale und kann alles veranlassen, was wir für möglich halten. Dies geschieht mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit, die jeden noch so leistungsfähigen PC um Tausendfaches übertrifft. Daher können wir innerhalb von Sekundenbruchteilen herausfinden, ob uns ein Mensch bekannt vorkommt, sympathisch erscheint, ob wir seine Stimme mögen etc. Das schafft kein Computer – doch sogar ein Kind kann dies mühelos.
Diese Eigenschaft der Konditionierung verhilft uns natürlich auch zu enormen Erleichterungen. So müssen wir nicht jedes Mal neu nachdenken, was eigentlich das rote Licht an der Verkehrsampel bedeutet. Bis wir darüber philosophiert haben, dass die rote Farbe uns möglicherweise an Blut erinnert, und wo Blut ist, da ist auch Verletzung und somit Gefahr – wir sollen also stehen bleiben … Und was bedeutet noch einmal Grün? Ist dies nicht Natur, Leben, Fruchtbarkeit, Nahrung? Also alles in Ordnung, ich kann fahren – zack! Rot! Konditionierungen sind sinnvoll, aber eben nicht immer, wie wir bereits gesehen haben.
Das Gehirn vergisst – leider – nichts!
Ebenso unvorstellbar hoch wie seine Rechenleistung ist die Speicherkapazität des menschlichen Gehirns. Auf CD-ROM gebrannt, würden diese Daten einen Turm von rund 6,8 Millionen CDs mit 16 Kilometern Höhe und einem Gewicht von mehr als 1,2 Tonnen ergeben. Hinzu kommt, dass unser Gehirn vermutlich noch nicht einmal das einzige menschliche Datenverarbeitungsorgan ist. Nicht nur, dass unser gesamter Magen-Darm-Trakt von einem Nervengeflecht umhüllt ist und seine eigenen Verdauungsregeln erstellt – sogar unser Herz, so glauben Neurobiologen, arbeitet autonom und kann in gewissem Rahmen „Entscheidungen“ zur Regulierung des Organismus fällen. Die neuesten Ergebnisse in der Hirnforschung zeigen: Wahrscheinlich ist unser Gehirn sogar in der Lage, über die Zirbeldrüse auch ohne die Hilfe unserer Sinnesorgane Informationen einzufangen. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir physikalisch (noch) nicht Messbares wahrnehmen können. Orientierung im Dunkeln oder das Registrieren von Gefahr gehören genauso dazu wie Vorahnungen von Tod oder Krankheit von Verwandten. Auch das Erdmagnetfeld wird vom Menschen unbewusst erspürt. Ob wir diese Fähigkeiten nutzen und trainieren, hängt von Glauben, Kultur, Förderung, Interesse aber auch von Selbstsicherheit, also von Angstfreiheit, ab.
Ich möchte im Folgenden zeigen, dass Sie sich mit einer bestimmten Gesprächstechnik, in der Sie Ihre emotionalen Hirnareale nutzen, präzise und überprüfbar daran erinnern können, wo Sie als Kleinkind laufen gelernt haben, was Sie anhatten, worauf Sie zugegangen sind und vor allem wann, an welchem Datum und Wochentag genau das gewesen ist! Probieren Sie es aus! Setzen Sie sich bequem hin, und versetzen Sie sich mit geschlossenen Augen und in echter Ruhe (!) imaginär in die Situation, in der Sie mutmaßlich Ihre ersten eigenen Schritte gegangen sind. Lassen Sie sich von den Gedanken, die da hochkommen, einfach lenken, nehmen Sie diese ernst! Kontrollieren Sie nicht mit Logik und Verstand! Dann fragen Sie sich selbst nach Jahreszeit, Monat, Datum und Wochentag. Das Ergebnis können Sie mit einem elektronischen Kalender überprüfen. Wir führen diesen Test in unserem Institut seit 2010 standardmäßig mit einem Großteil unserer Klienten durch. Unsere Testpersonen lagen nur zu etwa 20 Prozent im ersten Durchlauf daneben. Doch wenn im zweiten Test fast alle eine korrekte Datum-Wochentag-Konstellation nennen, so wie ich es in meiner Praxis seit Jahren erlebe, dann trauen Sie dem Gehirn auch zu, dass es sich genau an die Geburt und an die Monate davor und danach erinnert. In dieser Zeit nämlich werden die Angstprogramme „geschrieben“.
Zwar heißt es, Ängste würden über die Erbanlagen weitergegeben werden. Das ist vielleicht in engen Grenzen nicht ganz auszuschließen, jedoch halte ich es für wesentlich bedeutungsvoller, dass erstens Lernprozesse bereits in einem sehr frühen pränatalen Entwicklungsstadium stattfinden, dass wir also die Emotionen der Mutter erlernen, und dass sich zweitens Erbanlagen über Jahrmillionen im Erbgut halten können Dies würde bedeuten, dass sich auch Mut und Coolness vererben lassen. Es müsste also einen Grund geben, warum ein der Angst konträres Programm sich nicht dominant durchsetzen sollte, denn da Angst das Verhalten beeinträchtigt und die Abwehr schwächt, müsste der Zweig der ängstlichen Menschen folglich längst ausgestorben sein. Davon abgesehen: Wenn ein Mensch innerhalb von Minuten seine Angst vollständig und rückfallfrei, mess- und überprüfbar, allein durch eine Erkenntnis überwindet, kann mir niemand von Erbanlagen erzählen. Ängste sind ein geisteswissenschaftliches Thema und keines der Biologie. Nur der Vollständigkeit halber sei gesagt: Es gibt Menschen, die mir sagen, sie hätten ihre Ängste deswegen, weil sie in angeblichen früheren Leben Traumatisches erlebt haben. Abgesehen davon, dass ich die Annahme früherer Leben nicht ablehne, so muss es aber eine Erklärung geben, warum wir ausgerechnet in diesem Leben ein Problem bekommen, denn wenn es ein früheres Leben gab, dann muss es davon sehr viele gegeben haben. Das bedeutet, wir alle sind schon einmal verhungert, an einer Krankheit verreckt, erschlagen oder von einem Raubtier gefressen worden. Warum sind wir dann nicht alle zum Schutz davor übergewichtig, misstrauisch, tierscheu und Gesundheitsfanatiker? Antwort: Weil es erst in diesem Leben einen Grund, einen Auslöser für das Angstprogramm geben muss.
Übrigens gehe ich mit meinem physikalischen Verständnis davon aus, dass sich auch Informationskomplexe anreichern, also weiterentwickeln können. Man kann ein Kochrezept verfeinern, eine Sinfonie ausarbeiten und auch ein Computerprogramm verbessern. Doch teile ich nicht die Sicht einiger Rückführungstherapeuten, es gebe eine Art Gericht, das darüber entscheidet, dass ein Verbrecher beispielsweise im späteren Leben als Opfer zur Welt kommt, um sein Karma auszugleichen. Dies ist meines Erachtens unlogisch und entspricht nicht der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Denn dann müssten ja alle Katzen als Mäuse wiedergeboren werden, um das Verbrechen an ihnen zu sühnen, und diese Mäuse müssten dann als Pflanzen oder Würmer reinkarnieren. Die Evolution wäre damit rückläufig. Oder glauben die Rückführungstherapeuten etwa, es gäbe einen karmischen Unterschied, ob ich einen Artgenossen töte, ein Lebewesen in meiner Nahrungskette erbeute oder Wale und Delfine für Forschungszwecke abschlachte? Mir persönlich leuchtet die streng physikalische Erklärung des Algorithmus eines Organisationsfeldes, das sich schlicht materiell niederschlägt und mit Informationen anreichern kann, am ehesten ein. Sicherlich entscheidet die Absicht darüber, wie eine Tat, ein Gedanke, ein Verhalten zu bewerten ist, aber wer bewertet die Absicht?
Ich werde oft gefragt, ob das, was einem Menschen durch den Kopf geht, nicht einfach nur Fantasie sei. Meist ist es das nicht. Man kann Fantasie von Erlebtem durch zwei Kriterien relativ sicher voneinander unterscheiden:
→Authentizitätsempfinden: Fantasie besteht nur aus sehr geringen Datenmengen und hinterlässt kein starkes Gefühl von Echtheit. Real Erlebtes hingegen umfasst viel mehr Informationen, sodass hier bei einer Erinnerung der Körper angesteuert wird. Es fühlt sich subjektiv wesentlich echter an als Fantasie und kann auch deutliche körperliche Reaktionen (Weinen, Husten, Würgen, Schmerzen) hervorrufen.
→Erinnerbarkeit: Erlebtes hat eine unendlich hohe Datentiefe (Bitrate), und man kann sich daher auch nach Jahren noch präzise daran erinnern und dadurch weitere Details zutage fördern (die wiederum körperliche Reaktionen auslösen können). Fantasie hingegen verblasst zunehmend, weil die Daten überlagert werden.
Allerdings gibt es auch sogenannte Hilfsfantasien, die zwar formal genau dem Erlebten entsprechen, aber inhaltlich davon abweichen. Diesen Effekt kennen Sie aus dem Kino, wenn Sie etwa aufgrund der Handlung zu weinen beginnen. Sie selbst haben zwar sicher nicht die gezeigte Handlung erlebt, aber etwas Entsprechendes, sodass Sie die Situation nachempfinden können. Das Gezeigte tritt mit Ihren erlebten Erinnerungen in Resonanz, Trigger oder Auslöser nennt man das.