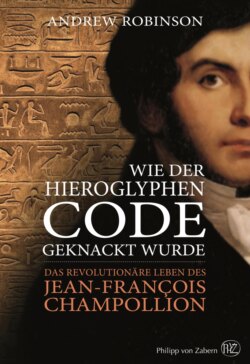Читать книгу Wie der Hieroglyphen-Code geknackt wurde - Andrew Robinson - Страница 8
2 EINE KINDHEIT IN DER REVOLUTIONSZEIT
ОглавлениеZum Glück sind mir Schnabel und Krallen gewachsen.
(Jean-François Champollions Lieblingswort zur Beschreibung seiner Kindheit)18
Von den Hunderten, wenn nicht Tausenden von Replikaten des Rosettasteins, die seit 1800 hergestellt worden sind, ist zwischen der lithographischen Kopie, die französische Fachleute von dem gerade erst entdeckten Kunstwerk in Kairo gemacht haben, bis zum heutigen Mauspad mit dem Rosettastein, wie es im British Museum verkauft wird, das großartigste Beispiel eine schwarze Platte aus afrikanischem Granit, die eine Abschrift des ganzen Textes enthält. Sie ist elf Meter lang und achteinhalb Meter breit und ist damit über hundert Mal größer als die Fläche des Originals. Sie bedeckt den Fußboden eines kleinen, von romanischen Mauern umgebenen Hofraums in Frankreich fast vollständig; dieser Ort heißt passenderweise Place des Écritures (Platz der Schriften). Die Platte trägt drei eingemeißelte, deutlich voneinander getrennte Textblöcke, jeweils einer für eine Schriftart. Ein Fußgänger kann also herantreten und über die griechische Textfassung gehen, er kann weiter über den demotischen Text gehen und schließlich zum hieroglyphischen Abschnitt gelangen, dessen linke Ecke stark beschädigt ist. Geschaffen hat dieses Werk der amerikanische Konzeptkünstler Joseph Kosuth aus Anlass des zweihundertsten Geburtstags Champollions; es befindet sich unmittelbar neben dem Musée Champollion in Figeac, dem Städtchen, in dem Champollion 1790 geboren wurde.
Figeac liegt in einem vom Flüsschen Lot durchzogenen Tal zwischen grünen Ausläufern des Zentralmassivs im Südwesten Frankreichs. Es gehört heute zum Departement Lot, im 18. Jahrhundert jedoch war es ein Teil der alten Provinz Quercy; in der Zeit der römischen Herrschaft gehörte es zu Aquitania Prima. Die Stadt dürfte aus einer römischen Siedlung hervorgegangen sein. Nicht weit entfernt vermutet man das Gebiet von Uxellodunum – die auf einem Hügel gelegene Festung, wo die Legionen Julius Caesars im Jahre 59 v. Chr. die Gallier endgültig besiegt haben sollen. Champollion hat diesen Schauplatz zu lokalisieren und 1816 mit seinem Bruder auszugraben versucht. Während des 9. Jahrhunderts n. Chr. war die Provinz ein Teil des fränkischen Königreichs Aquitanien. Figeac war auch ein Herbergsort auf einer der Pilgerrouten zum Schrein des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela in Spanien. Um das 12. Jahrhundert hatte es sich zu einer bedeutenden Handelsstadt entwickelt. Das lässt sich noch feststellen an seinen früheren Kaufmannshäusern mit ihren Sandsteinfassaden, mittelalterlichen Arkaden mit kleinen boutiques und soleilhos – auf Säulen ruhenden, zur Sonnenseite offenen Mansarden, in denen zum Beispiel Früchte getrocknet wurden. Im 13. Jahrhundert handelte Figeacs Benediktinerkloster mit Wollkleidung, Wein und Honig; seine Handelsbeziehungen reichten bis nach England, Zypern und in den Mittleren Osten.
Kurz nach seiner Ankunft in Figeac 1781 notierte einer der Finanz- und Steuerinspektoren König Ludwigs XVI. in seinem Reisetagebuch, die Bevölkerung dieser Stadt betrage etwas mehr als 6.000 Einwohner bei einer Gesamteinwohnerzahl von rund 100.000 in der Provinz von Quercy. Signifikante Produkte der Stadt seien Wein, Weizen, Roggen, Hanf, Heu, Walnüsse und Kastanien. Öl verschiedener Art importiere man aus dem Unteren Languedoc und Käsesorten aus der Auvergne, während andere Waren aus dem weit im Westen gelegenen Bordeaux auf Flusskähnen, Pferdewagen oder auf dem Rücken von Maultieren herbeigeschafft würden. An geistigem Leben gebe es jedoch nicht allzu viel in dieser Gegend. Worin lägen überhaupt die geistigen Eigentümlichkeiten der Bewohner der Provinz Quercy? »Es gibt keine geistigen Eigentümlichkeiten«, lautete die Antwort. »Überhaupt ist die geistige Beweglichkeit sehr eingeschränkt und die intellektuellen Fähigkeiten sind nur schwer zu aktivieren, wenn irgendeine neue Methode zu begreifen ist. Generell gesehen, gibt es größere Aktivitäten vor allem im Bereich des ländlichen Lebens, weniger jedoch im Bereich der gehobenen Kultur.«19
Jacques Champollion, der Vater von Jean-François, zog 1770 nach Figeac und eröffnete eine Buchhandlung, die über viele Jahre prosperierte. Er stammte nicht aus der Provinz Quercy und hatte sich von seinem Geburtsort ziemlich weit entfernt. Der lag in einem Tal der Alpen in der Provinz, die damals die Dauphiné hieß, sehr nahe bei Grenoble, rund 300 Kilometer östlich von Figeac. Trotz aller Versuche, die verschiedene Biographen und auch Mitglieder der Familie Champollion angestellt haben, eine vornehme Linie unter den Vorfahren aufzufinden, erwies sich Jacques’ Ahnenreihe sozial als relativ niedrig – sie lag etwa im bäuerlichen oder kleinbürgerlichen Bereich. Es dürfte italienisches Blut in sie eingeflossen sein; der Familienname könnte möglicherweise von dem Namen Campoleone herrühren. Eine solche Verbindung zum Nachbarland könnte bei Jean-François durchaus mitgewirkt haben, als er als Wissenschaftler in den 1820er-Jahren Italien aufsuchte. Jacques, der 1744 geboren war, war der jüngste von fünf Söhnen. Drei von ihnen verblieben ihr Leben lang in der Gegend ihrer Geburt; der vierte jedoch, André, ging zum Militär, wurde Offizier und zog 1798 in Napoleons Armee nach Ägypten.
Wie bei fast allen Aspekten, die sich auf das Leben von Champollions Vater beziehen, bleiben dessen Motive, aus der Dauphiné nach Figeac zu ziehen, im Dunklen, weil es dafür so gut wie keine oder zumindest keine direkten Aussagen oder sonstigen Nachweise gibt. Man weiß aber immerhin, dass er bis 1770 sein Brot als Reisender oder Hausierer für Bücher verdient hat. Die in der Nähe Grenobles zwischen Frankreich, Savoyen, der Schweiz und Italien gelegene Grenzregion war sicherlich ein aussichtsreicheres Gebiet für einen Buchhändler dieser Art als das nur Französisch sprechende, auf Kommerz orientierte Figeac, wobei es gleichgültig ist, welche Handelsbeziehungen die Stadt auch mit anderen Regionen Frankreichs gehabt haben mag. In der Dauphiné waren die Hausierer allerdings gezwungen, sich weit von ihren Heimatorten zu entfernen, um sich während der in den Alpen besonders langen Wintermonate finanziell über Wasser halten zu können. Einen Höhepunkt in verkaufstechnischer Hinsicht bildete für Jaques Champollion im Verlauf eines Jahres sicherlich der Jahrmarkt von Beaucaire, einem Städtchen in der Nähe von Avignon; er war bereits Jahrhunderte lang berühmt in ganz Südfrankreich, bis eine Eisenbahnverbindung angelegt wurde; in seiner Glanzzeit zog er an die 300.000 Besucher an. Möglicherweise ist Jaques Champollion auf einer Geschäftsreise nach Figeac gekommen, das Städtchen hat ihm gefallen, und er hat beschlossen, sein Wanderleben aufzugeben und sich niederzulassen zugunsten einer angenehmeren, ruhigeren Existenz. Es ist jedoch ebenso möglich, dass er seiner politischen Meinungen wegen aus seiner Heimat verbannt wurde, vielleicht, weil man festgestellt hatte, er habe verbotene Bücher verkauft. Später sind ja auch seine Söhne aus Grenoble verbannt worden. Im 16. Jahrhundert waren auf Veranlassung der kirchlichen Autoritäten reisende Buchhändler verbrannt worden, die ketzerische Schriften anboten, und im 17. und 18. Jahrhundert hatte die Regierung sie ins Gefängnis geworfen, wenn sie Flugschriften verkauften, die die Macht des Königs in Frage stellten. Jaques Champollions künftige Rolle bei der Französischen Revolution könnte eine solche ›republikanische‹ Interpretation seines Umzugs nach Figeac im Jahre 1770 nahelegen – und das gilt auch für die Tatsache, dass er nie wieder an seinen Geburtsort zurückgekehrt ist.
Nach zwei Jahren in Figeac kaufte Jacques ein Haus mit der üblichen offenen soleilho; es lag in einer dunklen, engen Gasse im Stadtzentrum, in der Rue de la Boudousquerie. Heute ist sie umbenannt worden in Impasse Champollion. Sieben Jahre später kaufte er eine boutique: einen kleinen Laden mit einem Fenster, durch das man den Zentralmarkt der Stadt überblicken konnte. In der Zwischenzeit hatte er Jeanne-Françoise Gualieu geheiratet, die aus Figeac stammte. Diese Verbindung verschaffte ihm zweifellos den Zugang zur Welt der städtischen Kaufmannschaft und des gesellschaftlichen Lebens überhaupt. Jeanne-Françoise war die Tochter eines in der Stadt etablierten Fabrikanten; ihr Vater und ihr Großvater waren Besitzer einer Weberei, ihre Mutter gehörte einer wohlbekannten Familie der Stadt an, die früher einmal den Bürgermeister gestellt hatte. Jeanne-Françoises zwei jüngere Schwestern waren verheiratet mit einem Färber und einem Gerber. Der Name Gualieu erscheint in den Archiven der Stadt häufig; er hat entweder mit einfachen Handwerkern zu tun oder mit Würdenträgern der Stadt. In höchstem Maße überraschend ist jedoch, dass Jeanne-Françoise Analphabetin gewesen zu sein scheint: Im Heiratsregister der Kirche von Figeac, Notre-Dame-du-Puy, ist festgehalten, dass sie bei der Trauung 1773 nicht imstande war, mit ihrem Namen zu unterschreiben.
Das erste Kind des Paares, ein Sohn, starb 1773 wenige Stunden nach der Geburt. Ein Jahr später wurde eine Tochter geboren, zwei Jahre nach der ersten eine zweite. Ihr folgte 1778 ein Sohn; ein dritter Sohn starb ebenfalls kurz nach der Geburt, und eine weitere Tochter 1782, als Jeanne-Françoise wahrscheinlich 40 Jahre alt war. Von da an dauerte es bis zum Jahr 1790, in dem Jean-François, das jüngste Kind, geboren wurde.
Obgleich Jean-François seinen zwei Schwestern nahegestanden haben dürfte, die darauf aus waren, den kleinen Bruder zu verwöhnen, war es sein zwölf Jahre älterer Bruder Jacques-Joseph, der den bei weitem größten Einfluss auf sein Leben ausgeübt haben dürfte, und zwar sowohl auf das Kind wie auf den Mann – und einschließlich seiner Eltern. In der Tat – ohne die wortwörtlich lebenslange Hilfe und das savoir-faire seines Bruders hätte die Welt höchstwahrscheinlich niemals etwas von Jean-François Champollion gehört. In seinem späteren Leben nannte sich der ältere Bruder Champollion-Figeac, wohl auch, um sich von seinem berühmteren Bruder zu unterscheiden, der bekannt war als Champollion le jeune. Champollion-Figeac wurde Paläograph und Bibliothekar, zunächst als Kurator der Manuskripte in der Bibliothèque nationale in Paris und schließlich im Schloss Fontainebleau. Auch er wurde durch seine Arbeiten so bekannt, dass er einen Artikel in der heutigen Encyclopaedia Britannica erhielt. Er hat weiterhin die posthumen Werke seines Bruders herausgegeben. Der Champollion-Biograph Jean Lacouture vergleicht Jean-François und seinen Mentor Jacques-Joseph sogar mit Vincent van Gogh und dessen Bruder, dem Kunsthändler und -sammler Theo van Gogh; das hat sicherlich eine beträchtliche Aussagekraft, wenn auch Theo natürlich jünger war als Vincent. Um den jüngeren Champollion zu verstehen, ist es sicherlich nützlich, sich kurz mit der Kindheit und den Jugendjahren des älteren Bruders Jacques-Joseph zu beschäftigen.
Das Geburtshaus Jean-Jacques Champollions (oben rechts) in der Rue de la Boudousquerie, jetzt umbenannt in Impasse Champollion, Figeac. Hier lebte er von 1790 bis 1801.
Ironischerweise war Jacques-Joseph ein schwächliches Kind, das jedoch weit über 80 Jahre alt werden würde; sein jüngerer Bruder war dagegen ein kerngesunder Junge, der bereits in seinen frühen Vierzigern an einem Schlaganfall sterben sollte. Es gab durchaus berechtigte Zweifel, ob Jacques-Joseph seine Kindheit überleben würde, aber sobald er einige Worte sagen konnte, gaben seine Eltern ihn – vielleicht weil sie mit seinem zerbrechlich-zarten Wesen nicht umzugehen wussten – in die Obhut einer alten, frommen Frau, ›La Catinou‹; sie nahm ihn in ihr Haus auf, behielt ihn bei sich, bis er sieben Jahre alt geworden war, und vermittelte ihm eine elementare Erziehung.
Porträt Jacques-Joseph Champollion-Figeacs, des älteren Bruders Jean-François Champollions, im Alter von 20 bis 30 Jahren.
Nach der Rückkehr in sein Elternhaus erhielt Jacques-Joseph einen Unterricht von durchschnittlicher Qualität; als er 1791 gerade 13 geworden war, wurde seine Schule infolge der Revolution geschlossen, und gleichzeitig kam damit seine formale Erziehung zu ihrem Ende. Es folgten einige turbulente Jahre; sie gipfelten in der Schreckenszeit von 1793–1794, in der die Stadt auf einem kleinen quadratischen Platz den Baum der Freiheit und darunter die Guillotine aufstellte – und das alles in Hörweite von Champollions Haus. Hermine Hartleben, Champollions erste Biographin, behauptet, das Haupt der Familie, Jaques Champollion, sei während dieser Zeit neben zwei Mitbürgern zum Vorstand der städtischen Polizei ernannt worden. Er habe diese offizielle Position überraschenderweise dazu gebraucht, den schwer gefährdeten Benediktinern Seycy (aus Nizza) und Dom Calmels dauernden Schutz zu gewähren. Wenn das zutreffen sollte, obwohl es sehr zweifelhaft ist, wäre es ein gefährliches, riskantes Verhalten gewesen. In den frühen Jahren der Revolution, »waren diejenigen, die die meisten Gründe hatten, sich zu fürchten, diejenigen, die Priestern Schutz gewährten, die sich weigerten, mit der Revolution zusammenzuarbeiten«, schreibt der Historiker Richard Ballard in The Unseen Terror, seiner Studie über die französischen Provinzen in den Jahren nach 1790.20 Es gibt keine städtischen Akten oder schriftlichen Zeugnisse, die Hartlebens Behauptung stützen könnten; sie selbst verlässt sich dabei auf Aussagen der Familie Champollion. Allerdings war, ebenso wie Jacques-Joseph selbst, zu dieser Zeit Calmels damit einverstanden, auf freundschaftlicher Basis für Jacques-Josephs Erziehung zu sorgen. Dass Jacques, sein Vater, ganz gewiss Einfluss in der Heimatstadt hatte, geht schon daraus hervor, dass während der Schreckenszeit der fünfzehn Jahre alte Jacques-Joseph eine bezahlte Stelle in der Stadtverwaltung erhielt, wo er es bald zum verantwortlichen Archivar und zum Assistenten des Hauptsekretärs brachte. Es war sein erster Schritt in die Arbeitswelt der Verwaltung, dem weitere Schritte auf der Karriereleiter folgten, obwohl sie den politischen Wirrnissen des postrevolutionären Frankreichs ein halbes Jahrhundert lang ausgesetzt bleiben sollten.
Diese Informationen beruhen auf einer unpubliziert gebliebenen Autobiographie, die Jacques-Joseph 1799 im Alter von 21 Jahren geschrieben hat – ein Jahr, nachdem er Figeac verlassen hatte, um eine Stelle in Grenoble anzutreten. In seinem detaillierten Manuskript macht er keinerlei Angaben zur Geburt seines Bruders Jean-François am 23. Dezember 1790, obgleich er sogar Pate des Kindes war, wie das Taufregister ausweist. Dieser erstaunliche Verzicht lässt zusammen mit anderen Sachverhalten, auf die wir noch zu sprechen kommen, die Vermutung entstehen, dass die Wahrheit über diese Geburt sich ziemlich von der Legende unterschieden hat, die in der Familie Champollion aufgekommen war und die von Hartleben in ihrer Biographie ohne jeden Kommentar weitergegeben worden ist.
Zunächst etwas zu der Legende. Die Quelle ist ein Nachruf auf Champollion, den nach dessen Tod im Jahre 1833 ein Dr. Janin geschrieben hat, ein Arzt, der ihn persönlich gekannt und ihn untersucht hat. Nach dessen Darstellung war Champollions Mutter in ihrem vierten Lebensjahrzehnt so heftig an Rheumatismus erkrankt, dass sie völlig gelähmt in apathischem Zustand ihrem Ende entgegen zu dämmern schien. Die Ärzte konnten nichts mehr für sie tun, und deshalb nahm man Zuflucht zu einem heilkundigen Mann vom Lande, zu einem gewissen Jacquou, dem ›Zauberer‹. Er ließ die Kranke auf ein Lager von erhitzten Kräutern legen, deren Heilkräfte nur ihm bekannt waren, und bereitete ihr heißen Kräuterwein zum Trinken wie zum Einreiben. Jacquou versprach ihr nicht nur eine vollständige, schnelle Genesung, sondern stellte ihr zugleich die Geburt eines Sohnes in Aussicht, der »ein Licht der kommenden Jahrhunderte« sein werde. Wirklich erhob sich die Patientin schon am dritten Tag von ihrem Krankenlager und konnte nach acht Tagen die Treppen im Hause hinauf- und herunterlaufen. Weniger als ein Jahr danach brachte sie ihren Sohn Jean-François zur Welt.
Champollion hat sich anscheinend von dieser wundersamen Geschichte nicht ausdrücklich distanziert; seine Mutter habe, wie er sagte, sie ihm häufig erzählt, als er noch ein kleiner Junge war. Dennoch kann man ihr kaum Glauben schenken. Zu allererst: Champollions Mutter war 1790 nach der Aussage Dr. Janins 48 Jahre alt – für das späte 18. Jahrhundert ein sehr fortgeschrittenes Alter, um ein Kind zu gebären. Mehr noch: Sie hatte seit acht Jahren kein Kind mehr bekommen. Fast so aussagekräftig, wie etwas zu erzählen, ist die Tatsache, dass Jean-François sich in seiner umfangreichen Korrespondenz wohl kein einziges Mal über seine Mutter geäußert hat. Er spielte im Gegenteil bis zu seinem Tod – fünfundzwanzig Jahre nach dem Tod von Jeanne-Françoise Champollion – lediglich häufig auf die Existenz einer nicht näher bezeichneten Frau in Figeac an, die sehr lieb zu ihm gewesen sei und die er immer wieder besucht habe. Schließlich gibt es noch die Tatsache, die von ihm selbst und von vielen anderen erwähnt und sogar in seinem Pass eingetragen ist, dass er im Unterschied zu seinem Bruder eine ungewöhnlich dunkle Hautfarbe hatte – so dunkel, dass er ohne Schwierigkeiten in Ägypten als Araber durchgehen konnte.
Einige Biographen, wie zum Beispiel Hartleben und neuerdings Michel Dewachter, messen den erwähnten Tatsachen keine besondere Bedeutung bei. Andere, wie Alain Faure und Lacouture, sprechen vernünftigerweise die Vermutung aus, dass Jeanne-Françoise gar nicht die wirkliche Mutter von Jean-François gewesen sei. Außereheliche Geburten waren im Geburtsregister der Pfarrei von Figeac zu dieser Zeit durchaus zu finden, wie Faure es nachgewiesen hat. Lacouture geht noch weiter: Nach seiner Ansicht hatte Jacques Champollion aller Wahrscheinlichkeit nach eine Liaison mit einer Frau, vielleicht einer Zigeunerin – oder sogar einer ›Ägypterin‹ – die er kennengelernt haben könnte auf dem Jahrmarkt von Beaucaire, und aus dieser Liaison sei ein Sohn hervorgegangen. Es gibt ausdrückliche Hinweise seiner Zeitgenossen, dass Jacques das Leben der Boheme liebte; zudem griff er ohne jeden Zweifel in seinen späteren Jahren zur Flasche, richtete dadurch seine Buchhandlung zugrunde und vergiftete die Beziehung zu seinen Kindern. Eine solche Liaison schlüssig nachzuweisen, ist wegen ihrer prekären Natur nicht möglich. Wenn jedoch die Theorie stimmt, könnte sie nicht nur dazu beitragen, Jean-François’ merkwürdig distanziertes Verhältnis zu seinem Vater (und zu seiner Mutter) zu erklären, sondern ebenso auch die außergewöhnliche Unterschiedlichkeit im Temperament zwischen Jean-François und seinen Geschwistern, einschließlich Jacques-Joseph.
Champollion le jeune war, anders als sein stets bedachtsamer, überlegter älterer Bruder, ein heißblütiger Südländer, der von heftigen Stimmungsschwankungen bestimmt war. Von frühester Kindheit an war der Löwe sein Lieblingstier; er brachte ihn gerne in Verbindung mit ›lion‹, den Endsilben seines Nachnamens. »Ausbrüche, Widerspruch, Begeisterung, Trübsinn – das waren immer wieder die Umgangsformen von Jean-François und dürften es wohl immer geblieben sein«, stellt Lacouture fest.21 Er hatte ein »aufbrausendes Temperament« und »verfiel in zornige Ungeduld, seinen Hauptfehler«, gibt auch Hartleben zu.22 Diese emotionalen Eigenschaften dürften ihm die Leidenschaft und die Hingabe vermittelt haben, die ihn zu seinen Erfolgen in der Ägyptologie führten; zugleich aber dürften sie auch dazu beigetragen haben, seine Gesundheit zu ruinieren und etliche seiner Beziehungen zu anderen Gelehrten zu zerrütten.
Der von der Revolution bestimmte Zeitgeist hat wahrscheinlich diese seine Wesensmerkmale noch gesteigert. Seine politischen Sympathien dürften wahrscheinlich immer dem Republikanismus gegolten haben, doch er musste auch oft feststellen, dass seine Arbeit durch Royalisten und Autokraten unterstützt wurde, und zwar in Frankreich, Italien und Ägypten. Deshalb schwankte er sein ganzes Leben lang unentschlossen zwischen der republikanischen Welt und der royalistischen Welt, hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zur Freiheit und seinem Respekt für Stabilität. Dabei darf man nicht seine glühende Bewunderung für die Zivilisation des alten Ägypten vergessen, die geschaffen und ein Jahrhundert nach dem anderen erweitert und verfestigt wurde durch gottähnliche Pharaonen.
Man erzählte sich eine kleine Episode von ihm, die nach der Schreckenszeit geschehen sein soll, als er etwa fünf Jahre alt war. Sie wird von Hartleben folgendermaßen berichtet und könnte so oder ähnlich tatsächlich abgelaufen sein:
Eines Tages ging das Kind mit seiner Mutter an einem Hause vorüber, auf dessen Schwelle ein blinder Bettler saß, der den Vorübergehenden bittend seinen zerrissenen Hut entgegenhielt. Sorgsam des müden Greises ausgestreckte Beine umgehend, hatte Jean-François gerade das für ihn erbetene Geldstück in den Hut gelegt, als mit gespreizter Würde ein Führer der Revolutionspartei daher schritt und mit einem Schlage seines Rohrstocks den Blinden, dem er nicht ausweichen wollte, zum Aufstehen bewog. Zornsprühend auf den gefürchteten Gewalthaber eindringend, ruft das Kind, indem es nach dem Stabe schlägt: »Schändlicher Stock, gehorchst dem bösen Mann und solltest ihn doch tüchtig verprügeln!« »Bürgerin«, sagte der anscheinend darüber belustigte Jakobiner zu der fassungslos dastehenden Mutter, »beschneiden Sie doch Ihrem Nestling hier recht gründlich Schnabel und Krallen, damit nicht andere das besorgen müssen!« Champollion erinnerte sich lebenslang dieser Szene, und als späterhin manche Gegner ihn hart bedrängten, wurde der Ausdruck: »Zum Glück sind mir Schnabel und Krallen gewachsen« sein Lieblingswort.23
Etwa zur gleichen Zeit brachte sich Jean-François selbst das Lesen und Schreiben bei. Dabei dürfte ihm seine Mutter geholfen haben; Eindeutiges lässt sich dazu allerdings nicht sagen. Der eigentliche Grund lag sicherlich in seinem unbändigen Verlangen, selbständig und unabhängig zu werden. So ist es jedenfalls später in der Familie erzählt worden, wie seine erste Biographin Hermine Hartleben berichtet. Obgleich Jeanne-Françoise offensichtlich trotz des Berufs ihres Gatten ihr Leben lang Analphabetin geblieben ist, füllte sie als fromme Katholikin sein scharfes Gedächtnis mit langen Abschnitten aus ihrem Messbuch, die ihr selbst vertraut waren, weil sie in der Messe gesungen oder vorgetragen wurden. Sie brachte ihrem Sohn diese Abschnitte nahe, indem sie sie ihm vorsprach; er sprach sie dann geduldig und bedachtsam nach. Bald jedoch fand er ein Exemplar eines solchen Messbuches auf einem Stapel im Buchladen seines Vaters und zog sich damit, umgeben von alten Büchern und Druckschriften und ausgerüstet mit Papier und Bleistiften, in eine abgelegene Ecke des Ladens zurück, der in dieser unruhigen Zeit wahrscheinlich ohnehin häufig geschlossen bleiben musste. Dort schrieb er Buchstaben und Wörter aus dem Messbuch ab, wodurch er wohl auch seine zeichnerischen Fähigkeiten gefördert haben dürfte. So kam er in einem Prozess von Versuch und Irrtum voran, indem er die in seinem Gedächtnis gespeicherten Wörter der Gebete mit den Wörtern verglich, die auf der entsprechenden Seite gedruckt waren, und kam damit schließlich auch auf die unterschiedlichen Laute, die durch die Buchstaben des Alphabets bezeichnet werden. »Auf diesen Fundamenten errichtete er dann sein erstes Entzifferungswerk«, wie Hermine Hartleben formuliert.24 Vielleicht halfen ihm dabei auch die ausgemalten Buchstaben des Messbuchs; sie waren in gewisser Weise vergleichbar mit den Bildern und Kartuschen der hieroglyphischen Schrift. Ganz sicher dürften ihm die in dem Text häufig vorkommenden Eigennamen und religiösen Ausdrücke eine Hilfe gewesen sein. Schließlich gelang es ihm dann, auch solche Abschnitte des Buches zu lesen, die er nicht zuvor auswendig gelernt hatte; damit überraschte er seine Eltern in höchstem Maße. Man kann davon ausgehen, dass sein Vater zu beschäftigt war oder vielleicht auch keine Lust hatte, ihm das Lesen beizubringen, während sie sich zusammen in dem Buchladen aufhielten. Sein Bruder Jacques-Joseph dagegen, der von den Lernerfolgen des kleinen Bruders sehr beeindruckt war, begann im Frühjahr 1797 dem Sechsjährigen einen methodisch durchdachten Unterricht zu erteilen, sofern seine berufliche Tätigkeit es ihm erlaubte.
Nachdem er den alphabetischen Code geknackt hatte, muss Jean-François seine Lesefähigkeit mit außergewöhnlicher Schnelligkeit erweitert haben. Bevor er im Alter von etwa zehn Jahren 1801 Figeac verließ, soll er in der Lage gewesen sein, lange Abschnitte aus den Werken Homers und Vergils in der originalen griechischen beziehungsweise lateinischen Fassung auswendig vorzutragen. Sehr gerne unternahm es der jüngste Sohn der Familie, dramatische Szenen aus diesen klassischen Dichtungen in seiner eigenen französischen Übersetzung anschaulich darzustellen, wenn die Familie an langen Winterabenden am Kamin zusammensaß. Zuweilen traten dann ganz unbemerkt Freunde des Hauses neugierig hinzu und staunten über den seltsamen Anblick des Knaben, der mit glänzenden Augen auf einem Schemel vor dem Kaminfeuer saß – Champollion liebte als Kind und als Erwachsener immer die physische Wärme – und vor seiner Familie die alten Erzählungen lebendig werden ließ, die zu lesen er eigenständig gelernt hatte.
Jean-François’ ungewöhnliche sprachliche Fähigkeiten gingen in keinerlei Weise aus irgendeiner formalen Ausbildung hervor. Die Elementarschulen in Frankreich waren während der Revolution geschlossen worden. Die alle zehn Tage stattfindenden Revolutionsfeste – so lange dauerte die offizielle ›Woche‹ des neuen Kalenders – sowie die Jakobinersatzungen galten als die einzig wahren, die schönsten und nützlichsten Schulen der revolutionären Erziehung in den Jahren vor Napoleons coup d’état vom November 1799. Die Beteiligung daran war allerdings mehr als dürftig, und die Revolutionsfeste waren ein Misserfolg. Wenn man heutzutage liest, was darüber berichtet wird, »kann man noch zwei Jahrhunderte später die gähnende Leere spüren, die sie kennzeichnete«, schreibt Richard Ballard, – »die Freiheit wurde zu Tode gefeiert«.25
Ab 1796 wurden die Elementarschulen wieder geöffnet – auch, um den kirchlichen Einfluss nach und nach zu vermindern. Dabei handelte es sich jedoch eher um eine zufällige Begleiterscheinung als um die bewusst gewollte Realisierung eines offiziellen politischen Ziels. Jacques-Joseph, der seinen Bruder fast eineinhalb Jahre unterrichtet hatte, verließ das Elternhaus im Sommer 1798, nachdem ihm seine Vettern eine Arbeitsstelle in einer Exportfirma in Grenoble angeboten hatten. Sein Vater hatte die ganze Angelegenheit auf der Messe von Beaucaire mit seinen Verwandten bereits vorbereitet, wohin er Jacques-Joseph mitgenommen hatte. Ohne seinen Tutor begann für Jean-François jetzt im November dieses Jahres unmittelbar vor seinem achten Geburtstag der Schulbesuch in Figeac. Er erwies sich bald als schlechter Schüler, der mit der Monotonie des mechanischen Lernens nicht zurechtkam und zu eigensinnig war, um sich der von den Lehrern geforderten Disziplin zu unterwerfen. Eine besondere Qual für ihn war das Kopfrechnen. Der Schulbesuch wurde bald eingestellt; stattdessen wurde der Junge zu Beginn des folgenden Jahres auf Betreiben Jacques-Josephs der persönlichen Obhut Dom Calmels anvertraut, des früheren Lehrers von Jacques-Joseph selbst. Es war Calmels, der dafür sorgte, dass für Jean-François der Unterricht in Latein und Griechisch begann. Er nahm ihn jedoch auch immer wieder mit auf Entdeckungsgänge in den Straßen und Gässchen Figeacs und auf Wanderungen in die ländliche Umgebung. Die historischen Gebäude der Stadt, einschließlich des alten Schlosses Baleyne und eines mit seltsamem Geschnörkel in Holz und Stein geschmückten Torwegs trugen dazu bei, das Interesse des Jungen an der Geschichte zu erwecken. Es war jedoch die Natur und nicht die Architektur, die ihn wirklich und zutiefst ansprach. Die Felder, Wälder und Hügel eröffneten dem Jungen einen Blick in eine neue Welt und in eine neue, wissenschaftsorientierte Art, sie zu verstehen. Seine Fragen erschöpften jedoch bald die Kenntnisse seines Lehrers, als Jean-François voller Freude begann, Insekten, Pflanzen und Steine zu sammeln, die später zu Hause in der Rue de la Boudousquerie eingeordnet werden mussten – vielleicht auf dem hell erleuchteten soleilho an der Spitze des ansonsten dunklen Hauses. All diese Erlebnisse und Erfahrungen ließen in ihm eine Faszination an der Welt der Natur entstehen, die sein Erforschen des alten wie des modernen Ägyptens bestimmen sollte.
In Figeac ging es bei der Erziehung des Jungen allerdings in keiner Weise um Ägypten. Es gibt tatsächlich keinerlei Hinweise auf irgendein Interesse von Champollion le jeune an diesem Land, bevor er nach Grenoble umzog. Das war jedoch anders bei seinem älteren Bruder, der Erkundigungen eingezogen hatte über den Verlauf der französischen Armee-Expedition nach Ägypten während der ersten Hälfte des Jahres 1798. »Es tut mir sehr leid«, schrieb Jacques-Joseph in seiner unveröffentlichten Autobiographie im folgenden Jahr, »dass ich nicht der Armee angehört habe, die nach Ägypten gezogen ist. Ich möchte auch noch sagen: Wenn ich hätte zwischen allen beruflichen Möglichkeiten hätte wählen müssen, hätte ich mich wahrscheinlich für eine Laufbahn beim Militär entschieden«.26 Aus den in der Familie weitergegebenen Nachrichten geht hervor, dass im September 1799 aus Kairo in der Buchhandlung Champollion ein Exemplar des Courier de l’Égypte eintraf, in dem über die Entdeckung und die mögliche Bedeutung des Rosettasteins berichtet wurde. Es war für Jacques-Joseph bestimmt. Abgeschickt war es wohl von Jacques’ Bruder André Champollion, der als Offizier in der Armee diente und der vom Interesse seines Neffen an Ägypten gewusst haben dürfte. Man kann sich vorstellen, dass Jacques Champollion es seinem jüngsten Sohn gezeigt hat, bevor er es an Jaques-Joseph nach Grenoble weitergeschickt hat. Wenn er es tatsächlich getan hat, hat es bei dem acht Jahre alten Jean-François keinerlei Eindruck hinterlassen.
Mit Dom Calmels war eine gute Wahl als Lehrer für Jean-François getroffen worden. Obwohl er seinen Schüler sehr gern hatte, musste er sich nichtsdestoweniger doch wohl damit abfinden, dessen besonderem Genie in der intellektuell sterilen Atmosphäre Figeacs nicht in jeder Hinsicht gerecht werden zu können, weil hier passende Bücher und auch geeignete Lehrer fehlten. Es zeigte sich, dass der Lerneifer des Jungen immer stärker nachließ und er unter einer Art von Depression litt; dabei spielte es auch wohl eine Rolle, dass die Zuwendung seiner Eltern vermutlich zu gering war. Gegen Ende Dezember 1800 schrieb sein Tutor voller Besorgnis über diese Situation an Jacques-Joseph nach Grenoble. Er hob zunächst die beträchtlichen Fortschritte des Jungen in Latein hervor und fügte dann mehr allgemein an: »Er hat an vielen Dingen Interesse und eine große Wissbegierde, aber diese Interessen und diese Wissbegierde werden überdeckt von einer Apathie, einer Gleichgültigkeit, die man nur schwer beseitigen kann. Es gibt Tage, an denen er anscheinend alles lernen möchte, und andere, an denen er überhaupt nichts unternehmen will.«27 Nur wenige Tage später, Anfang Januar 1801, griff Jean-François selbst zur Feder, um seinem Bruder zu schreiben – wahrscheinlich auf Veranlassung seines Betreuers. Nach der Begrüßung seines »liebsten Bruders«, einer Nachricht über »unsere lieben Schwestern« und einer nur sehr knappen Erwähnung von »Papa« und »Maman« bittet er um Entschuldigung für sein wechselhaftes Verhalten, von dem er hofft, dass »Dein Unterricht es beseitigen wird«.28 Ein Beispiel seiner mit dekorativen Arabesken umgebenen lateinischen Sprachkenntnis fügt er dem Brief bei.
Gegen Ende Februar antwortet Jacques-Joseph seinem Bruder. Mittlerweile hatte er sich entschieden, für Jean-François auf Dauer die Verantwortung zu übernehmen – einschließlich der künftig anfallenden Kosten für seine Erziehung. Aber zunächst warnte er ihn auch:
Du hast mir ja mitgeteilt, dass Dein Verhalten nicht ausgeglichen ist, aber Du musst versuchen, zu einer Art von Ausgeglichenheit zu gelangen. Vergiss nicht, dass man eine verlorene Zeitspanne nicht mehr wiedererlangen kann. Sei Dir klar darüber, dass nichts für einen Schüler eine größere Schande ist als Faulheit und Unachtsamkeit … Wenn Du hier bei mir bleiben möchtest, musst Du lernen, Dir alles schnell anzueignen – Ignoranten sind zu nichts nütze. Wenn Du Wert darauf legst, dass ich die Erlaubnis unseres lieben Vaters bekommen soll, Dich hier zu behalten, musst Du von Dir aus ihn in jeder Weise zufriedenstellen.29
Auffällig ist hier, dass Jacques-Joseph nur von ihrem Vater spricht, als sei die Meinung ihrer Mutter in einer so weitreichenden Frage völlig irrelevant. Was Champollion père angeht, scheint er seine Zustimmung bald darauf ohne Einwände gegeben zu haben. Eindeutige Beweise dafür gibt es, wie auch sonst, nicht, aber seine Entscheidung hat sicherlich damit zu tun, dass er nicht sonderlich davon berührt war, dass sein jüngster Sohn weit außerhalb des Elternhauses erzogen werden sollte. (Merkwürdigerweise liegt eine ähnliche Situation bei Thomas Young vor; er wurde als der Erstgeborene sogar noch früher von seinen Eltern getrennt als Champollion und schränkte die Beziehung zu seinem Vater und seiner Mutter so stark ein, als sei er schon erwachsen.) Von diesem Zeitpunkt an dürften der Vater in Figeac und sein jüngster Sohn im fernen Grenoble nur noch wenig miteinander zu tun gehabt haben. Das dauerte so lange, bis Jean-François in der Mitte seiner zwanziger Jahre nach Figeac zurückkehren musste, weil er aus Grenoble verbannt worden war. Eine mögliche Erklärung für das rasche Einverständnis des Vaters könnte auch darin bestehen, dass er schon begonnen hatte, sich der Trunksucht zu überlassen.
Gegen Ende März 1801 brach Jacques’ zehnjähriger Sohn zur ersten größeren Reise seines Lebens auf. In Figeac bestieg er die diligence, die Postkutsche nach Lyon; dort stieg er um in eine zweite diligence, die ihn nach Grenoble brachte. Nichts deutet darauf hin, dass sein Vater ihn begleitet hätte oder dass sein Bruder oder sonst jemand ihn in Lyon abgeholt hätte. Verglichen mit unserer Zeit hieße das, man würde ein Kind ganz allein in einem Langstreckenflugzeug in eine weit entfernte, fremde Stadt reisen lassen. Offensichtlich verfügte Jean-François bei aller Unausgeglichenheit seines Wesens über ein ungewöhnlich stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Seine Schwestern in Figeac, die den Launen des kleinen Haustyrannen wider Willen so freudig Vorschub geleistet hatten, pflegten nach seiner Abreise zu sagen: »Unser Heim ist nicht mehr, was es war.«30 Jahrzehnte nach dem Tod von Jean-François formulierte sein Bruder, sein neuer Betreuer in Grenoble, den denkwürdigen Satz: »Ich war nacheinander sein Vater, sein Lehrer und sein Schüler.«31