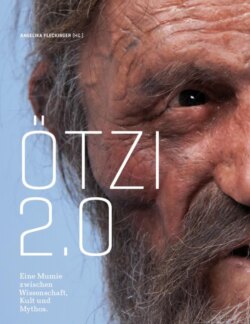Читать книгу Ötzi 2.0 - Angelika Fleckinger - Страница 8
FASZINATION ÖTZI
ОглавлениеANDREAS PUTZER
Das Interesse am Mann aus dem Eis und seiner Beifunde ist auch nach 20 Jahren noch nicht abgeklungen. Die Mumie sorgt immer wieder für Schlagzeilen in der internationalen Medienlandschaft und weckt das Interesse der Menschen aufs Neue. Auch ist der Wunsch vieler Wissenschaftler, den Funden ihre letzten Geheimnisse zu entlocken, noch nicht ausgeträumt. Die renommiertesten Forscher aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen haben sich der Erforschung der Mumie und seiner Beigaben in den letzten beiden Jahrzehnten gewidmet. Wir wissen heute einiges übers sein Leben, seine Fähigkeiten und seine Umwelt. Trotz allem bleiben Fragen unbeantwortet und geben Anlass zu Spekulationen. Es sind weniger die Antworten, die zwar vielfach Staunen hervorrufen, sondern vielmehr die „offenen Fragen“, denen sich Interessierte und Wissenschaftler leidenschaftlich widmen.
Sein zweites Leben beginnt. Der gute Erhaltungszustand der 5000 Jahre alten Feuchtmumie eröffnete bis dato ein unvorstellbares Betätigungsfeld für die interdisziplinäre Forschung. Ein von Konrad Spindler geäußertes Zitat, kurz nach Auffindung, bringt die Perspektive auf den Punkt: „Es war mir sofort klar, dass sehr viel Arbeit auf uns zukommen würde“. Ötzi ist die am besten erforschte Mumie der Welt, da durch die gute Erhaltung der Weichteile, eine Beschädigung großteils vermieden werden kann. Ca. 100 wissenschaftliche Teams bestehend aus jeweils männlichen und weiblichen Archäologen sowie Botanikern, Medizinern, Gletscherforschern, Geologen, Physikern, um nur einige Fachrichtungen zu nennen, haben sich bemüht, „Ötzi“ die Geheimnisse über sein Leben und seinen Tod zu entlocken. Dabei wurden für die Untersuchungen teilweise neue Verfahren entwickelt. Das Untersuchungsfeld ist bei weitem noch nicht erschöpft, vor allem wird die technologische Entwicklung auch in Zukunft zu neuen Erkenntnissen führen.
Vorderansicht des Körpers
Das sensationelle Alter des Fundes. Bei der Entdeckung und Bergung der Mumie und ihrer Beifunde war niemanden klar, wie alt die Mumie war, bzw. aus welcher Zeit sie stammte. Man glaubte, einen Alpinisten aus unseren Tagen entdeckt zu haben oder etwa einen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Reinhold Messner, der sich zufällig am Fundort befand, vermutete ein Alter von mindestens 3000 Jahren, da ihm am Körper vorhandene Linien aufgefallen waren. Erst einige Tage nach der Bergung wurde ein Archäologe hinzugezogen. Konrad Spindler, Ordinarius für Ur- und Frühgeschichte der Universität Innsbruck, datierte anhand der Typologie des Beils den Fundkomplex auf mindestens 4000 Jahre. Gewissheit brachte erst die sogenannte Radiokarbondatierung bzw. C-14-Methode, eine in der Archäologie häufig angewandte Untersuchung zur Altersbestimmung von antiken Objekten. Für die Radiokarbondatierung wurden Proben vom Körper und der Beifunde entnommen und an vier verschiedenen Instituten untersucht. Die Ergebnisse waren eindeutig: Ötzi lebte zwischen 3350 und 3120 v. Chr. In den letzten 20 Jahren wurden weitere Datierungen an seinen Beifunden durchgeführt, die das Alter des Fundkomplexes bestätigen.
Die geologische Karte verdeutlicht die möglichen Lebensräume des Mannes aus dem Eis
_____
C-14
Im Gewebe eines jeden Lebewesens lagert sich das radioaktive Kohlenstoffisotop C-14 ab. Beim Ableben bricht die C-14-Zufuhr ab, und es beginnt sich abzubauen. Nach 5730 Jahren ist die Hälfte zerfallen. Mithilfe eines Beschleuniger-Massen-Spektrometers [AMS] kann das noch vorhandene C-14-Isotop ermittelt und somit das Alter eines Lebewesens bestimmt werden.
_____
Wie alt war Ötzi, als er starb? Alter und Herkunft. Um das Sterbealter einer erwachsenen Person zu bestimmen, wird die Knochenstruktur nach altersbedingten Veränderungen untersucht. Die Knochen bestehen aus Zellen, die bei einer lebenden Person wachsen, absterben und ersetzt werden. Dieser Zyklus endet mit dem Tod und hinterlässt Spuren. Ausschlaggebend für die Ermittlung des Sterbealters ist die Anzahl der Osteonen, einem Bauelement des Knochengewebes, und deren Ausdehnung bzw. Größe. Zu diesem Zweck wurden Proben aus Ötzis Oberschenkel- und Unterarmknochen zur Analyse entnommen. Unterm Mikroskop wurde die Anzahl der Osteone in der Knochenrinde gezählt und deren Ausdehnung ermittelt. Durch Hochrechnungen dieser Parameter konnte so das Sterbealter von Ötzi auf 45 bis 46 Jahre bestimmt werden, wobei eine Abweichung von plus oder minus fünf Jahren möglich ist. Der Mann aus dem Eis hat somit, für die Kupferzeit, ein relativ hohes Alter erreicht.
Wo hat Ötzi gelebt? Im Zahnschmelz und in den Knochen eines Menschen lagern sich Mineralstoffe ab, die man im Laufe seines Lebens über die Nahrung vom Boden und vom Wasser aufnimmt. Der Zahnschmelz bildet sich in den ersten Lebensjahren und gibt somit Auskunft über die Herkunft einer Person. Um eventuelle Wohnortwechsel nachzuweisen, werden zudem Röhrenknochen nach ihrem Strontium-, Blei- und Sauerstoffgehalt untersucht und mit Boden- und Wasserproben verglichen. Damit der Geburtsort von Ötzi ermittelt werden konnte, wurde Zahnschmelz von seinen Eckzähnen entnommen und mit Boden-, Gewässer- und Zahnschmelzproben moderner Menschen verglichen. Der Sauerstoffgehalt des Zahnschmelzes und der Knochen ergab, dass Ötzi südlich des Fundortes aufgewachsen war und auch gelebt hat. Das Kindesalter verbrachte der Mann aus dem Eis auf kristallinen Böden, wie sie im Eisacktal vorkommen, wobei Bodenproben aus Feldthurns die höchste Übereinstimmung aufwiesen. Im Erwachsenenalter, in den letzten zehn bis 20 Lebensjahren, hat er sich auf vulkanischen Böden aufgehalten. Vermutlich lebte er im Etschtal, wobei kein genauerer Aufenthaltsort ermittelt werden konnte. Erst kurz vor seinem Tod hat er sich auf den Weg ins Schnalstal gemacht. Bis dato wurde der Wohnort von Ötzi auf Schloss Juval, am Eingang des Schnalstals, vermutet, was jedoch aufgrund der Untersuchungen ausgeschlossen werden konnte.
Schlüssel des Lebens. In allen Lebewesen kommt das Molekül Desoxyribonukleinsäure (kurz DNS oder DNA) vor, das die Erbinformationen enthält. Die DNA-Sequenz eines Menschen ist wie ein Fingerabdruck, es kann zwar manchmal Ähnlichkeiten geben, aber jede Sequenz ist einzigartig. Man unterscheidet zwischen nuklearer oder genomischer und mitochondrialer DNA. Die genomische DNA enthält die Gene, die uns etwas über den Aufbau des Organismus und dessen Organisation verraten und ermöglicht Rückschlüsse über eventuelle Erbkrankheiten. Über die mitochondriale DNA können Verwandtschaftsverhältnisse nachgewiesen werden, sie wird nur mütterlicherseits vererbt. Die Untersuchungen an der DNA müssen unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden, da ansonsten die Ergebnisse durch Verunreinigung mit moderner menschlicher DNA verfälscht werden. Im Besonderen gilt dies für Untersuchungen an antiker DNA, die über 5000 Jahre alt ist. An Ötzi konnte über viele Jahre nur die mitochondriale DNA extrahiert werden, die in Untergruppen, den sogenannten Haplogruppen unterteilt wird. Ötzi konnte der Haplogruppe K zugeordnet werden, die vor allem rund um die Alpen verbreitet ist und seit 12.000 Jahren existiert. Die Haplogruppe K ist häufig in der ladinischen Bevölkerung Südtirols vertreten, die in den Dolomiten lebt. Ötzi gehört damit zur mitteleuropäischen Bevölkerungsgruppe, sein Verwandtschaftsverhältnis zur ladinischen Volksgruppe muss noch eingehender untersucht werden.
Grabungen im Eis. Bereits am 25. September 1991 machte sich ein Forscherteam auf den Weg zur Fundstelle am Tisenjoch, um nach weiteren Gegenständen des Mannes aus dem Eis zu suchen. Prompt wurde man fündig und konnte den Köcher samt Inhalt nach zweistündiger Freilegung bergen. Die erste eigentliche Ausgrabung fand vom 3. bis 5. Oktober 1991 statt. Die Untersuchungen beschränkten sich auf den Bereich des Felsblocks, auf dem der Körper Ötzis bäuchlings gelegen hatte. Dabei fand man ein Grasgeflecht, Leder- und Fellstücke sowie Teile eines grobmaschigen Netzes aus Grasschnüren. Westlich davon fanden sich die Reste eines Birkenrindenbehälters mit Inhalt. Der frühe Wintereinbruch verhinderte weitere Untersuchungen. Die zweite Grabung fand unter der Leitung des Amtes für Bodendenkmäler der Autonomen Provinz Bozen vom 20. Juli bis 25. August 1992 statt. Durch den harten Winter hatten sich an der Fundstelle sieben Meter Schnee angesammelt, der mühevoll weggeschaufelt wurde. Anschließend wurde die gesamte Felsmulde mithilfe von Industrieföhns und Dampfstrahlern freigeschmolzen. Das dabei entstandene Schmelzwasser wurde abgeleitet und mehrmals gesiebt, um kleinste Funde nicht zu verlieren. Im Sediment der Felswanne konnte eine Reihe von Ausrüstungsteilen des Mannes geborgen werden. Unter anderem fanden sich Leder- und Fellreste, Gräser und Schnüre, Hautteile, Haare und ein Fingernagel. Auch barg man das im Vorjahr abgebrochene Bogenende. Als Höhepunkt entpuppte sich der Fund der Bärenfellmütze, sie lag am Fuß des Felsblocks. Nach siebenwöchiger Arbeit war das Fundgelände aus archäologischer Sicht erschöpft.
Grabungen an der Fundstelle
Sterile Arbeitsbedingungen im DNA-Labor
_____
BRAUNE AUGEN!
Eine neue Forschungsreihe ist angelaufen – 2010 ist es erstmals gelungen, 95 Prozent des Zellkern-Genoms zu isolieren. „Die Fülle der Daten bringt ein Universum an Möglichkeiten“, sagt Albert Zink von der Europäischen Akademie in Bozen. Der spannendste Teil der Arbeit wartet jedoch noch auf die Wissenschaftler: Die riesigen Datenmengen, die nun vorliegen, können viele Fragen beantworten. Gibt es heute noch lebende Nachfahren von Ötzi und wo leben diese? Welche genetischen Mutationen kann man zwischen früheren und heutigen Populationen festmachen? Welche Rückschlüsse kann man aus der Untersuchung von Ötzis Genmaterial und seinen Krankheitsveranlagungen auf heutige Erbkrankheiten oder andere heutige Erkrankungen wie Diabetes oder Krebs ziehen? Wie wirken sich diese Erkenntnisse auf die heutige Forschung in der genetischen Medizin aus? Auch werden alte Forschungsergebnisse widerlegt, so konnte nachgewiesen werden, dass Ötzis Augenfarbe braun und nicht wie bisher angenommen grau-blau war. Man kann gespannt in die Zukunft blicken.
_____
Ausrüstungsgegenstände an der Fundstelle
Zeichnerische Dokumentation des Grasumhangs
Die Bekleidung und Ausrüstung des Mannes aus dem Eis. Nicht weniger bedeutend für die Forschung sind die Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände des Toten. Ötzi wurde aus der Mitte des Lebens gerissen, dies ermöglichte ein unverfälschtes Bild kupferzeitlichen Alltagslebens nachzuzeichnen – wenn auch ein sehr außergewöhnliches. Archäologen sind meist mit Funden aus Siedlungen oder Gräberfeldern konfrontiert, wo sich organische Materialien kaum erhalten. Deshalb ist es oft nicht möglich, Rückschlüsse über das Alltagsleben oder die ehemaligen Besitzer zu machen. Erschwert wurde die wissenschaftliche Forschung durch die Einzigartigkeit des Fundkomplexes vom Tisenjoch. Man bedenke, dass Ötzis Bekleidung zum Teil heute noch die einzigen kupferzeitlichen Kleiderfunde sind.
Die Restaurierung und Konservierung der Beifunde. Bereits einige Tage nach Entdeckung wurden Experten der Werkstätte des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz (D) für die fachgerechte Konservierung und Restaurierung der Beifunde zurate gezogen. Es begann eine aufwändige und minutiöse Aufarbeitung aller Funde, die in mehreren Phasen abgewickelt wurde: katalogisieren, fotografieren und teilweise röntgen. Anschließend wurden sie mit destilliertem Wasser vorsichtig gereinigt und für die Materialbestimmung beprobt. Um die Funde zu konservieren, wurden sie mit speziellen Lösungen behandelt und anschließend gefriergetrocknet. Erst dann begann die eigentliche Arbeit, und zwar das Zusammenfügen der vielen Einzelteile. Man bedenke, dass die Felllederbekleidung in 100 Fetzen zerrissen war, und niemand vorher eine Ahnung vom Schnitt kupferzeitlicher Kleidung hatte.
Der Grasumhang. Unter Kopf und Oberkörper der Mumie befand sich ein Grasgeflecht. Bei den Nachuntersuchungen konnte ein weiteres Fragment in unmittelbarer Nähe des Felsblockes, auf dem Ötzi lag, geborgen werden. Durch die Nähe zur Mumie wird angenommen, dass es sich um ein Kleidungsstück handelt. Der Grasumhang wurde hauptsächlich aus Bündeln der Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum), einem in Europa heimischen Süßgras, hergestellt. Andere Grasarten wie das Blaue Pfeifengras, das Borstengras und ein Straußgras-Typ wurden in geringen Mengen miteingearbeitet. Vom Umhang hat sich nur etwa ein Viertel erhalten. Die Länge betrug ca. 90 cm und reichte Ötzi bis zu seinen Knien. Der Grasmantel eignet sich hervorragend als Regenschutz. Ethnologische Vergleiche belegen, dass Grasmäntel bis ins 20. Jahrhundert hinein in Europa getragen wurden. In der Vergangenheit wurde der Grasumhang häufig als Matte oder als Geflecht für die Rückentrage angesprochen. Gegen die Interpretation als Matte spricht die Tatsache, dass der Umhang nur an einem Rand eingeflochten ist und sich nach unten hin verbreitert. Zudem hängen die Grasbüschel am unteren Ende frei herab. Eine Matte hätte wohl eingeflochtene Ränder und eine vermutlich rechteckige Form. Gegen die Nutzung als Geflecht für die Rückentrage spricht der Auffindungsort, der weit abseits von der Rückentrage lag.
Lendenschurz
Der Lendenschurz. Der Schurz besteht aus rechteckigen Streifen von Ziegenleder, die miteinander vernäht wurden. Als Nähmaterial wurden gezwirnte Tiersehnen verwendet. Der Lendenschurz muss ursprünglich ca. 1 m lang gewesen sein, da der erhaltene Vorderteil 50 cm lang und 33 cm breit ist. Der Schurz wurde zwischen den Beinen durchgezogen und an einem Gürtel befestigt.
Die Beinkleider. An den Beinen trug der Mann aus dem Eis zwei Beinröhren, die aus der Ethnologie allgemein als „Leggings“ bekannt sind. Im Gegensatz zu Hosen werden sie mithilfe eines Lederriemens an einem Gürtel befestigt. Hergestellt sind sie aus vielen kleinen Fellstücken der Hausziege und mit Tiersehnen in Überwendlingsstich von der Rückseite aus vernäht. Am unteren Ende haben die Leggings eine zungenförmige Lasche aus Hirschfell, die in die Schuhe gestopft wurde. Die Beinkleider weisen starke Gebrauchsspuren und Reparaturen auf, die für eine lange Nutzungsdauer sprechen. Im Jahre 2004 wurde am Schnidejoch im Berner Oberland (Schweiz) ein vergleichbares Beinkleid gefunden. Der Fund ist zwar jünger als Ötzis Beinkleider (2914-2621 v. Chr.), aber es scheint, dass die Verwendung dieser Art von Beinkleidern in der Kupferzeit weit verbreitet war.
Teil des Fellmantels
Der Fellmantel. Der Mantel des Mannes ist mit großer Wahrscheinlichkeit aus Fellen der Hausziege hergestellt. Er hat ein Muster, das durch das Vernähen von braunen und schwarzen Fellstreifen entstanden ist. Das Nähmaterial besteht aus Tiersehnen. Die sauber angeordneten Nähte zeugen von einer fachgerechten Herstellung. Am Mantel sind auch Reparaturen mit Grashalmen durchgeführt worden, die nicht sehr sorgfältig ausgeführt sind und vermutlich von Ötzi selbst gemacht wurden. An der Fleischseite finden sich Schabspuren und Verschmutzungen, die infolge der Gerbung der Felle mit Fett und Rauch entstanden sind. Der Mantel wurde vorne offen getragen, da Verschlussvorrichtungen fehlen. Vermutlich hat Ötzi seinen Gürtel zum Verschließen des Mantels verwendet. Von den Ärmeln hat sich nichts erhalten, deshalb bleibt unklar, ob der Mantel ärmellos war oder nicht.
Ötzis Beinkleider
Detailaufnahme Lendenschurz
_____
FALSCH BESTIMMT?
Die Felle, die Ötzi zur Herstellung seiner Kleidung verwendet hatte, wurden zügig nach der Auffindung bestimmt. Nach fast zwei Jahrzehnten stellte man diese Bestimmungen durch die Anwendung einer neuartigen wissenschaftlichen Methode infrage. Die Analyse beruht auf der Bestimmung der Bausteine von Proteinen, die bei jeder Tierart unterschiedlich sind. Dafür wurden vier Haarproben vom Mantel, von den Leggings und vom Oberleder des Schuhs entnommen und mit jenen von rezenten Tieren verglichen. Den Untersuchungen zufolge wurden für den Mantel und die Leggings Schaffell verwendet und für das Oberleder des Schuhs Rindsleder. Den Ergebnissen sollte allerdings mit Vorsicht begegnet werden, da nur wenige Haarproben untersucht wurden. Zurzeit sind zwei weitere wissenschaftliche Teams dabei, Ötzis Fellkleidung zu bestimmen, um die neuartige Methode gegenzuprüfen.
_____
Ötzis Fellmütze
Detailaufnahme der Gürteltasche
Die Mütze. Bei den Nachgrabungen im Jahre 1992 konnte am Fuße des Felsblocks eine Mütze aus Bärenfell gefunden werden. Sie besteht aus mehreren miteinander vernähten Fellen vom Braunbär. Das Fell hat sich hervorragend erhalten, da die Mütze tief in der Rinne zu liegen kam und deshalb vom Eis besser konserviert wurde. Sie hat einen Durchmesser von ca. 52 cm und eine halbkugelige Form. Mithilfe von Lederriemen konnte sie am Kinn festgemacht werden. Die Kinnriemen sind an den Enden abgerissen, höchstwahrscheinlich handelt es sich um antike Risse.
Die Schuhe. Die Schuhe des Mannes sind sehr aufwändig und kompliziert konstruiert. Bis heute gibt es noch keinen vergleichbaren prähistorischen Schuh. Der rechte Schuh befand sich bei der Bergung des Toten noch am Fuß und wurde erst später für die Restaurierung abgenommen. Die Sohle des Schuhs besteht aus Bärenleder, das mit der Fellseite nach innen getragen wurde. Am Rande der Sohle befand sich ein Lederriemen, an dem ein Netz aus Lindenbast befestigt war. In diesem Geflecht war Heu gestopft worden, um den Fuß zu wärmen. Das Geflecht war zusätzlich mit einem Oberleder versehen, das vorne mit der Sohle vernäht wurde. Vom Fersenbereich hat sich nichts erhalten. Versuche haben gezeigt, dass sich mit den rekonstruierten Ötzi-Schuhen im Hochgebirge sehr gut wandern lässt. Der Querriemen an der Sohle ermöglicht einen guten Halt. Weniger geeignet sind sie bei Regen oder auf Schnee, weil man sehr schnell nasse Füße bekommt.
Vom linken Schuh hat sich nur das Netz aus Bast erhalten
Der Gürtel mit Gürteltasche. Der aus Kalbsleder gefertigte Gürtel hatte eine ursprüngliche Länge von zwei Metern und konnte zweimal um die Hüfte geschlungen werden. Wie bereits erwähnt, diente er dazu, die Leggings und den Lendenschurz zu halten. In der Mitte des Gürtels ist ein rechteckiger Lederstreifen aufgenäht, der so ein Täschchen bildet. Ein am Täschchen angebrachter Lederriemen diente vielleicht als Verschluss. Am Gürtel war eine Bastschnur befestigt, die dazu diente, weitere Geräte, beispielsweise den Retuscheur, festzubinden. Jüngst wurde die Vermutung geäußert, dass es sich um zwei Gürtel handeln könnte, da dem Mann ein zweiter Gürtel zum Schließen seines Mantels fehlt. Der Inhalt des Täschchens bestand aus drei Feuersteingeräten, einem Knochengerät und einem Zunderschwamm. Die Geräte wurden von Ötzi als Werkzeuge zur Bearbeitung von Holz oder Knochen verwendet. Der Zunderschwamm diente zum Feuermachen, in trockenem Zustand ist er durch Funkenschlag leicht entzündbar.
Dolch und Dolchscheide
Das Beil
Das Beil. Der für die Archäologie bedeutendste Ausrüstungsgegenstand des Mannes ist sein Kupferbeil. Es besteht aus einer Knieholmschäftung von ca. 60 cm Länge, die aus dem Kernholz eines Eibenstammes geschnitzt wurde. Die Klinge ist trapezförmig und besteht aus fast reinem Kupfer (99,7 Prozent) mit geringem Anteil an Arsen und Silber. Mit Birkenteer und mit einem Lederriemen war sie an der Schäftung befestigt. Die Klinge wurde im Guss hergestellt und anschließend geschliffen. Es zeigen sich keine Dengelspuren, die auf eine Kaltbearbeitung des Metalls hinweisen. Versuche mit rekonstruierten Kupferbeilen haben gezeigt, dass damit auch ein Baum gefällt werden kann. Auch war es Ötzi gut möglich, das Beil als Waffe einzusetzen.
Der Dolch mit der Bastscheide. Die dreieckige Klinge des Dolches besteht aus Feuerstein, dem Stahl der Steinzeit, und ist ca. 7 cm lang. Der Feuerstein wurde von weither importiert, vermutlich stammt er aus den Monti Lessini östlich des Gardasees. Wäre die Klinge nicht mit dem dazugehörenden Griff aus Eschenholz gefunden worden, hätte man sie vermutlich als Speer- oder Lanzenspitze interpretiert. Die Klinge war in einer Kerbe im Holz eingeschoben und zusätzlich mit Tiersehnen befestigt. Die Spitze des Dolches ist bereits zu Ötzis Zeit abgebrochen, vielleicht infolge eines Kampfes. Der Feuersteindolch fand sich in einer 12 cm langen dreieckigen Scheide aus Lindenbast, die in Zwirnbindung hergestellt war. Am Scheidenmund befindet sich ein Lederstreifen, mit dessen Hilfe die Bastscheide am Gürtel festgebunden wurde.
Der Retuscheur. Der Retuscheur ist einer der Ausrüstungsgegenstände, der die Wissenschaftler zum Grübeln gebracht hat. Das etwa 11 cm lange entrindete Stück eines Lindenasts ist an einer Seite spitz und an der anderen gerade abgeschnitten. Im Markkanal befindet sich ein Stift aus Hirschgeweih, dessen Spitze mit Feuer gehärtet wurde. Das Objekt erinnert stark an einen Bleistift. Versuche haben ergeben, dass es sich um einen Druckstab bzw. Retuscheur zum Bearbeiten von Feuerstein handelt. Man kann damit in Feinarbeit beispielsweise eine Pfeilspitze oder Dolchklinge herstellen. War der Stift abgenutzt, wurde der Retuscheur wie ein Bleistift nachgespitzt.
Das Tragegestell. Unweit der Mumie auf einem Felssims fand sich das Tragegestell des Mannes. Es handelt sich um einen U-förmig gebogenen und entrindeten Haselstock und zwei grob zugearbeiteten Lärchenbrettchen. Bei den Nachgrabungen im Jahre 1992 fanden sich die Fragmente eines dritten Brettchens. Bald erkannte man, dass es sich um den Rahmen eines Tragegerüsts handelt, das der Mann zum Transport seiner zahlreichen Gegenstände mit sich führte. Unklar bleibt, was für eine Tragevorrichtung am Rahmen befestigt war. Man fand in der Nähe zahlreiche Schnur- und wenige Fellreste. Die wenigen Fellreste genügen nicht zur Rekonstruktion eines Tragesacks. Eher scheint ein Netz aus Lindenbastschnüren am Rahmen befestigt gewesen zu sein.
Das Tragegestell
Der Retuscheur
Der Bogenstab
Der Bogen. Der Bogen ist 182,5 cm lang und damit größer als Ötzi. Gefertigt wurde er aus dem Holz der Eibe, das sich besonders gut zur Herstellung von Bögen eignet. Die noch vorhandenen Bearbeitungsspuren und die fehlenden Nocken zum Befestigen der Bogensehne deuten darauf hin, dass der Bogen noch nicht fertig war. Wenige Arbeitsschritte wie das Glätten und das Anbringen von Nocken hätten gereicht, um den Bogen zu benützen. Bei der Restaurierung fiel den Technikern auf, dass vom Bogen ein ranziger Geruch ausging. Aus ethnologischen Quellen weiß man, dass häufig Tierfett verwendet wurde, um das Bogenholz elastisch zu halten. Die verwendete Substanz konnte bei chemischen Untersuchungen allerdings nicht mehr nachgewiesen werden. Experimente haben gezeigt, dass es sich beim Bogen von Ötzi um eine hochgefährliche Waffe handelt. Selbst bei einer Distanz von 30-50 m wird ein Tier vom Pfeil durchschlagen.
Der Köcher und sein Inhalt. Der Köcher ist aus einem großen Fellstück angefertigt, hat eine länglich-rechteckige Form und wurde seitlich mit einem Haselnussstock verstärkt. Das Fell stammt mit großer Wahrscheinlichkeit von einer Gämse. Die Köcherversteifung war bereits zu Lebzeiten des Mannes in drei Teile zerbrochen. Die Verschlussvorrichtung des Köchers hat sich nur teilweise erhalten, auffallend sind die kunstvoll angebrachten Nähte. Im Inneren des Köchers fanden sich 14 Pfeile, wobei nur zwei der Pfeile mit Feuersteinspitzen bewehrt waren. Die zwölf Rohlinge waren entrindet und mit einer Kerbe zum Einlegen der Bogensehne versehen. Spitzen und Befiederung fehlen. Die Pfeilschäfte sind aus den Ästen des Wolligen Schnellballs gefertigt, die sich besonders gut eignen, weil sie meist gerade wachsen. Die beiden fertigen Pfeile hatten eine Spitze aus Feuerstein, die mit Birkenteer und einer Umwicklung aus Tierhaaren am Schaft befestigt waren. Einzigartig ist die Erhaltung der Befiederung der Pfeile, die radial am Schaft angebracht wurden und dem Pfeil die nötige Stabilität in der Flugphase verleihen. Einer der Pfeile hat einen Vorschaft aus Holz vom Hartriegel. Im Köcher fanden sich außer den Pfeilen vier Hirschgeweihspitzen, die mit Bast verschnürt waren, zwei Tiersehnen und eine Geweihspitze. Außerdem enthielt er noch eine bis zu zwei Meter lange Schnur aus Lindenbast, die Ötzi notfalls als Bogensehne hätte verwenden können.
Röntgenaufnahme des Köchers
Zeichnerische Dokumentation der Pfeile
Der Köcher
Verschnürte Hirschgeweihspitzen
Schnur aus Lindenbast
Detailaufnahme eines Birkenrindengefäßes
Reste eines zweiten Gefäßes
Die Birkenrindengefäße. Ötzi führte zwei Behälter aus Birkenrinde mit sich. Der Boden der Gefäße war oval und hatte einen Durchmesser von 15-18 cm. Die Wandung wurde aus einem einzigen Stück Birkenrinde hergestellt, die mit Lindenbast vernäht war. Die Behälter waren ca. 20 cm hoch. Einer der Behälter enthielt Holzkohlen verschiedener Holzarten und Ahornblätter. Es handelt sich um einen Glutbehälter, der zum Aufbewahren von glühender Holzkohle Verwendung fand. Die Ahornblätter dienten dabei zur Isolierung.
Erste-Hilfe-Ausrüstung. Unter den Beifunden des Mannes fanden sich zwei Fruchtkörper des Birkenporlings, die an Lederriemen befestigt waren. Der Birkenporling ist ein Baumpilz, der an abgestorbenen Stämmen der Birke wächst. Der Pilz ist in der Naturmedizin bestens bekannt und heute noch in Verwendung. Der Birkenporling hat eine hohe antibiotische Wirkung und kann zum Stillen von Blutungen benutzt werden.
Fruchtkörper des Birkenporlings
Steinscheibe und Quaste. Dieser Fund gibt noch immer Rätsel auf. Die Steinscheibe ist gelocht und besteht aus Dolomit-Marmor, der in den Zentralalpen häufig vorkommt. An der Scheibe sind mehrere gedrehte Lederriemen befestigt, die meist abgerissen sind. Interpretiert wurde die Quaste als Vorrat an Ersatzriemen oder als Amulett zum Abwehren von Unheil. Ein weiterer Vorschlag kam aus den Reihen der Bogenschützen. Sie verwenden eine ähnliche Quaste zum Reinigen von verschmutzten Pfeilen.
Zeit des Umbruchs. Die Epoche, in der der Mann vom Tisenjoch lebte, bezeichnet man als Spätneolithikum oder Kupferzeit. Es ist eine Zeit des Umbruchs, die nicht nur durch den neu entdeckten Werkstoff Kupfer bedingt ist, auch wenn die Metallverarbeitung eine zentrale Rolle spielt. Die Kupferverarbeitung entstand im anatolischen und kaukasischen Raum, wo bereits im 6. Jahrtausend v. Chr. der Abbau und die Verarbeitung von Kupfererzen nachgewiesen ist. Über Vorderasien und den Balkan dringt die neue Technologie im 4. Jahrtausend v. Chr. nach Süd- und Mitteleuropa vor. Es entstehen neue Berufe wie z.B. der des Schmieds, und es bilden sich sozial höhergestellte Gruppen innerhalb der kupferzeitlichen Gesellschaft. Der Besitz von Metallobjekten bedeutet Reichtum, Macht und hohes soziales Ansehen. Die neue Technologie führt zu grundlegenden Veränderungen auch auf anderen Gebieten. Es kommt durch den Handel mit Kupfererzen zu mehr Kontakt zwischen den Kulturgruppen. Der Mensch dringt zudem, auf der Suche nach neuen Erzlagerstätten, in Gebiete vor, die vorher uninteressant waren. Die Landwirtschaft intensiviert sich, bessere Anbaumethoden und die Verwendung von Rindern als Zugtiere erhöhen die Ernteerträge. Der Speiseplan der kupferzeitlichen Bevölkerung bestand aus Getreide, Hülsenfrüchten, Obst und Fleisch. Angebaut wurde Nacktweizen, Einkorn, Emmer, Erbse und Ackerbohne. Früchte wie der wilde Apfel, Pilze und Beeren wurden gesammelt. Als Haustiere hielt man Rind, Schwein, Schaf, Ziege und Hund. Genutzt wurden auch Sekundärprodukte der Haustiere wie Leder, Milch, Käse und vielleicht auch Wolle.
Steinscheibe mit Lederriemen
Wer war Ötzi und welcher Kulturgruppe gehörte er an? Die Entdeckung des Mannes aus dem Eis und seiner Beifunde, im Speziellen sein Kupferbeil, haben vor allem die archäologische Forschung intensiv gefordert. Die Geschichte der Kupferzeit musste neu geschrieben werden. Die Einordnung der Funde ist schwierig, weil die kulturelle Zuordnung vor allem anhand keramischer Gefäße geschieht. Ötzi hatte aber keine dabei. Kulturell war der Südtiroler Raum schon immer ein Grenzgebiet, wo sich nördliche wie südliche Kulturerscheinungen bemerkbar machten. Die einzige inneralpine Kulturgruppe jener Zeit war die „Tamins-Carasso-Isera 5“. Die wenigen kupferzeitlichen Funde aus Südtirol sind dieser Kulturgruppe zuzuordnen, die sich im 4. Jahrtausend v. Chr. herausbildet. Beeinflusst war diese Gruppe vor allem von der Remedello-Kultur südwestlich des Gardasees. Im Gräberfeld von Remedello finden sich Männergräber mit vergleichbaren Waffen wie Dolchen, Beilen und Pfeilspitzen. Sie gehören zur Ausrüstung von Kriegern/Jägern aus der Kupferzeit. Die Kriegergräber zeugen von einer besonderen Stellung der Verstorbenen innerhalb ihrer Kulturgruppe, und auch der Mann aus dem Eis wird einen hohen sozialen Rang eingenommen haben. Was und wer er war, lässt sich heute nur noch erahnen. Er wurde in der Vergangenheit als Schamane bezeichnet, obwohl rituelle Ausrüstungsgegenstand fehlen. Man hat ihn als Hirte bezeichnet, wobei die Transhumanz in der Kupferzeit keinesfalls nachgewiesen ist. Auch der Beruf des Bauern wurde erwogen, seine grazilen Hände und das Fehlen von Schwielen infolge harter körperlicher Arbeit sprechen dagegen. Aufgrund des Fundortes, er liegt an einer Süd-Nord-Passage, die bereits vor Ötzis Zeiten begangen wurde, hat man ihn zum Händler gemacht. Es fehlt allerdings das Handelsgut. Vermutet wurde der Beruf des Erzsuchers, wobei weder im Schnals- noch im Ötztal Erzvorkommen bekannt sind. In seinen Haaren fanden sich Spuren von Arsen, das im Kupfer enthalten ist und beim Schmelzprozess frei wird, diese Erkenntnis machte ihn zum Schmied. Wir werden wohl nie genau wissen, was der Mann in seinem Leben war. Trotzdem bleibt und ist er der bedeutendste archäologische Fund des 20. Jahrhunderts.