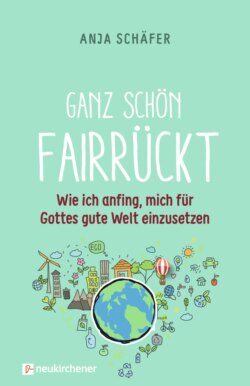Читать книгу Ganz schön fairrückt - Anja Schäfer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление02
Frei
Eine dreibeinige Katze und ein Inder in England
„Ich bin nur ein einzelner Mensch.
Aber ich bin ein einzelner Mensch.
Ich schaffe nicht alles, aber immerhin etwas.
Und nur, weil ich nicht alles auf einmal tun kann,
werde ich es nicht unterlassen,
wenigstens das Wenige zu tun, das ich kann.“
Helen Keller
„Die Freiheit, die Gott schenkt, ist,
dass wir frei für das Wesentliche werden.“
Helmut Thielicke
Ein Jahrzehnt meines Lebens habe ich im Ruhrgebiet verbracht. In Essen. Wir wohnten damals in einer Dachgeschosswohnung mit charmantem Ausblick auf einen ruhrpotttypisch verwilderten Hinterhof. Als eine Wohnung im Mietshaus neben uns frei wurde, suchten gerade Freunde eine neue Bleibe und zogen ein. Unsere Balkons lagen direkt nebeneinander, dazwischen eine 50 Zentimeter breite Kluft, in der es geschätzte zehn Meter in die Tiefe ging. Wenn das Ei fehlte oder wir Klappstühle für unsere Hauskirche brauchten, wurden sie einfach rübergereicht. Mit einem Schwung über den Abgrund hätten wir uns so auch ersparen können, unsere Kinder vier Stockwerke runterzuschleppen und im Haus unserer Freunde wieder hoch, wenn wir sie besuchen wollten, aber das haben wir uns verkniffen. Wir haben immer von einer Seilwinde geträumt, die Wasserkisten und am liebsten auch das Klavier nach oben transportiert, aber dazu ist es nie gekommen und am Ende haben wir doch immer alles selbst geschleppt (inklusive der Kinder – immer!).
Unsere Freunde brachten nicht nur ihre Klappstühle und das Klavier mit, sondern auch zwei Katzen, von denen eine den Namen April trug, weil jemand in eben jenem Monat ihre rollige Mutter versehentlich in den Garten zu den streunenden Katern gelassen hatte. Die andere Katzendame hieß Emma. Emma durfte raus auf den Balkon – in der Annahme, sie käme ohnehin nicht aufs Dach. Aber eines Tages schaffte sie es doch – und blieb verschwunden. Sie lag weder zehn Meter in der Tiefe noch wartete sie auf unserem Balkon, es fehlte jede Spur. Auch zum Abendessen und am nächsten Morgen blieb ihre Rückkehr aus. Unsere Freunde fragten in der Nachbarschaft herum und schließlich bewahrheitete sich die größte Befürchtung: Emma war übers Dach spaziert – und abgestürzt. Weil die Finder keinen Besitzer ermitteln konnten, obwohl sie in der Nachbarschaft herumfragten, brachten sie die Katze ins Tierheim. Jetzt sei sie aber in der Klinik, erfuhren unsere entsetzten Freunde. Denn sie habe sich beim Sturz vom Dach ein Bein gebrochen und das habe man nun amputieren müssen. Wenn unsere Freunde ihre nun dreibeinige Katze abholen wollten, müssten sie für die Operationskosten von 500 Euro aufkommen. Was unsere Freunde natürlich taten. Eine Katze gehört zur Familie.
Kontrastprogramm
Szenenwechsel. Mit sechs Freunden landen wir in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Aus Neugier und Reiselust und mit der vagen Ahnung, dass unsere Spiritualität auch etwas mit Gottes weniger privilegierten Kindern zu tun haben muss. Wir besuchen ein Team von Missionaren, von denen wir über ein paar Ecken gehört haben, treffen Kinder, die barfüßig auf der Straße sitzen und aus Kuhdung Brennmaterial herstellen, besuchen eine Schule im Slum, die aus nicht mehr als Mauern und einem Wellblech besteht, und übernachten vor den Toren der Stadt in einem Hospiz für Tbc-Kranke, die von Verwandten an den Straßenrand gesetzt wurden.
Unsere Gastgeber haben organisiert, dass wir für ein paar Nächte bei indischen Familien wohnen dürfen. Eine ältere, freundliche Dame nimmt den Gatten und mich auf und serviert uns sofort nach guter indischer Sitte dampfenden Chai – Tee mit Milch und vielen Gewürzen. Nach dem Abendessen erklärt sie uns ihren Altar aus Dutzenden hinduistischen Götterfiguren. Leider revoltieren in der Nacht unsere Mägen gegen das Essen und wir verbringen Stunden über dem Stehklo, das nicht mehr ist als ein Loch im Fußboden. Niemals sonst habe ich Toilettenpapier so sehr vermisst wie in jener Nacht.
Als die Dame am nächsten Morgen von unserem Ergehen hört, gerät sie in Panik, weil wenige Tage zuvor ein Junge aus der Nachbarschaft an Denguefieber gestorben ist – und dass dieses Schicksal in ihrem Haus auch die zwei blassen Europäer ereilt, dafür möchte sie nicht verantwortlich sein. Damit ist unser Aufenthalt bei ihr noch vor der zweiten Tasse Chai beendet.
Am Abend zuvor hatten wir allerdings noch Gelegenheit, uns mit ihrem Sohn zu unterhalten, der damals Ende 20 war, sehr sympathisch und zudem ein höchst kluger Kopf: Normalerweise arbeitet er als Dozent in England und ist nur zu Besuch bei seiner Mutter. Von all den merkwürdigen Dingen, die ihm im Westen begegnet sind, erzählt er uns eines mit besonderer Fassungslosigkeit: Es gebe in Großbritannien wirklich und tatsächlich Krankenwagen für Tiere! Kranke Hunde und Katzen würden allen Ernstes in eine Klinik transportiert! Für jemanden, der aus einem Land stammt, in dem ein Kind einfach so am Denguefieber stirbt und Tbc-Kranke von ihren Angehörigen an den Straßenrand gesetzt werden, ist das ein Hohn und eine Verzerrung aller Werte. Kühe genießen hier auch mitten in der Millionenstadt an jeder Straßenecke heiliges Aufenthaltsrecht. Aber das ist etwas anderes – und auf die Idee, sie ins Krankenhaus zu bringen, käme hier bei aller Unantastbarkeit trotzdem niemand.
Und so stellt sich eine Reihe von Fragen: Ist es moralisch in Ordnung, Tiere mit modernster Medizin zu versorgen, während in Indien alle halbe Stunde eine Frau vergewaltigt wird und in vielen Fällen keinerlei medizinische Hilfe erhält? Darf man eine Katze für 500 Euro operieren, während in Indien jedes Jahr 1,7 Millionen Kinder an Hunger sterben und vom selben Geld dort 20 Familien eine Woche lang leben, Dutzende Kinder mit Denguefieber oder Tbc behandelt werden könnten?
Schwierige Fragen
Ich verstehe unsere Freunde nur zu gut, denn natürlich lässt man Familienmitglieder nicht in der Tierklinik sitzen, wenn sie vom Dach fallen und sich das Bein brechen. Ob ich das allerdings überzeugend unserem indischen Bekannten erklären könnte, weiß ich nicht. Diese beiden Erlebnisse zusammen haben jedenfalls mein Bewusstsein geschärft. Denn natürlich geht’s dabei nicht um die Halter dreibeiniger Katzen, sondern um mich selbst und darum, wofür ich in dieser großen Welt und mitten in unserem heutigen Wertesystem mein Geld ausgebe – und wofür nicht mehr. Es geht um meinen Konsum. Um meinen Lebensstil. Um die Frage nach dem Guten in einer komplizierten, komplexen und selten eindeutigen Welt.
Wie absurd müssen manche meiner Anschaffungen auf Menschen anderer Kulturen wirken? Einen Schritt zurückzutreten und mein Shoppingverhalten mit den Augen einer Kenianerin oder eines Pakistani zu sehen, fördert manche Unverhältnismäßigkeit zutage. Auch den, welchen Stellenwert der Konsum bei uns hat, wie viel Raum er in unserem Lebensstil einnimmt. Ob mir das gefällt oder nicht.
Die Frage, wie ich leben will, gehört zu meinen Lieblingsfragen, weil sie das Zeug hat, meine inneren, kreativen Kräfte zu aktivieren. Sie ist spannend, weil sie nach vorne gerichtet ist und weil sie mir klarmacht, dass ich frei bin: frei, Entscheidungen zu treffen. Ich kann mir bewusst Werte und Ziele auswählen, bin nicht verpflichtet, im Mainstream zu schwimmen, muss mich nicht mitreißen lassen, sondern kann gestalten, anpacken. Frei und freiwillig. Das ist mir wichtig. Ich will unabhängig denken.
Und das gilt trotz unserer finanziellen Grenzen. Ich kann so viel mehr entscheiden, als ich manchmal auf den ersten Blick glaube. Denn bewusst zu leben, kostet nicht immer mehr. Bibliotheken sind kostenlos und sparen Rohstoffe, das Fahrrad kostet keinen Sprit, Secondhand-Shirts sind billiger als neue. Da bleibt das Geld übrig für einen Einkauf im Hofladen.
Mehr als ein Trend
Kein Szenecafé, das nicht auch fairtrade Caffè Latte mit Biomilch führt, kein Bäcker ohne Bio-Dinkel-Vollkornangebot. Bio hat in den letzten Jahren einen kleinen Boom erlebt. Und ich freue mich, wenn bio-faires Leben angesagt ist, und erst recht, dass Bio nicht mehr Jutebeutel und Latzhose bedeutet, sondern dass schöne Bio-Verpackungen im Laden stehen, die den Ökokonsum zuweilen wahlweise gar zu Kunst, Avantgarde oder Luxus erheben.
Andererseits geht jeder Trend zu Ende. Coldplay-Sänger Chris Martin tritt nicht mehr mit dem Gleichheitszeichen auf der Hand auf, das er eine Weile bei Konzerten fett in Schwarz auf der Hand trug und das für die internationale Organisation „Make Trade Fair“ stand. Statt Büchern wie „Tu was!“ oder „Welt retten für Einsteiger“ erscheinen jetzt Titel wie „Ökofimmel“, „Die Grüne Lüge“ und „Öko-Nihilismus“, die sich kritisch mit unserem ökologischen Bewusstsein auseinandersetzen. Und sie haben natürlich an vielen Stellen recht. Wir sparen mittlerweile so eifrig Wasser, dass die Stadtwerke die Rohre spülen und teure Chemikalien hinterherkippen, weil sonst zu wenig durch die Kanalisation fließt. Hierzulande nützt es der Umwelt viel mehr, wenn das eigene Abwasser nicht stärker verdreckt und erhitzt wird als nötig, als dass wir jeden Tropfen zählen, den wir verbrauchen. Nicht alles, was wir im guten Glauben tun, hilft der Natur wirklich. Aber mich nervt, dass solche Bücher und Statements so manchem gleich als bequeme Ausrede dienen, sich lieber gar nicht erst Gedanken zu machen und weiterzuleben wie bisher. Und ich fürchte, dass mancher, der gestern noch fairen Kaffee schick fand, sich morgen über irgendetwas anderes definiert. Kritischer Konsum ist jedoch zu wichtig, als dass er vom nächsten Lifestyletrend abgelöst werden darf, finde ich.
Genauso nervt mich allerdings auch manchmal die andere Seite, wenn der Bio-Lifestyle quasi religiöse Züge annimmt – mit festen Maximen, Heilsversprechen und Ächtungen für Fehltritte. Auf einem grünen Leben ruhen mitunter eine Menge Hoffnungen; wer fair trade kauft und Fahrrad fährt, scheint damit manchmal einen inneren Sinn zu verbinden, von dem ich mich frage, ob er nicht aufgeblasen ist. Unseren Planeten aufzuräumen, ist richtig – aber sind der Eifer, die Sinnsuche darin immer angemessen und die Verbissenheit, mit der sich manche daran klammern? Vegane Ernährung, Autoverzicht, Bio-Gemüse gehören dann zu den festen Geboten. Wer Fleisch isst oder bei H&M kauft, kann kein guter Mensch sein ...
Da gehen bei mir schnell alle Klappen zu. Mir geht’s drum, meine Freiheit zu nutzen, nachzudenken, persönlich was zu verändern – und nicht political correct gängige Trends zu bedienen. Das Bekenntnis des ehemaligen Grünen-Politikers Rezzo Schlauch, der zugab, seinen Müll nicht zu trennen, fand ich da direkt erleichternd. (Wobei ich selbst zu den treuen Seelen gehöre, die glücklich fünf verschiedene Mülltonnen bestücken und am liebsten noch den Teebeutel samt Etikett in Bio, Papier und Metalle zerpflücken – was ich nur ganz selten tue, wirklich.) Freiheit ist ein großes Thema in der Bibel. Das ist die Haltung, aus der heraus ich handeln will.
Himmel auf Erden
In einem Interview sprach der frühere amerikanische Pastor Bill Hybels den U2-Frontmann Bono auf seinen Lieblingsvers an, den wirklich tollen Satz aus dem Vaterunser: „Dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden.“ Bono sagte dazu: „Viele Leute geben sich zufrieden mit einem schönen Leben nach dem Tod, aber ich glaube nicht, dass das unser Ziel ist. Wir sollen im Kleinen wie im Großen den Himmel auf die Erde bringen, in jedem Winkel unseres Lebens sollen wir versuchen, den Himmel auf die Erde zu holen. Wir sollen nicht im Frieden mit der Welt leben, denn die Welt ist für die meisten Menschen dieser Erde kein schöner Ort.“2
Wohlgemerkt: Davon, den Himmel auf die Erde zu bringen, redet Jesus im zentralen Gebet der Bibel! „Bewahrung der Schöpfung“ ist ein so abgestandenes Schlagwort aus friedensbewegten Zeiten, dass es mich sanft zum Gähnen bringt und mir nicht mehr viel bedeutet. Aber es liegt tatsächlich keine zweite Erde auf dem Dachboden – und auch wenn Gott eines Tages doch eine neue samt Himmel zur Verfügung stellt (wie in der Bibel in Jesaja 65,17 angekündigt), möchte ich nicht die Schuld daran tragen, dass meine Urenkel vorher auf der alten im Gift waten, unter Klimafluten leiden oder die letzten Tierarten betrauern mussten. Dreck zu hinterlassen, gehört sich einfach nicht. Darum will ich mit für unsere Erde sorgen. Dass wir Christen da bisher nicht engagierter bei der Sache waren, liegt vielleicht auch an einem Übersetzungsproblem.
Im ersten Buch der Bibel steht: „Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen … und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht“ (1. Mose 1,26-28 LUT). Klingt, als könnten wir Menschen der Erde beliebig unseren Willen aufzwingen, als wäre sie unsere willige Sklavin, zur Ausbeutung geschaffen. Was wir auch ausgiebig getan haben.
Angemessener wäre aber vielleicht eine andere Übersetzung des hebräischen Wortes kabasch, das Luther mit „Macht sie euch untertan“ übersetzt: „Hegt und pflegt die Erde!“, könnte sie lauten. Im jüdischen Denken lagen „herrschen“ und „kümmern“ eng beieinander. Ein Herrscher war immer auch für diejenigen verantwortlich, die ihm unterstellt waren. Ganz verübeln kann man Luther die Wortwahl nicht, in späteren biblischen Texten kann kabasch tatsächlich die Bedeutung von „niedertreten“ oder sogar „vergewaltigen“ haben. Aber in älteren Texten des Alten Testaments (zu denen die Schöpfungsgeschichte gehört) geht es darum, Land nach der Eroberung zu bebauen und zu gestalten, um sich davon zu ernähren. Ein Gärtner entscheidet nach Gutdünken über Art und Ort seiner Pflanzen, er beschneidet und erntet und pflanzt neu. Aber er sorgt auch für Wasser und Nährstoffe, er gießt und düngt, befreit von Unkraut und Schädlingen. Er herrscht und kümmert sich, er hegt und pflegt.
Ähnliches gilt übrigens für das andere Verb hier: Das hebräische Wort, das mit „herrschen“ oder „regieren“ übersetzt wird, erinnert an Formulierungen in den Psalmen, in denen der Gedanke des Hütens steckt. Also eher Hirte und Herde als Herrscher und Untertan. Das wiederum passt dann sehr gut zu einer Formulierung im nächsten Kapitel der Bibel, in dem Gott den Menschen einen Platz im Garten Eden gibt, damit „er ihn bebaute und bewahrte“ (1. Mose 2,15 LUT). Das ist fast wie in der Geschichte von Jesus im Neuen Testament, in der ein Chef seinen Angestellten Geldsummen gibt, die sie verwalten sollen – je kreativer und aktiver sie damit umgehen, desto besser (Matthäus 25,14-30). Insofern war die Wortwahl „untertan machen“ nicht sehr glücklich und hat Christen nicht besonders dazu angespornt, für den Umweltschutz in die Bresche zu springen.
Adam und Eva waren Forscher, Gärtner und Gestalter. Wir sind als Gottes Ebenbilder angelegt, was sich auch an unserer Kreativität und Gestaltungskraft zeigt und uns eine Aufgabe zuweist: Wir sind dafür geschaffen, etwas zu erschaffen. Gott hat sich uns als schöpferische, schaffenskräftige Wesen gedacht. „Fruchtbar“ zu sein, meint einerseits die Fortpflanzung, andererseits aber auch das Gestalten der Erde, unseres Lebensraums, unserer Umwelt. Wir arbeiten mit dem, was Gott geschaffen hat, und formen es weiter. Wenn wir produktiv sind, schöpferisch arbeiten, reflektieren wir Gottes Wesen. Wenn wir aufräumen oder Unkraut zupfen, wenn wir etwas reparieren, fertigstellen, wenn wir einen Bericht schreiben, ein Bild malen oder etwas entwickeln – beteiligen wir uns an Gottes Werk, Schönheit aus dem Chaos hervorzubringen. Er hat uns seine Schöpfung anvertraut, damit wir ihre Schönheit bewahren, ihre Fruchtbarkeit erhalten.
Wenn ich morgens unter der heißen Dusche stehe oder abends in warme Decken gewickelt von meinem Sofa aus in den Hamburger Regen starre, werde ich dankbar, dass ich in Westeuropa lebe, wo warmes fließendes Wasser zuverlässig aus der Leitung und Wärme aus der Heizung kommt. Und diese Dankbarkeit macht mich frei dazu, etwas zurückzugeben. Macht mich frei, dazu beizutragen, dass es anderen ebenso ergeht, dass die Schönheit das Chaos besiegt. Und dazu gehört für mich die Frage: Wie will ich leben, wie kann ich leben, damit die Schönheit das Tohuwabohu besiegt?
Ich mag den Ausspruch: „Wohlstand ist keine Sünde. Nicht zu teilen schon.“ Ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich in unserem Land leben darf und es mir gut geht – was viele andere nicht von sich sagen können. Gott gibt gern. Sein Schalom, das hebräische Verständnis von Gottes Frieden, umfasst nicht nur die Freiheit vom Krieg, sondern ein in allen Bereichen mit Gutem gefülltes Leben. Aber das Gute ist nicht für mich alleine da. Und es ist nicht mehr gut, wenn ich mein Leben nicht so einrichte, dass es auch anderen dient. Letztlich ist mein Ansporn die Dankbarkeit. Weil ich mich freue, viel zu haben, bin ich frei zu teilen. Weil ich mir meine Freude nicht durch unwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen anderer erkaufen will, frage ich nach besseren Wegen, um das zu kaufen, was ich brauche. Weil ich dankbar bin, suche ich nach Alternativen in meinem Konsum.
Grenzen
Doch für die Alternativen gibt es Grenzen. Ich habe nicht alle Freiheit zu entscheiden, wie ich leben will:
Ich habe finanzielle Grenzen und kann meine Großeinkäufe nicht allesamt im Bioladen erledigen und meine Kleidung nicht ausschließlich bei kleinen grünen Labels kaufen, wie ich das vielleicht schön fände.
Ich habe zeitliche Grenzen: Ich kann nicht wöchentlich sieben verschiedene Läden und den Wochenmarkt mit dem Fahrrad abklappern, um alles, was auf der Liste steht, fair und ökologisch korrekt zu besorgen.
Ich habe persönliche Grenzen: Mein innerer Schweinehund mag nicht jeden Tag mit Kind im Anhänger 14 Kilometer Fahrrad fahren, obwohl andere das bei Wind und Wetter tun und ich sie sehr dafür bewundere.
Und ich habe Wissensgrenzen. Viele Themen rund um bio-faire Produkte sind komplex, manche Informationen sind widersprüchlich, andere sind schwer zu bekommen. Manches muss ich kaufen, obwohl es nicht so fair ist, wie ich mir das wünsche. Mancher Aussage muss ich trauen, obwohl eine Ahnung mir sagt, dass es auch ganz anders sein könnte.
Aber bei all diesen Grenzen bleibt genug Freiheit übrig, um mir die spannende Frage zu stellen, wie ich leben will. Die Freiheit, die ich habe, die will ich sehen und suchen und füllen. Sie ist mein Spielraum, in dem ich gestalte, nach vorne schaue, mir aussuche, was ich in meinem kleinen Alltag umsetzen und anpacken will. Ein Zitat ist dabei so etwas wie ein Motto für mich geworden (und hat sich auch bewährt, obwohl Punkt eins noch nicht überzeugend gelöst ist ...): „Verdiene viel, verbrauche wenig, teile gern, gib großzügig und feiere das Leben.“3