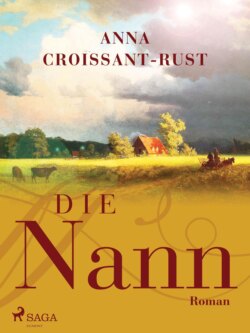Читать книгу Die Nann - Anna Croissant-Rust - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеNach acht, es war schon dunkel geworden, und die gegenüberliegenden Berge warfen schon lange Schatten, sassen der alte und der junge Anderl und die Juli bei der Suppe. Juli hatte die roten Vorhänge vorgezogen, wie sie es die Mutter hatte tun sehen, das Licht angezündet, die Schüssel auf den Tisch gesetzt und Brot hineingeschnitten. Jetzt löffelten die drei los, die Kinder eng aneinander gedrückt. Der Juli liefen bald die Tränen über die Backen, und sie legte den Löffel weg. Da Anderl stets das tat, was die Juli ihm vormachte, fing auch er zu heulen an und legte den Löffel weg.
„Iss, Bua!“ schrie ihn der Vater an, und gehorsam tauchten die zwei Kinder wieder ein, Juli nur mit Widerwillen die Suppe hinabwürgend.
Da klopfte es draussen an der Türe. Der Vater ass ruhig weiter, die zwei andern hielten inne, den Löffel mit aufgestütztem Arm in die Luft haltend. Und wieder klopfte es.
„Voda, klopfen tut’s,“ sagte Juli, die Resolutere, leis.
„Halt’s Maul, und dass mir koans aussergeht!“
Juli und Anderl sahen sich an, der Bub hielt den Mund offen und lugte starr nach der Türe, wie wenn dort etwas hereinkommen müsste, sie zu erschrecken.
Aber der Vater stopfte sich in aller Umständlichkeit eine neue Pfeife und blies bald solche Wolken von sich, dass das ganze Zimmer grau war; sollte er sich denn da fürchten? Es wurde kühl, und von der Küche, deren Fenster offen standen, wehte der Firnwind herein, hier und da hörte man ein paar Töne des Abendläutens von Jodok herauf.
Da klopfte es so stark an das Fenster, an dem die Juli sass, dass die mit einem Schreckensruf in die Höhe fuhr und Anderl sich unter dem Tisch zu verkriechen suchte.
Der Alte stand auf, nahm den Bergstock aus der Ecke, und bald hörten die zwei den Riegel, dann die Haustüre knarren, ein paar Schreie und flüchtende Schritte an den Fenstern vorbei, hörten alsbald den Vater rings ums Haus gehen, zweimal, sie hielten den Atem an – nichts – dann knarrte weit weg ein Riegel – „die Schupfentür“ wisperte Anderl; nun kam der Vater durch den Stall zurück, und wieder knarrte der Riegel, dann schloss er die Küchenfenster, schloss die Haustüre, lehnte den Bergstock in die Ecke und trieb die Kinder mit einer herrischen Gebärde auf.
„Geht’s ins Bett“, sagte er rauh, „der Bua schlaft da in der Kammer, und du geahscht jetzt aufer mit der Nann, und da oben bleibt sie, ich will sie nie mehr sehen da unten.“
So wurde die kleine Nann von ihrem Vater aus der Stube verbannt und musste ins obere Stockwerk wandern.
Juli trug das Kind, das durch das Aufheben erwacht war, an dem Vater vorbei, wie wenn sie ein Unrecht tue, und es fiel ihr schwer auf die Seele, dass das Kind wieder zu weinen anfing. Als sie das weinende Kind droben aufs Bett gelegt und ihr Stümpfchen Kerze angezündet hatte, kam ihr ihr zukünftiges Leben so schwer vor, dass sie zu heulen und zu beten anfing. Was sollte sie denn mit dem kleinen Kinde anfangen? – Und die Mutter, die doch so gut war, die war jetzt tot, und nur der böse Vater blieb, und niemand half ihr mehr ...
Keiner sagte ihr etwas – –. Sie schaute die Nann an – so blass sah sie aus; wenn sie starb, wer war dann schuld? Die Juli. Wenn sie schrie, wer war dann schuld? Die Juli. Und das Kind wimmerte fort und fort. Sie nahm es auf den Arm und trug es herum, es weinte weiter, sie legte es nieder und nahm’s gleich wieder auf; der Arm wurde ihr lahm, sie musste sich aufs Bett setzen und das Kind in den Schoss nehmen, aber ruhig wurde es auch da nicht. Sie redete der kleinen Nann zu, sie sang ihr leise etwas vor, dann horchte sie wieder, ob sich im Haus etwas rühre, ob der Vater noch auf sei und sie hören könne – es war alles ruhig. Unermüdlich ging sie auf und ab, und unermüdlich weinte das Kind, nichts wollte helfen. Ob’s am Ende gar Hunger hatte? Wie ein Dieb schlich sich die Juli hinunter, mit Herzklopfen, es gab ihr jedesmal einen Stich, wenn die Stufen knarrten; sie tappte sich durch den Gang nach der Küche, da war ja noch warme Milch! Eilig schüttete sie etwas Wasser daran, wie die Mutter immer getan, und tastete sich gegen die Stube, das kleine Stümpfchen Licht vor dem Erlöschen schützend. Sie musste ja auch das ‚Flascherl‘ haben. Beinahe hätte sie Milch und Kerze fallen lassen, denn drinnen in der Stube sass der Vater noch auf, die Ellbogen aufgestützt und das Gesicht mit den Händen verdeckt, und als er sie jäh zurückzog, sah sie, dass er weinte.
In die Erde hätte sie sinken mögen, Angst und Scham schnürten ihr den Hals zu, sie wusste nicht, was sagen oder tun. „’s Flascherl!“ stiess sie endlich heraus, und als sie’s hatte, flog sie wie der Wind über die Treppe.
Sie war so verwirrt, dass sie kaum der Nann die Nahrung reichen konnte. Der Vater weinte. Warum weinte er? – Er hatte doch keine Träne vergossen, solange die Mutter schwer krank war, keine, als sie tot drinnen lag, keine während der Leiche! Er kam ihr sonderbar und fremd vor, und doch stand er ihr wieder näher, er tat ihr leid, und trotzdem scheute sie sich wieder hinunterzugehen zu ihm. –
Die kleine Nann hatte gewaltig an ihrer Flasche geschluckt, nun schlief sie fest. Die Juli aber war noch lange wach, auch nachdem das Licht ausgegangen war, und allerlei Gedanken und Sorgen rumorten in ihrem jungen Kopfe.
Ans Fenster gekauert, sah sie angestrengt auf den hellen Fleck vor dem Hause, der Vater hatte die Lampe immer noch nicht gelöscht. Endlich hörte sie ihn aufstehen, der lichte Fleck verblasste, nun war’s fast ganz dunkel. Undeutlich nur sah man das Gezack der Berge gegen den Himmel stehen, die kleinen weissen Häuser wie Flecke an der Lehne kleben und den Schnee in den Schroffen, da säumten sich plötzlich die Gipfel mit einem hellen Streifen, ein weisser Schein breitete sich über den Himmel aus, und langsam kam der Mond wie hinter einer Riesenmauer vor.
Hatte sie nicht etwas gehört? Leise Tritte? – Sie drückte den Kopf nahe ans Fenster – da schlichen zwei ums Haus, in die Fenster spähend, vorsichtig an den Türen rüttelnd, wie Wölfe, die in der Nacht auf Raub ausgehen; sie kamen, verschwanden im Schatten, kamen wieder – ein heiseres Geflüster, die Steine am Weg krachten, eilige Tritte in der Ferne, dann wurde es still.
Und nun schaute der Mond heraus, eine weiche Helle lag über dem Tal und den Gletschern, in einem fernen Gehöft bellte ein Hund, da kroch die Juli endlich zitternd ins Bett. Es war kühl geworden, und der Wind wehte leichte Nebel an den Zacken der Berge hin. Julis letzter Gedanke war, als sie müde und zerschlagen unter den Laken lag: ‚Morgen gehst du zu der Malseinerin, dass sie dir’s sagt wegen der Nann.‘
Als die Malseiner Knechte am frühen Morgen – kaum graute der Tag, und die Berge sahen noch finster aus gegen den glasigen Himmel – aufs Mähen gehen wollten, fanden sie in dem Schupfen die Kuchlerdirnen, die eine im Unterrock, die andre ohne Leibchen, fest in eine Schürze gewickelt. Sie lagen und schnarchten und schliefen wie die Murmeltiere, selbst das Gelächter der Knechte weckte sie nicht. Erst als sie einer gehörig rüttelte, wachten sie auf. Moidl setzte sich in die Höhe, rieb sich die steifen Arme, – sie hatte ihr Leibchen der Kathl gegeben – und lachte die Männer an. Sie war keineswegs verlegen, – halb verschlafen wie sie war, rüttelte sie sich und konnte sich nicht entschliessen, aus dem warmen Stroh aufzustehen. Kathl dagegen, mürrisch und zornig wie immer, hatte sich zuerst umgedreht und aufs Gesicht gelegt, dann war sie aufgesprungen und hatte versucht, sich mit Ellenbogenstössen Platz zu machen, um durchzukommen. Doch die Knechte standen fest und konnten nicht genug kriegen, sich an dem Aufzug der beiden und an Kathls Wut zu weiden. Selbst als der Bauer unter die Haustüre trat, gingen sie nicht auseinander. Der Malseiner hielt die Hand vor die Augen, denn die ersten feurigen Streifen kamen am Himmel herauf und blendeten ihn. Er war in Hemdärmeln, trotzdem es so kühl war, dass man seinen Atem sah. „Was is?“ rief er hinüber, ohne einen Schritt vorwärts zu machen, „was gibt’s?“ Er war hoch gewachsen, breit in den Schultern, mit einem braunen krausen Vollbart, die kurzgehaltenen Haare seitwärts gescheitelt, während sie im Nacken weit hinuntergewachsen waren. Stattlich und bewusst, mit kräftigen Beinen, stand er vor dem Hause. Die Stimme klang scharf und kurz, aber man sah’s den braunen Augen an, dass sie nicht nur unwillig schauen konnten, wie jetzt.
Michel, der älteste Knecht, ein grober, wüster Kerl, hatte eben die Moidl am Arm gepackt und versuchte sie in die Höhe zu zerren: „Bringsch’n ja nit wach, den Duifl,“ schrie er, „hat no sein’n Rausch von geschtern, scheints!“
Moidl widerstrebte, halb aus Zorn, halb aus Vergnügen an der Sache, die ihr ganz lustig vorkam. So zerrten sie hin und her, die Knechte lachten und schrien, und Moidl schrie und zeterte. Die Dirnen kamen nun auch alle aus dem Haus, laufend und so neugierig, dass sie sich nicht einmal Zeit liessen, sich vollends anzuziehen, sondern noch im Gehen die Röcke und Schürzen einhakten. Sie drängten sich vor die Männer und waren im Spotten und im Geschrei und Gelächter die ärgsten. Keine war dabei, die Kathl oder Moidl beigestanden hätte, umsonst versuchte Kathl bei ihnen durchzukommen. Erst als der Bauer näherkam, weil ihm keiner Antwort gab, und die Dienstboten anrief, erst als die sich nach ihm umdrehten, gelang es ihr, mit einem Puff bei den Dirnen eine Lücke zu stossen und wegzulaufen.
Moidl hockte, noch immer blöd lachend, auf dem Boden und schaute den Bauern hilflos an.
„Ha, die Moidl!“ sagte er, „wo kimmscht denn du her?“ Alle schwiegen; das Gelächter hörte sogar auf, nur die Dirnen wisperten hinter dem Rücken der Knechte. Jetzt, nachdem sich der Malseiner an das Halbdunkel des Schupfens gewöhnt hatte, sah er erst, wie Moidl ausschaute. „Geht’s an die Arbeit!“ herrschte er die Dienstboten an. „No – Marsch, sag’ i!“
Zögernd entfernten sie sich, die Weiber sich dicht beieinander haltend und tuschelnd. Immer wieder drehten sie die Köpfe herum und versuchten noch etwas zu hören.
„Jetzt sag’, Moidl, was ischt mit dir?“
Statt aller Antwort fing sie an zu heulen und liess sich nicht beschwichtigen, sondern heulte immer lauter.
„Hat di der Vater g’jagt?“
„Ja, ja,“ schrie sie, und ganze Tränenbäche rannen über ihr braunes Gesicht.
„Warum denn?“
„I woass nit, i woass nit!“ – sie begann ihre nackten Arme zu reiben, „mi friert a so,“ dabei blieb sie am Boden knien und machte keinen Versuch, aufzustehen.
Dem Malseiner fiel ein, dass er sie gestern beim Leichentrunk hatte schäkern und lachen hören und dass sie mitten unter einer Rotte von jungen Burschen gesessen hatte, die ihr fortwährend einschenkten. Seine Frau hatte noch gesagt: „Na, wenn das Madl koan Rausch kriegt heut, die stellt si schön an beim Leichentrunk!“
Sie war wirklich ausser Rand und Band gewesen. Fortwährend hatte sie den Kopf im Nacken und den Mund weit aufgerissen und lachte ohne Aufhören, wie wenn sie immerfort gekitzelt würde. Das war das erstemal, dass sie länger mit Burschen zusammen war, denn der Vater hatte sie nie fortgelassen, und auf dem Einzelhof, wo sie in der letzten Zeit gedient hatte, kam sie auch nicht unter die Leute.
Der Bauer schaute die zerraufte und heulende Dirne missmutig an.
„Steh auf,“ sagte er kurz, „geh einer, iss was,“ und drehte sich um, aufs Haus zugehend.
Moidl tappte sich an der Mauer in die Höhe und folgte dem Bauern zögernd nach. Ihre Schuhe und Röcke waren voller Staub und Schmutz, die Haare hingen ihr ins Gesicht und klebten voller Tannennadeln, sie zog und zerrte an der Schürze, um sie über die Schultern zu bringen, und drückte sich halb scheu und halb trotzig an den Türpfosten.
In der grossen Stube stand, wie jeden Morgen, eine dampfende Schüssel für Bauer und Bäuerin; eine kleinere für den seltenen Vogel, den sie heute im Schupfen gefunden, hatte die Bäuerin dazugestellt.
Moidl sagte kein Grüss Gott, und die Bäuerin beachtete sie weiter nicht. Vor den Männern hatte sich Moidl nicht gescheut, aber hier in der grossen reinen Stube, die ganz mit dem kalten grauen Frühlichte erfüllt war, vor den forschenden Augen der schlanken, peinlich sauberen Bäuerin begann sie sich ihres Aufzuges zu schämen. Unbeholfen strich sie an sich herum, zog die Schürze fest um sich und fing dann wieder an, sich die Nadeln aus den Haaren zu lesen, immer aber hielt sie die Augen niedergeschlagen.
„Geh di waschen und kampeln,“ sagte die Bäuerin, gab ihr das Schüsselchen mit Milchsuppe und Brot in die Hand und schickte sie in die Kammer.
„Muass ma sie nachher wieder hoamschicken?“ sagte sie.
„Wenn sie dir geht,“ nickte der Bauer.
„Der Kuchler-Anderl muass sie wieder g’halten, des Diandl is zu jung, er kann sie nit aus’m Haus werfen.“
„Du kennst ’n Kuchler schlecht,“ sagt er, „’s Madl fürchtet sich ja z’tot.“
„Nimm du sie! Arbeit ischt gnua!“
„I? – A Kuchlerdirn? Na na, da wird nix draus!“
„Mir reden an andersmal davon,“ sagte die Bäuerin, und da sie stets rasch von Entschluss war und sich alles schnell zurechtlegte, ganz im Gegensatz zu ihm, der in allen wichtigeren Dingen bedächtig vorging, wenn er nicht zornig war, meinte sie: „I geah jetzt glei auffer zum Kuchler, i han a so mit ihm zu reden wegen seiner Arbeit bei uns, und nach der kloa’n Nann und der Juli möcht’ i a schaun, nachher werd’ i ’s schon sehgn. Fressen wird er mi nit glei! ’n Hansi nimm i mit, er will a so schon lang das Poppele sehn.“
Die Sonne war schon hinter den Bergen vorgekommen, als die Malseinerin und Hansi gegen das Kuchlerhäusl aufwärts stiegen. Das Tal war licht und hell, tief unten sah man den grün und roten Kirchturm von St. Jodok wie ein Kinderspielzeug liegen. Die Fenster in all den grossen und kleinen Häusern blinkerten lustig, die Kühe bimmelten weit oben auf den Almen mit ihren Glocken, der Bach schäumte und plätscherte, bis weit hinunter konnte man ihn verfolgen. Auf dem Gras, das zwischen den Steinen im Schatten wuchs, stand noch der Tau, und auf der andern Talseite drüben war’s noch frisch, und leichter Morgendunst lag dort. Den zweien aber wurde es schon heiss im Aufwärtssteigen.
Hansi suchte nach den Knechten und Dirnen, die zum Heuen ausgegangen waren, und entdeckte sie bald da und bald da, hoch oben, und zeigte sie der Mutter. Das lebhafte, bewegliche, mehr zugreifende Temperament der Mutter vereinigte sich bei ihm ganz glücklich mit der nichts überstürzenden, etwas zu bedächtigen Art des Vaters; das Aufbrausende und ganz unerwartet Hervorbrechende hatte er auch vom Vater. Seine ganze kräftige und schon hochgewachsene Gestalt sah nach Leben und Gesundheit aus, und wie er droben neben Anderl stand, schon fast so gross wie der Fünfzehnjährige, und wie sein rotbackiges Gesicht von dem gelbbraunen Anderls abstach, fuhr dem alten Kuchler ein Fluch heraus. „Schamst di nit, Anderl? Is dös aar a Bua? Schau ’n Hausi an.“ Aber Anderl streckte sich nicht etwa oder hielt sich gerader deshalb, er zog den Kopf nur noch mehr ein und schielte von unten vor.
Obwohl die zwei Buben fast tagtäglich denselben Weg zur Schule gegangen waren, war nie ein kameradschaftliches Verhältnis zwischen ihnen gewesen. Hansis stolzem, geradem Sinn widerstrebte das scheue, verschlossene und unterwürfige Wesen Anderls; seine Anschauung hatte er dem Blöden sehr oft durch Püffe oder durch eine Tracht Prügel gezeigt. Was Anderl von allen, vom Vater, vom Lehrer, sogar von der Juli hörte, die sonst ganz gut mit ihm war, das „Scham di!“ oder „Schamst di nit?“ hörte er auch oft genug von Hansi, und er hatte nie eine Freude, den Malseinerbuben zu sehen, wie dieser sich auch sobald als möglich von Anderl losschrauben wollte.
„I will doch ’s Poppele sehn,“ sagte er ungeduldig zu der Mutter, die ihm zu wenig Gehör schenkte.
„Ja, ja,“ nickte die Bäuerin zerstreut.
Anderl sprang voraus, das war auch ihm recht. ‚Das Poppele‘ war auch ihm gegenwärtig das Liebste.
Während die Malseinerin den alten Starrkopf zu bearbeiten suchte, dass er die Moidl wieder aufnähme, sass Hansi bei der Juli in der Kammer auf einem kleinen Schemel und hatte die Nann auf den Knien liegen. Schon lange hatte er sich ein Schwesterchen gewünscht, einen kleinen Spielkameraden, jemand, den er an der Hand über die steilen Wiesenmähder hätte führen können bis hinauf zu den kleinen Stadeln, wo man weit, weit bis ins Dux und gegen das Zillertal zu, nach Navis und über den Brenner sehen konnte, wo alles im Sommer voller Blumen stand, dass man sich nichts Schöneres denken konnte als dort liegen und den blauen Himmel ansehen; jemand, mit dem er über die Steilhänge hätte herabrollen können, der mit ihm schrie und jauchzte vor Lust – einen kleinen Kameraden zum Rodeln im Winter, wo er wie der Sturmwind über die Halden sauste, eine Gefährtin beim Schneeballen, die seine grossen Schneemänner, seine Wälle, seine Schneehäuser bewundert hätte, ein kleines Schwesterchen, dem er seine Schnitzarbeiten zeigen, dem er Spielsachen hätte schnitzen können. Gerade jetzt, wo er nur des Sonntags zur Schule ging und ihn der Vater noch nicht immer zur Arbeit anhielt, ging’s ihm ab, und er hatte oft die Mutter gequält, dass sie ihm ein ‚Poppele‘ bestellen solle, aber ein Schwesterchen musste es sein, von einem Bruder wollte er nichts wissen.
„Wenn sie grad schon grösser wär’“, sagte er nachdenklich und etwas geringschätzig zur Juli und gab ihr die kleine Nann. Nie war ihm in den Sinn gekommen, mit Juli zu spielen, die ihm im Alter doch näher stand als der Anderl. Er war ja oft genug zu der Kuchlerin heraufgekommen, war viel bei ihr im Garten gewesen, aber nie erinnerte er sich, mit der Juli gespielt zu haben. Er hiess sie nur die Zigeunerin und mochte ihr krauses, wirres Haar, das bronzefarbene Gesicht, ihre pechschwarzen, etwas glanzlosen Augen nicht leiden.
Dagegen gefiel ihm die weisse kleine Nann mit den gelben Löckchen sehr.
„Da schau grad’ die feinen Haarlen an und die kloan Fingerlen! I muass sie glei der Muatter zeig’n,“ und eilends nahm er sie wieder Juli ab und stieg hinunter.
„Da schau, Muatter, ’s Poppele, wie nett es ischt.“
Die Mutter nahm’s ihm vom Arm.
„Wie a Engerl, gelt, Kuchler, ma muss es ja gern hab’n, das arme Heiterl!“
Aber der Kuchler stand am Fenster, drehte ihr den Rücken und tat, als höre und sehe er nicht. Erst als Hansi gegangen war, gab er seinen Platz am Fenster wieder auf, und auf seinem Gesicht stand deutlich zu lesen: ‚Was willst du denn noch? Ich brauch’ niemand von Malsein in meinem Haus,‘ und die Sprache war so deutlich, dass die Malseinerin sich gleich zum Gehen anschickte.
„Also, Kuchler“, sagte sie, „es bleibt dabei, du nimmscht die Moidl nit?“
„I nit.“
Die Malseinerin hatte auch ihren Trotz, und jäh, wie sie war, fuhr’s ihr heraus: „Na nimm ich sie.“
Der Kuchler lachte. „G’halt sie nur, i wünsch’ dir Glück dazua!“
Nun musste sie eben sehen, wie sie den Malseiner herumbrachte, auf der Alm war Arbeit genug oben und immer eins zu wenig, da konnte man sie fürs erste schon aus dem Weg räumen.
Die Juli ging noch ein gutes Stück Weges mit und kam dann mit all ihren Sorgen und bat um Rat.
„Sei du nur brav, Juli, es wird schon gehn, i will gern nachschaug’n“, war der Malseinerin letztes Wort. „Du musst es dem armen Hascherl seiner Muatter zulieb tun, wenn der Vater nix von ihm wissen will.“