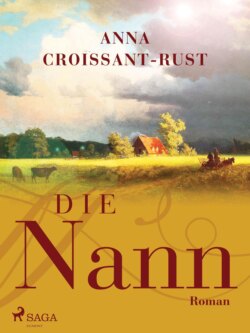Читать книгу Die Nann - Anna Croissant-Rust - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеEs blieb viele Tage hartes Frostwetter, dann kam’s zum Tauen und fror wieder, so dass grosse Eiszapfen vom Dach des Häuschens herabhingen; so ging es mit stets härter werdendem Frost gegen Weihnachten zu.
Schon war der Bach in allerlei wunderlichen Formen gefroren, kein Laut kam in die weisse Einsamkeit herauf, nur wenn ein Baum die Schneelast abschüttelte oder Krähen um den Schupfen flogen, rührte sich etwas. Beim Tauwetter hatte Anderl die Wintervorräte von Jodok im grossen Rückenkorb heraufgebracht, hatte sich aber nicht nach Malsein hineingetraut, um dort zu sagen, dass der Vater fort sei. Von dort kam niemand zu ihnen, und die Kinder wussten, es würde auch nicht leicht jemand kommen, ausser es musste sie etwas von höchster Wichtigkeit dazu treiben. So waren die Kinder wie gefangen, und die Tage gingen langsam hin. Anderl war nicht böse über die stille Zeit; hatte er seine Arbeit getan, gefüttert, den Stall gerichtet oder Holz gemacht, so schlief er meistens auf der Ofenbank, und es gefiel ihm vorderhand ganz gut so. Juli machte sich daran, nach und nach das Haus zu säubern und zurechtzuflicken.
Die kleine Nann fing schon an zu lachen und nach dem Licht zu greifen, sie versuchte, sich überall aufzurichten und in der Stube umherzukriechen. Wunderlich genug sah sie aus in den Kitteln, die ihr die Schwester zusammenzauberte, wie ein Kind fahrender Leute. Sie ass und schlief tüchtig und machte der Juli wenig Sorgen.
Als der Frost nicht nachliess und ein Tag wie der andre grau und trübselig dahinging, legte sich die grosse Einsamkeit lähmend auf die Kinder, sie wurden mürrisch und wortkarg, doch hatten sie sich schon an vielen stillen Abenden zuvor beraten, sie wollten Weihnachten feiern. Gleich am Abhang beim Haus stand eine kleine Fichte, die schlug Anderl, und nun freuten sie sich Tag für Tag auf den Heiligen Abend. Juli hatte altes Seidenpapier gefunden, dazu ein paar Lichtstümpfchen im Schrank der Mutter; damit putzten sie das Bäumchen, die Juli legte noch Äpfel und Nüsse darunter, die der Hansi im Herbst gebracht und die sie sorgsam gehütet. Als sie die Lichter angezündet hatten, standen sie vor dem Bäumchen und warteten auf die Freude, die nicht kommen wollte, und wurden traurig und trauriger; es kam ihnen vor, als seien sie ganz allein und verlassen auf der Welt und verloren in Schnee und Eis.
„Die Muatter,“ sagte die Juli und sah’s dabei auch dem Anderl an, dass er sich nicht fassen konnte vor Heimweh. Nur die Nann, die noch nichts wusste von Sehnsucht und Verlassenheit, freute sich an den brennenden Lichtern. –
In der Nacht raste, ganz plötzlich erwacht, der Sturm durchs Tal, fegte den Schnee hier weg und blies ihn dort fast haushoch zusammen. Alles war verändert ringsum, man kannte sich am Morgen fast nicht mehr aus, und die Kinder schauten mit grossen, fast furchtsamen Augen auf die neuen Hügel und Täler, die entstanden waren. Später entdeckten sie erst, dass der Brunnen durch den starken Frost eingefroren war, nun hatten sie kein Wasser mehr und wussten, dass eine saure und harte Arbeit ihrer warte, denn jetzt hiess es Schnee holen, viel Schnee, und ihn dann schmelzen, um Wasser für den Haushalt zu bekommen.
Anderl sträubte sich, was er nur konnte, gegen diese Plage; das Liegen auf der Ofenbank und das Rauchen, das er nun angefangen mit alten Pfeifen und altem Tabak vom Vater, gefielen ihm viel besser. Aber sein Widerstand half nicht viel, die Juli war viel zu schwach, die schwere Arbeit allein zu tun, und schalt so lange, bis er sich endlich zur Hilfe entschloss. Aber er war böse auf Juli, dass sie ihn in seiner Musse störte, ganz wie wenn sie Schuld daran trüge, dass der Brunnen eingefroren. „Wirscht a Duifl wie der Voda,“ sagte er, doch die Juli war viel zu müde, um ihm zu antworten. Zu müde vom Arbeiten, zu müde von dem trüben Einerlei der Tage. – Um sechs Uhr krochen sie manchmal schon in ihre Betten. Sie mussten Licht sparen, wer weiss, wie lange sie noch gefangen blieben! Auch am Morgen standen sie nicht zu frühzeitig auf, so hatten sie eine lange, lange Nacht und mussten oft beide wachen. Sie schliefen jetzt alle der Wärme halber in der grossen Stube. Anderl war in den langen dunklen Nächten so furchtsam geworden, dass er schon aufschrie, wenn ein Brett krachte oder ein Scheit im Ofen umfiel. „Juli, es ischt was!“ schrie er in seiner Herzensangst, oder gar: „Juli, a Diab!“, und sie musste den grossen Buben beruhigen wie ein kleines Kind. Sie selbst war sehr gewachsen in der letzten Zeit, sie war fast so gross wie Anderl, aber überall sahen ihr die Knochen heraus, die Kleider schlotterten an ihr herum, und den ganzen Tag war sie müde. Am liebsten wäre sie immerfort sitzengeblieben und hätte immerfort auf die weisse Öde ringsum gestarrt, die tagein, tagaus sich glich, stumm, weit und ohne Erbarmen. Aber sie musste ja mit Anderl Schnee holen, Eis aufhacken, kochen; wenn es nur endlich tauen wollte! –
Endlich, endlich fing es an in grossen Flocken zu schneien, die wie weisse Vögel geflogen kamen; sie freuten sich beide, jetzt gab’s Tauwetter! Und es schneite, schneite, dass sie kaum einen Schritt weit sahen; es schneite am Morgen, am Mittag und am Abend, und wieder am Morgen, am Mittag und am Abend. Als sie ins Bett gingen, war der Schnee so hoch gekommen wie das Fenster. Das beunruhigte besonders die Juli so, dass sie kaum schlafen konnte. Wenn es so weiterschneite, waren sie in ein paar Tagen begraben!
Während der Nacht entstand auf einmal ein furchtbares Getöse – ein langandauerndes Krachen war’s, ein Splittern und ein Poltern –, die Kuh wollte nicht aufhören mit Brüllen, und die Geiss meckerte dazwischen; es war ein beständiges Klirren der Ketten, ein immerwährender Lärm im Stall – die Juli fuhr im grössten Schrecken auf, ihr Herz klopfte so, dass sie nichts andres sonst hörte. Doch der Lärm wiederholte sich nicht, nur die Unruhe im Stall, das Klagen der Tiere dauerte an. Aber die Angst vor etwas Unheimlichem, das da draussen vorgehen mochte, verliess die Juli nicht. Mit einem Satz sprang sie aus dem Bett und verrammelte die Türe mit dem Tisch und mit Stühlen, damit ja nichts zu ihnen dringen könne. Anderl hatte sich in seiner Todesangst vollständig vergraben im Bett, er war nicht einmal dazu zu bewegen, eine Antwort zu geben. Ohne Laut, in stummem Schrecken hielt er sich die ganze Nacht unter den Kissen verborgen.
Die Juli hörte wohl das Stossen gegen den Barren im Stall, hörte das Klagen der erschreckten Tiere, wagte es aber erst aufzustehen, als es hell wurde, und da stand sie mit Zagen auf, es war ihr, als müsse etwas Schreckliches auf sie da draussen warten. Nach vielem Zureden und Betteln und Bitten und Schelten und Zanken gelang es ihr, Anderl auf die Beine zu bringen; er hielt sich immerfort hinter ihr und dazu noch an ihrem Rocke fest, als sie ihn nach dem Stall mitnahm. Zweimal versuchte sie dort die Türe zu öffnen und fand nicht den Mut dazu, das drittemal machte sie gleich herzhaft weit auf.
Was war denn da geschehen?! Das war ja, wie wenn sie ins Freie gingen! –
Oben zum Stalldach schaute der blanke Himmel herein, auf dem Boden lagen grosse Haufen Schnees, Balken und Holzschindeln von dem durch den Schnee eingedrückten Dach durcheinander, das Vieh stand, steif vor Frost, mitten drinnen.
„Jess’s Maria, des aa no!“ schrie sie. Hatte sie es nicht dem Vater gesagt, das Dach sei schlecht, und hatte er es nicht ausbessern sollen? Nun war er im Haus herumgesessen, hatte gefaulenzt und war gegangen, ohne nur einen Nagel da oben einzuschlagen! Und sie begann in Verwünschungen auszubrechen gegen diesen Vater, der sie verhungern und verkommen und elend zugrunde gehen liess, der sie allein da heroben wusste und nicht kam und nicht bei ihnen blieb – es war ihr ganz aus dem Sinn gekommen, dass sie es nicht hatte erwarten können, bis er aus dem Haus ging!
„Jetz hammer’s, jetz hammer’s!“ jammerte sie und lief wie eine Verrückte hin und her mit Schaufel und Körben und schaufelte und schleppte; aber obgleich sie beide mit aller Kraft arbeiteten, sah man gar nicht, wo sie angefangen hatten! Wo sollten sie denn die Kraft hernehmen, den vielen Schnee wieder wegzuschaffen?
In der Stube schrie die Nann, neben ihr begann Anderl zu heulen, vor ihr klagte die Kuh, da fing auch die Juli bitterlich zu weinen an.
„Was tuan mir, Anderl! Was tuan mir?“ jammerte sie.
Da hatte Anderl einen guten Gedanken, einen so guten, dass er viele Jahre lang, wenn er gescholten und für tapsig und blöd erklärt wurde, nie vergass, ihn aufzutischen.
Er nahm die Kuh an der Kette, führte sie stolz über den Gang nach der Küche und holte auch die Ziege nach. Dann zündete er im Herd ein gutes Feuer an und brachte den erfrorenen Tieren Futter. Die Ziege fing gleich, obzwar immer noch mit anklagendem Meckern, zu fressen an, aber die Kuh schnupperte nur so am Futter herum und gab ihr heiseres Brüllen nicht auf.
Auch in der Stube machte Anderl ein grosses Feuer und wärmte Milch für die Nann, denn die Juli war ganz aus der Fassung gebracht, ganz verwirrt, und anstatt wie sonst den Anderl anzutreiben, liess sie nun alles geschehen, was er tat, sie wusste sich keinen Rat mehr.
„Wenn d’ nur nach Malsein geahn kunntscht! Geah nach Malsein, dass sie uns helfen!“
Malsein, Malsein, Malsein! das war ihr ewiges Lied.
„Mir kinnen nit awer, schau decht ausser!“
Aber sie liess nicht nach mit Quälen. Da nahm er denn in Gottes Namen die Schaufel und begann vor dem Haus den Schnee auszuschaufeln. Nein, das waren ja Berge! Er kam keine drei Schritte weit, keine Rede davon, dass er allein nach Malsein käme! Und doch fing sie wieder an:
„Du muscht nach Malsein!“
Sie stiess ihn beiseite und fing selbst an zu schaufeln und zu graben, dass ihr der Schweiss herunterlief, aber auch sie kam nicht vorwärts und schaute sich wieder hilflos nach ihm um.
Mit einem tiefen Seufzer holte Anderl seine dicke Joppe, die Schneereifen und die Steigeisen. Vielleicht ging’s so.
Die Luft war frisch, aber die Berge standen zum Greifen nah, ganz wie wenn Tauwetter zu erwarten wäre. Anderl wollte ja gern vorwärtskommen, wenn er noch so lange brauchen sollte, wenn’s nur überhaupt ging! Schon nach den ersten Schritten aber stolperte er; dann sank er ein, raffte sich wieder auf, kam eine Strecke weiter, sank wieder ein und arbeitete sich wieder heraus. Und der Schnee schien immer weicher zu werden, das Vorwärtskommen wurde immer schwerer, und zuletzt stand er vor einem hohen weissen Hügel, einem fremden Hügel, den er nicht kannte, der sich da aufgetürmt hatte, daneben ging die Wand in die Höhe, und auf der andern Seite fiel der Felshang ab. Keine Möglichkeit, da hinüberzukommen, Anderl machte gar keinen Versuch. Wenn es gegangen wäre, würde er am liebsten heulend zurückgerannt sein. So musste er denselben mühseligen Weg wieder Schritt für Schritt zurücklegen.
Ausser Atem, keuchend, die Kehle von Jammer zugepresst, kam er droben wieder an. Jetzt würde die Juli schön auf ihn losfahren!
Aber die Juli redete kein Wort, blieb nur sitzen und machte grosse Augen; gerade wie der Vater sah sie aus. Sollte denn das den ganzen Tag so fortgehen und wollte sie sich nicht entschliessen, endlich aufzustehen und etwas zu kochen? Er hatte jetzt gearbeitet genug und getan, was er nur tun konnte, der Magen brannte ihm, vorderhand war ihm das Essen die Hauptsache. Sah sie ihm denn das nicht an?
„So koch decht amal a Supp’n!“ mahnte er vorwurfsvoll.
Als er gesättigt war und die Sonne plötzlich schien und alles warm und behaglich machte, fasste er frischen Mut und redete auch der Juli kräftig zu. Vis der Abend kam, hatten sie richtig Schnee und Schindeln ausgeräumt, sogar die schlechten Teile auf dem Dach entfernt und begonnen, neue Bretter einzufügen. Es kam ihnen jetzt recht zustatten, dass sie dem Vater oft zugesehen hatten, und wenn sie’s auch nicht so machen konnten wie er, so ging’s doch leidlich, und das Arbeiten oben in der Sonne war auch nicht so hart, als sie gedacht; doch waren sie beim Dunkelwerden ganz zerschlagen und elend und krochen wie abgehetzte Tiere in die Betten. Sie nahmen sich keine Zeit mehr, sich zu waschen oder zu kämmen, auch die Nann blieb liegen, wie sie war; sie fühlten sich beide am Morgen noch todmüde von der ungewohnten Arbeit und mussten doch gleich wieder beginnen. Wie notwendig das war, sahen sie, als sie in den Stall kamen. Über Nacht war wieder Schnee gefallen, zwar nicht sehr viel, aber doch genug, um die Juli mutlos zu machen.
„Es ischt für niacht, es ischt für niacht,“ klagte sie, während dicke Tränen Rinnen in ihr schmutziges Gesicht zogen. Ihre Augen brannten, und sie sah grau und elend aus; doch ermannte sie sich noch einmal, und nun begann ein wildes Arbeiten: „Es muass, es muass fertig werden bis auf die Nacht.“
Sie war ganz ausser sich, sie hörte nicht, sie sah nichts wie die Arbeit, wie ein Fieber war’s. Ganz nass von Schweiss schaufelte sie den Schnee weg, schleppte Bretter, sägte, hackte, nagelte –
Anderl war ihr nicht schnell genug, sie schalt ihn, sie puffte ihn herum, sie schlug ihn sogar; ordentlich zum Fürchten war sie, gerade wie der Alte, wenn er seinen bösen Tag hatte! Von Ausruhen war keine Rede, nicht einmal essen und trinken wollte sie, und ein Stück Brot, das ihr Anderl brachte, warf sie ihm vor die Füsse. Es fiel ihr gar nicht ein, sich um die Nann zu kümmern, die konnte schreien, so viel sie wollte.
„Hörscht es denn nit, Juli, die Nann? Reahrn tuat sie in oan Trumm fort,“ mahnte Anderl.
„Lass sie reahrn, i kann ihr nit helfen, mir hilft aa koaner.“ –
Die Nacht kam, und die Juli hockte noch oben auf dem Dache und schlug Nägel ein. Anderl stand unten und hielt die Leiter, vor Müdigkeit fielen ihm fast die Augen zu; fast wäre er eingeschlafen, hätte ihm die Schwester nicht auf einmal zugerufen: „Hilf mir, Bua, i kann nit awer.“
Die ganze Leiter herunter musste Anderl sie stützen, ja beinahe tragen, und als sie unten stand, ging sie fast stolpernd vorwärts, sich an den Wänden haltend, als schwanke der Boden unter ihren Füssen. Aber das Dach war fertig, nun war alles gut, nun war alles gleich!
Sie vermochte nichts mehr zu essen, sie war so abgemattet, dass sie sich nur noch ins Bett schleppen konnte und gleich einschlief. Ein schwerer, dumpfer Schlaf kam über sie, der in wirres Träumen überging; sie musste immer weiterarbeiten, ohne Rast und Ruh, immer mit der treibenden Angst, nicht fertig zu werden. Das war ein Wühlen und Graben, ein Wüten und Schaffen! Selbst Anderl mühte sich ab unter Weinen und Ächzen und Stöhnen, jetzt stiess er gar ein Wehgeschrei aus – jetzt wieder! – Das Schluchzen und Rufen dauerte an! – nein, aber das war ja nicht ein Träumen; jemand rief und weinte wirklich! Nicht da war’s, in der Stube, draussen auf dem Gang oder in der Küche musste es sein! Noch in ihren verwirrten Träumen, fand sie sich nicht gleich zurecht; war das wirklich Anderls Stimme, die nach ihr rief? Was war denn?
Gleich fiel’s ihr auf die Seele, sie hatte ja der Nann gestern nichts zu essen gegeben! – „Die Nann?“ schrie sie in Todesangst.
„Na, die Kuh!“ heulte Anderl. Richtig, da stand ja die Wiege mit der Nann, und die schluckte an ihrem Fläschlein und schaute fröhlich und vollständig mit dem Schicksal ausgesöhnt aus ihren blaugrauen grossen Augen nach der Juli.
Wie lange die brauchte, bis sie nur ihre Kleider fand! Und sobald sie in der Höhe war, kam immer wieder dies Schwindelgefühl, dies Sausen und Klopfen, das sie schon am Abend gespürt, die Zunge lag ihr wie geschwollen im Munde; wenn sie ging, drehte sich alles um sie, am Ende wurde sie gar krank? Ganz sachte, ganz vorsichtig, ganz unsicher kam sie in die Küche geschlichen, gerade als die Kuh die Augen verdrehte und sich streckte. Aus war’s, sie war tot. Die Juli konnte keinen Schmerz empfinden, sie wunderte sich nicht einmal darüber, dass sie nicht verzweifelte, nicht schrie und betete wie Anderl, der ausser sich war.
„Mir derhungern, mir müass’n derhungern,“ weinte er, und gleich darauf wieder: „Heilige Maria Mutter Gottes, wenn ma decht ’s Fleisch essen kannten! – Der Voda derschlagt uns ja! Bitt für uns arme Sünder – moanscht nit, Juli, mir kannten’s essen? – jetzt und in der Stunde unsers Absterbens! Amen!“
Das war ein Jammer, dass es einen Stein hätte erbarmen mögen, einen grösseren Schmerz hatte Anderl noch nie durchgemacht! Und kein Wort fand die Juli, ihn zu trösten, sie ging einfach wieder zurück und legte sich auf die Ofenbank und liess ihn ratlos und allein in der Küche!
*
Gegen Mittag begann der warme Föhn zu wehen, eine matte Sonne kam hinter dem Gewölke vor, verschwand und erschien aufs neue; die Farbe der Berge ging vom Weiss ins Bleigrau über, die Eiszapfen am Haus fingen an zu tauen; auch der Brunnen rann wieder und der Schnee ringsum krachte und knisterte geheimnisvoll; später begann ein Knacken und Rieseln ringsumher, vor dem Hause standen grosse Lachen, denn die Dachtraufe spie unaufhörlich das Schneewasser aus, kleine Rinnsale kamen von den Hügeln herunter, und mit leisem Schauern fiel der Schnee von den Bäumen. Nun wurde die Ferne dunkelblau und violett, die Berge mit ihren Zacken und Graten waren ganz vors Haus gerückt, es war, wie wenn der Frühling kommen wollte.
Doch der Föhn wurde immer lauter, Wolkenfetzen flohen über die blasse Sonne, es sang und heulte im Kamin, und der Rauch drang aus allen Ritzen des Ofens, wenn ihn der Sturm niederdrückte. Die Juli sah und hörte nichts von allem, teilnahmslos kauerte sie am Ofen mit halbgeschlossenen Augen, während Anderl scheu um sie herumstrich. Sie nahm die Brotsuppe nicht, die er brachte, sie hörte nicht, was er sagte, sie gab keine Antwort, wenn er jammerte und fragte.
Was soll denn werden um aller Heiligen willen?
„So sag was, sag was, hörscht denn nit?“ redete er auf die Schwester ein, und weil sie hartnäckig schwieg, geriet er, der sich sonst nicht rührte, vor Angst und Schrecken ganz wild gemacht, ausser sich. Er riss Juli in die Höhe, er versuchte sie auf die Füsse zu stellen und schüttelte sie, doch sank sie ihm unter den Händen zu Boden. Und welche Mühe das dem erschrockenen Buben machte, sie auf die Bank hinaufzulegen, denn weiter brachte er sie nicht, mit welcher Angst er nach ihr schaute, wie er hin und her lief, bis er ein Kissen und eine Decke für sie fand und sie gebettet hatte!
Da lag sie nun am warmen Ofen und zitterte vor Frost, hatte die Augen geschlossen und rührte sich nicht mehr.
Er betete und weinte leise und betete und weinte laut, es blieb dasselbe. –
Die Geiss hatte er nun in den neuen Stall geführt und sie schon gemolken, vielleicht trank Juli die Milch?
Aber die Kranke nahm nur in grossen, gierigen Schlucken das Wasser, das er ihr reichte, und versank wieder in ihre Teilnahmslosigkeit.
In der Stube hörte man nichts wie das Jauchzen oder Krähen Nanns, die ganz zufrieden mit den Hobelspänen spielte, die Anderl beim Feueranmachen verstreut hatte.
In der letzten Zeit hatten die Kinder ganz vergessen, die Uhr aufzuziehen. Anderl wusste nicht mehr, welche Zeit am Tage es war; doch begann er jetzt nachzuzählen und brachte heraus, dass dies der letzte Tag des Jahres sein musste.
So ging also das neue gut an! Was sollte denn aus ihnen werden, wenn die Juli auch noch krank wurde und keiner kam, nach ihnen zu sehen? Was blieb denn da übrig, wie zu versuchen, nach Malsein hinunterzukommen?
Er trat vor die Haustüre, aber der Schneehügel versperrte ihm die Aussicht, nicht einmal den Rauch von Malsein konnte man sehen, nichts wie das weite, weite Weiss und das stille Rieseln und Rauschen war ringsum, ein leises Knacken, ein Zerstäuben, emporschnellende Äste, wenn ein Wind kam – sonst nichts.
Aber da wachte plötzlich irgendwo ein dumpfer, fast verhaltener Ton auf, der stärker und stärker wurde und näher und näher kam, zuletzt in ein Sausen überging –
Anderl sah erschreckt nach der Wand über dem Hause – dort hatte sich’s losgelöst, von dort kam’s auf ihn zu – er rannte wie besessen hinein: „A Lahn kimmt!“
Da brach es schon mit dumpfem Getöse herein. Einen Augenblick wurde es dunkel vor den Fenstern, Steine, die die Lawine mitführte, schlugen krachend gegen die Türe – ein Sausen und Tosen und Splittern – dann stürzte der weisse Koloss ins Tal, sie waren verschont geblieben! Zitternd und fast ohne Besinnung, den Kopf in den Händen vergraben, blieb Anderl noch lange Zeit knien, ehe er es wagte, aufzustehen.
An den Fenstern lief wässeriger Schnee herunter, ganz so wie im Frühjahr, wenn der Tauwind Regen und Schnee an die Scheiben warf; nach und nach erst getraute sich Anderl, hinauszusehen. Der Gartenzaun war weg und eine Ecke des Schupfens; weit über das Haus hinaus sah man die breite Bahn, die die Lawine genommen, und wie sie alles reingefegt hatte, sogar der Schneehügel war verschwunden. Jetzt konnte er gewiss nach Malsein hinunter! Er lief hin und her, von einer grossen Unruhe getrieben.
Er kam ganz gut bis an den Platz, wo der grosse Schneehügel gelegen, aber dahinter sank er gleich wieder ein, und droben fing’s aufs neue an, ein Rutschen, ein sausendes Geräusch – an einer andern Stelle löste sich wieder ein Schneeklumpen los und stürzte, sich stetig vergrössernd, mit unglaublicher Schnelligkeit über die Matten herunter.
Nein, nein, er wagte es nicht, er getraute sich nicht hinunter, nun war man erst recht seines Lebens nicht sicher!
Was sollte er denn nun tun? – Wie konnte man helfen? – Anderl wusste sich keinen Rat; er hockte am Tisch, die Ellbogen aufgestützt, den Kopf darauf gelegt, und Viertelstunde um Viertelstunde verrann.
Das Wasser draussen rieselte, die Bäume ächzten, der Föhn stöhnte, und plötzlich war die Dunkelheit da, alles Licht war wie auf einen Schlag ausgelöscht, nur der Schnee glänzte durchs Fenster. Jetzt musste er freilich aufstehen, Licht machen, Feuer anzünden, die Nann versorgen, füttern und kochen, so viel, so viel musste er tun! Lange rutschte er auf der Bank umher, ehe er sich endlich zum Aufstehen entschloss, aber die Küche mied er, dort hinein wäre er um keinen Preis der Welt gegangen! Er fürchtete sich vor der toten Kuh; er fürchtete sich überhaupt vor allem: vor den langen Schatten an den Wänden, die so plötzlich auf ihn zukamen oder sich aus den Ecken ganz unerwartet in die Höhe schnellten, vor dem Heulen im Kamin und dem Klappern der Läden, an denen der Sturm rüttelte, und nicht am wenigsten fürchtete er sich vor der Juli, die mit rotem Kopf und glänzenden Augen dalag und immerfort vor sich hinplapperte, wirres, unverständliches Zeug, oder mit den Armen um sich schlug und aufschrie. Sie tat ihm am Ende noch was! Mit schlotternden Knien ging er herum, den Buckel gekrümmter denn je, und mehr denn je einem verscheuchten Kater ähnlich. In weitem Bogen ging er um die Juli herum, und als er am Tische sass, um zu essen, sah er fortwährend von der Seite nach ihr – ach Gott, es schmeckte ihm auch kein Essen mehr!
Dicke Tränen kamen ihm, immer mehr, bis er vor seinem Schüsslein Milchsuppe unaufhörlich schluchzte. Und vom Weinen kam er ins Beten und vom Beten wieder ins Weinen – und plötzlich hatte er einen Gedanken. Den hatte ihm Gott eingegeben, weil er gar so fleissig gebetet hatte!
Alle Furcht vor den langen schwankenden Schatten war verschwunden, er sah sie gar nicht und dachte nur an das, was ihm soeben eingefallen war.
So schnell er nur konnte, lief er hinters Haus, suchte im Schuppen Schaufel und Besen und erklomm im Dunkel den Hügel hinter dem Haus, den ihm die Lahn schön rein und glatt gefegt hatte. Droben brauchte er gar nicht viel Arbeit mit Schaufel und Besen, gleich lag der Rasen frei, so schön war aller Schnee weggewischt. Dann trug er Hobelspäne und Scheiter und Stücke Holzes herbei, schichtete einen Vorrat von Holz daneben auf – keine kleine Mühe, denn er musste immerfort den Hügel auf und ab, und er war hoch gestiegen! – und nun entzündete er das Ganze. Hui, wie da der Wind hineinfuhr! Wie die kleine gelbrote Flamme züngelte! Das knisterte und krachte, ein dicker, graugelber Qualm stieg auf, drückte sich gleich wieder nieder, die Scheiter glimmten nur mehr, dann erloschen sie – das Feuer war aus. Und wieder zündete Anderl den Holzstoss an, trug neue, leichtere Hölzer herbei, beim drittenmal erst brannte er endlich, und zwar mächtig. Von dieser Stelle aus musste man es drunten sehen, und sie mussten ihm zu Hilfe kommen!
Hoch loderte die Flamme auf, duckte sich, stieg pfeilgerade in die Höhe, wehte wie eine glühende Fahne nach rechts, schoss wieder knisternd empor, leichter Rauch zerstob über ihr, während von unten dicker grauer Brodem nachdrang, denn immer mehr Holz trug Anderl her. Er sah zu, wie die kleinen Flämmchen aus den Scheitern krochen, wie sie an ihnen herumleckten, dann sich zurückzogen, im Versteck sassen und lauerten, plötzlich wieder glühend rot und spitz wurden und drohend ins Dunkel herausschossen. –
Stunde um Stunde sass er da. Er wusste nicht, wie spät es war und ob noch Hilfe kommen konnte. Seine Hosen waren durchnässt vom Knien in dem wässerigen Schnee, seine Schuhe durchweicht, während die Glut ihm schier Gesicht und Hände versengte. Zuletzt überkam ihn eine grosse Schläfrigkeit, und während die Flamme neben ihm noch immerfort hoch gegen den Himmel brannte, fing er an einzuschlafen.
So wollte ihnen also niemand Hilfe bringen? Dann mussten sie eben elend verderben, da heroben in ihrer Einöde. – –
Der Holzstoss brannte nieder; die glimmenden Scheite sprachen ihre eigne, geheimnisvolle, wispernde Sprache – ein Krachen, Erlöschen, ein Wiedererwachen, ein langer glühender, knisternder Streifen, ein Stückchen Glut, das absprang – es hatte Anderl an der Hand getroffen, verstört wachte er von dem Schmerz auf.
Über ihm stand der Himmel voller Sterne, das Firmament war wie dunkler Samt, ohne Mond, der Wind hatte sich gelegt, es sah aus, als habe sich das Tal gedehnt, so weit, so gross erschien es und so hoch und weit auch der Himmel.
Da krachte ein Schuss durch die Nacht, und die Felswände wiederholten ihn rollend; jetzt noch einer, schwächer und entfernter.
Kam nun endlich Hilfe? – Der Bub sprang auf. Kommen sie schon mit Laternen? Er bog sich weit vor, um die kleinen hellen Punkte zu sehen – nichts. Waren es die Malseiner? – Ringsum Dunkel und Stille. Aber da krachte wieder ein Schuss, und nun folgten sie sich knatternd und krachend, an den Felswänden hinrollend, sich förmlich suchend und fangend, um allmählich zu ersterben; und nun hörte Anderl auch Glocken, ganz schwach nur konnte er sie hören, was war das? –
Neujahr! Sie läuteten das Neujahr ein, sie schossen, weil Neujahr war! – Oh, alle hatten sie sie vergessen, keiner dachte mehr an die Kinder droben; sie wollten nicht kommen. Wein trinken und prassen war ihnen lieber als da heraufsteigen in Mühseligkeit!
Mochten die sterben und verderben, es fragte ja doch keiner nach ihnen, es waren ja nur die Kuchlerischen! –
Anderl schlich ins Haus zurück; es kam ihm gar nicht in den Sinn ins Bett zu gehen; auf den blanken Fussboden legte er sich, dicht neben die Juli, und schlief auf den harten Brettern ein.