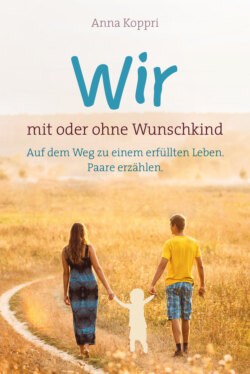Читать книгу Wir - mit oder ohne Wunschkind - Anna Koppri - Страница 8
Conni und Daniel
Wir haben uns für medizinische Hilfe entschieden
ОглавлениеConni und Daniel kenne ich von einem christlichen Gemeinschaftsprojekt, das sie leiten. Beide sind Ende dreißig, sehr besonnen, ruhig, reflektiert, im Glauben weitsichtig und anderen Menschen gegenüber zugewandt. Ihre Geschichte erzählen sie mir mitten in einer brisanten Phase ihres Kinderwunsches.
Weg zu zweit
Schon mit Mitte zwanzig setzt Conni sich trotz eines starken Wunsches nach Partnerschaft und Familie mit einer Zukunft als Single auseinander. Gerade als sie Frieden über beide möglichen Wege findet, taucht Daniel auf. Für die beiden besteht von Anfang an kein Zweifel, dass Gott sie zusammengeführt hat, was sie nach eineinhalb Beziehungsjahren vor dem Traualtar bestätigen. Auch Kinder wünschen sich die frisch Vermählten.
Conni: „Ich wollte immer vier Kinder haben. Durch meine zehn Jahre jüngere Schwester war ich schon früh mit in der Mutterrolle drin. Daniel war mit 14 Jahren bereits Patenonkel und hatte auch immer schon einen super Draht zu Kindern.“
Nach einem Jahr Zweisamkeit in der Ehe beschließen sie 2011, nicht mehr zu verhüten. Conni ist Anfang dreißig. Dass es vielleicht keine vier Kinder mehr werden könnten, ist ihnen bewusst. Zuerst einmal gehen sie ganz entspannt an die Sache heran. Der steinige Weg, der vor ihnen liegt, ist noch verborgen, sodass sie sich auch nach mehreren Monaten vergeblicher Bemühungen keine großen Gedanken machen.
Tagebuch Conni, Oktober 2011
„Gott, ich möchte darauf vertrauen, dass du den Wunsch nach Kindern und Familie in mich gelegt hast, damit er sich irgendwann erfüllt. Wie und wann genau, das weißt nur du. Schenke mir das Vertrauen, dass du auch in dieser Frage einen guten Plan für uns hast.“
* * *
Erst als ihre Gynäkologin ihr nach einigen weiteren Monaten dazu rät, lässt Conni sich medizinisch durchchecken, mit dem Ergebnis, dass einer Schwangerschaft ihrerseits nichts im Wege steht. Auch weiterhin gelingt es Conni und Daniel, ohne viel Druck ihren Kinderwunsch zu verfolgen.
Tagebuch Conni, Oktober 2012
Ich hab so viel Lust auf was Neues! So gerne hätte ich jetzt auch Kinder, eine eigene Familie. Ich glaube, Daniel und ich hätten auch so viel Spaß daran, mit unseren Kindern unterwegs zu sein, ihnen die Welt zu erklären oder uns unsere Welt von ihnen in Frage stellen zu lassen. Ich bin so gespannt darauf, was Gott mit uns vor hat, wann/ob/wie er uns ein Kind/Kinder schenken wird.
Eigentlich will ich mir darüber keine Sorgen (mehr) machen. Trotzdem kriege ich manchmal Angst, dass wir ohne Kinder bleiben könnten.
Ich bekomme Angst, dass diese Vorstellung, dieser Lebensplan „irgendwann mal selbst Kinder zu haben“ zerstört werden könnte. Ich will weiter daran glauben, dass ich „ganz normal“ Kinder kriegen kann. Gleichzeitig will ich auch darauf eingestellt sein beziehungsweise damit Frieden haben, dass wir eventuell keine Kinder bekommen können. Aber mit dieser Ungewissheit zu leben, das finde ich im Moment total schwer …
* * *
Zwei Jahre nach Beginn ihres aktiven Kinderwunsches steht erst einmal ein Umzug nach Berlin an. Voll und ganz stürzen sie sich in den Aufbau eines Gemeinschaftsprojektes für eine kirchliche Organisation. Ihr erstes gemeinsames Baby, ein Stück Berufung, nimmt Gestalt an. Menschen aus der Nachbarschaft mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen können sich hier begegnen, austauschen und Gemeinschaft leben. Conni und Daniel werden Gastgeber, bieten anderen Heimat in der Großstadt. Für Einzelne, die sich Halt und familiäre Gemeinschaft wünschen, nehmen sie sogar so etwas wie eine Elternrolle ein.
Endlich Klarheit
Erst als sich ihr neues Leben nach einem Jahr langsam eingespielt hat, wenden sie sich wieder aktiv ihrem Kinderwunsch zu. Nun ist Daniel an der Reihe sich untersuchen zu lassen. Er fährt schon mit einer Vorahnung zum Urologen, denn irgendeine Ursache muss das nun schon dreijährige Ausbleiben einer Schwangerschaft ja haben.
Als das Spermiogramm vorliegt, ist er dennoch etwas überwältigt ob der Eindeutigkeit des Ergebnisses: „Wo normalerweise ein paar Millionen Spermien sind, gibt es bei mir vielleicht fünf.“ Der Arzt erklärt ohne Umschweife, dass rein medizinisch eine Zeugungsunfähigkeit vorliegt und sie nur mithilfe der Reproduktionsmedizin durch eine ICSI (Intracytoplasmic sperm injection) eine Chance haben werden, eigene Kinder zu bekommen.
Bei dieser Methode werden der Frau operativ reife Eizellen entnommen, die vorher durch Hormongaben stimuliert wurden, damit in sie der aufbereitete Samen des Mannes direkt eingespritzt werden kann. Wenn anschließend eine Befruchtung stattfindet und sich die Zellen erfolgreich teilen, werden der Frau nach drei bis fünf Tagen ein bis zwei Embryonen in die Gebärmutter eingesetzt – im Ausnahmefall auch drei. Einerseits ist die Diagnose ernüchternd und niederschmetternd, andererseits gibt es dadurch endlich Klarheit, die dem Paar auch guttut.
Tagebuch Conni, September 2014
Wer weiß, was Gott jetzt mit mir/mit uns als Paar vorhat? Wo ich immer ganz stark das Gefühl hatte, dass gerade von uns als Paar ganz viel Gutes ausgeht. Wenn es jetzt tatsächlich der Fall sein sollte, dass aus unserer Ehe keine Kinder hervorgehen werden – was ist dann unsere Berufung?
Bis jetzt haben wir uns noch gar nicht wirklich Gedanken dazu gemacht, geschweige denn Gefühle zugelassen.
Ich verstehe nicht, warum Gott uns dann so ein großes Herz für Kinder gegeben hat, so viele positive Begegnungen: „Unsere Kinder fühlen sich bei euch so wohl, sie mögen euch so gerne“ – so oft hören wir das. Ich verstehe nicht, warum er uns als „Familienmenschen“ hat aufwachsen lassen und so viel Familiengefühl mitgegeben hat, ja sogar eine so große ähnliche Prägung, sodass wir in der Kindererziehung nicht viel diskutieren müssten.
Vielleicht wäre es auch unsere Berufung, Kinder zu adoptieren. Damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt …
„Ungewollt kinderlos“ – ich fände es so krass, plötzlich in diese Schublade gepresst zu werden. Dieses ganze „Kinderkrieg-Thema“ ist mir sowieso schon seit längerem „suspekt“. Es wird überall so getan, als hätten wir das vollkommen selbst in der Hand. Anfangs mittels Verhütung, dann mittels Planung. Mit allen Mitteln „krampfhaft“ ein Kind „haben“ zu wollen, kommt mir unangemessen und egoistisch vor. Man kann doch kein Kind „haben“/„besitzen“, man muss es doch geschenkt bekommen. Jeder Tag mit dem/unserem Kind wäre doch ein reines Geschenk.
Ich bleibe bei meiner Einstellung: Wenn Gott uns ein oder sogar mehrere Kinder schenken will, wenn er uns beide ihm/ihnen als Eltern schenken möchte, dann kann er das tun, und dann will ich ihn auch nicht daran hindern beziehungsweise nicht das, was von unserer Seite dazu beitragen könnte, unterlassen.
Aber ich will auch nicht krampfhaft daran festhalten, sondern fest glauben, dass Gott uns dann auch die Kraft geben wird, diese „Neuausrichtung“ unseres Lebens durchzustehen – mit allen Konsequenzen – und dass er uns anderweitig überreich beschenken und zum Geschenk werden lässt für andere Personen, Situationen …
* * *
Die Kinderwunschklinik, in der sie einige Zeit später landen, fühlt sich ein bisschen wie eine Parallelwelt aus einer amerikanischen Serie an. Alles ist super schick, es gibt riesige Aquarien und überall sitzen gut gekleidete Paare in den Wartebereichen. Ob sie hier richtig sind? Ihre anfänglichen Bedenken werden jedoch schnell von einer sehr zugewandten, offenen Ärztin zerstreut, bei der sich die beiden auf Anhieb wohlfühlen. Sie erklärt alles sehr genau und begegnet ihnen auf Augenhöhe.
Schon vor diesem Termin in der Klinik hat das Paar vereinbart, den ganzen Prozess langsam anzugehen, sich gut zu informieren und zu schauen, wie sich jeder Schritt anfühlt, bevor sie weitergehen. Sie wollen sich immer nur mit der nächsten zu treffenden Entscheidung auseinandersetzen. Weder wollen sie sich schon mit einem möglichen übernächsten Schritt belasten noch von vornherein Grenzen festlegen. Auch nehmen sie sich vor, nicht wild im Internet zu recherchieren oder tausend Geschichten anderer zu hören. Sie wollen sich vor allem von den Ärzten aufklären lassen und auf ihr Bauchgefühl hören, um ihren eigenen Weg zu finden.
Die christliche Perspektive auf künstliche Befruchtung
Wieder zu Hause angekommen sucht Daniel die Unterlagen seiner Ethikvorlesung aus dem Theologiestudium raus, in der darüber gesprochen wurde, dass die künstliche Befruchtung aus christlicher Perspektive umstritten ist. Da in der Regel mehr Eizellen befruchtet als letztlich in die Gebärmutter eingesetzt werden, müssen mitunter im Prozess Embryonen verworfen oder eingefroren werden. Bedeutet das, dass diejenigen, die sich für diese Methode entscheiden, vorsätzlich Menschenleben töten? – fragt er sich. Während ihres Entscheidungsprozesses stoßen die beiden auf die Tatsache, dass auch auf dem natürlichen Empfängnisweg immer wieder Eizellen befruchtet werden, sich einzunisten beginnen und doch vorzeitig wieder absterben. Zu diesem frühen Zeitpunkt wird das von den Frauen meist gar nicht bemerkt.
Während sie weiter überlegen, besuchen die beiden eine Paarberatung und lassen sich auch individuell geistlich begleiten, was ihnen für ihren Kinderwunschweg sehr guttut. Auch ihre Eltern und gute Freunde lassen sie an ihrem Weg teilhaben. Beide Elternpaare haben noch keine Enkel und werden darauf mindestens genauso oft angesprochen wie das Paar auf seinen ausbleibenden Nachwuchs.
Für sich persönlich ziehen Conni und Daniel schließlich den Schluss, dass ihnen offensichtlich auf natürlichem Weg eine Schwangerschaft verwehrt bleibt und die künstliche Befruchtung somit der einzige Weg ist, wie Gott ihnen ein Kind schenken kann. Die Medizin stellt hierbei für sie eine Möglichkeit dar, die Gott dem Menschen gibt. Für Daniel ist ein wichtiger Punkt, dass es auch bei künstlicher Befruchtung keine Garantie auf ein Kind gibt: „Es würde mir schwerer fallen mich darauf einzulassen, wenn es eine 100-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit gäbe. Ich will nicht selbst über Leben verfügen können, sondern die Entscheidung letztlich in Gottes Hand lassen.“ Das Paar ist aber weiterhin noch genauso offen für Wege ohne eigene Kinder, die Gott sie führen könnte.
Die Ärzte rechnen ihnen eine ganz normale durchschnittliche Schwangerschaftswahrscheinlichkeit von 33 Prozent pro Versuch aus. Dadurch, dass einige Schwangerschaften sich nicht weiterentwickeln, bleibt letztlich die Chance von zirka 25 Prozent pro Versuch, dass sie ein Kind bekommen werden. Da beide eher nüchtern an die Sache herangehen und sich vor Enttäuschung schützen wollen, nehmen sie an, dass sie durch die drei Versuche, auf die sie sich einlassen wollen, im wahrscheinlicheren Fall kein Kind bekommen werden.
Ganz bewusst setzen sie sich auch mit der Frage auseinander, wie ihr Leben ohne Kinder aussehen würde und malen sich ein solches sehr positiv aus: ausschlafen, flexibel sein, Freiraum für eigene Projekte haben, reisen und ihre Gabe der Elternschaft für andere Menschen leben. Immer wieder begegnen ihnen auch andere Paare, denen keine Kinder geschenkt wurden, mit denen sie sich austauschen.
Daniel wird von den Ärzten geraten, sich operativ Samen aus den Nebenhoden entnehmen zu lassen, da es erfolgsversprechender sei, dort zeugungsfähige Spermien zu finden. Im April 2015 bekommt er schließlich einen Termin für diesen operativen Eingriff beim einzigen darauf spezialisierten Arzt der Stadt. Die OP findet unter Vollnarkose statt und bereitet Daniel auch noch Tage danach Schmerzen. Dadurch haben beide das Gefühl, dass auch Daniel seinen Teil an der Behandlung trägt und nicht Conni alle Eingriffe allein an ihrem Körper vornehmen lassen muss. Das schafft einen gewissen Ausgleich.
Die Samen werden eingefroren, für Transport und Lagerkosten müssen sie zum Großteil selbst aufkommen. Schon vor Beginn der Behandlungen hat das Paar zu einer Krankenkasse gewechselt, die sich nicht nur zu 50 Prozent, sondern zu 100 Prozent an den Kassenleistungen der ersten drei Befruchtungsversuche beteiligt. So entsteht für sie noch ein Eigenanteil von rund 1.000 Euro pro Versuch.
Erster Versuch
Leider verlässt ihre Ärztin noch vor Behandlungsbeginn die Kinderwunschklinik, um sich selbstständig zu machen. Bei ihren Nachfolgerinnen fühlen sich die beiden fachlich auch gut aufgehoben, doch wenn Conni ehrlich ist, merkt sie, dass sie sich bei ihnen nicht ganz so gut fallen lassen kann und weniger auf Augenhöhe behandelt fühlt. Trotzdem entscheiden sich die beiden, in der Klinik zu bleiben, weil sie dort schon so viele vorbereitende Schritte und Gespräche durchlaufen haben. Da für sie Daniels OP erst einmal den unangenehmsten Schritt darstellte, haben sie sich wenig Gedanken über mögliche Nebenwirkungen der Behandlungen und Hormoneinnahmen für Conni gemacht.
Im Frühsommer 2015 steht schließlich der erste Behandlungszyklus an. Mit leichter Anspannung und einer Tüte voll Medikamente machen sie sich auf den Weg zu einem Eheseminar, das zufällig im selben Zeitraum stattfindet. Just setzt Connis Periode direkt am ersten Seminartag ein, sodass sich das Paar abends ganz aufgeregt und auch ein bisschen feierlich in sein Zimmer zurückzieht, um die erste Hormongabe zur Stimulation der Follikelbildung zu spritzen.
Da sie so mit diesem ersten Versuch beschäftigt sind, können sie sich anfangs schwer auf das Seminar und die Gruppe einlassen. Zu allem Überfluss fällt Conni am nächsten Tag siedend heiß ein, dass sie nicht am ersten, sondern erst am zweiten Tag ihres Zykluses die erste Spritze hätte setzen sollen. Natürlich ist gerade Wochenende und in der Klinik ist niemand da.
Sie erreicht schließlich ganz verunsichert eine alte Schulfreundin, die Gynäkologin ist, und die ihr zusichert, dass der Tag früher kein Problem sein sollte. Trotzdem macht Conni sich psychisch großen Druck, dass der ganze Behandlungserfolg davon abhängt, ob sie alles richtig macht. Sie hat unterschätzt, wie sehr sie gedanklich mit dem Thema beschäftigt sein würde, und nimmt sich vor, für einen weiteren Versuch einen Zeitraum zu wählen, in dem sie parallel keine anderen Pläne haben.
Nach zehn Tagen Hormonspritzen, die Conni super verträgt, findet unter Vollnarkose die Eizellenentnahme statt. Sie ist zwar ein wenig aufgeregt, empfindet jedoch auch diesen Eingriff nicht als besonders belastend und ist froh, dass genug Zellen herangereift sind. Hinterher spürt sie nur ein leichtes Ziehen im Unterleib und hat ansonsten keine nennenswerten Beschwerden.
Nun sind sie gespannt, ob sich genug agile Spermien für die Befruchtung finden lassen. Ironischerweise ist die Qualität der frischen Spermien, die Daniel zusätzlich abgibt, besser, als die der eingefrorenen. Die Ärzte sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen, sodass sich die beiden wenige Tage später erneut in der Klinik einfinden, um Conni die herangereiften Embryonen einsetzen zu lassen. Es tut dem Paar gut, fast jeden Termin gemeinsam wahrzunehmen, auch wenn Conni meist diejenige ist, die behandelt wird.
Die beiden sitzen im OP-Raum und erleben per Liveübertragung auf einem Bildschirm, wie im Labor eine befruchtete Eizelle mit einer Pipette aufgesaugt wird. Die Zellen haben sich bereits ein paar Mal geteilt. Begleitet wird der Prozess durch die Ansage der Biologin, dass dies „der Achtzeller von Herrn und Frau S.*“ sei, was dem Paar eine Gänsehaut beschert. Das ist der Embryo, der sich vielleicht in ihrer Gebärmutter einnisten und zu dem erwünschten Kind heranwachsen wird.
Durch ein Türchen wird die Pipette aus dem Labor gereicht und dann wiederholt sich der Prozess, denn es haben sich ganz eindeutig nur zwei der befruchteten Eizellen so weit geteilt, dass sie in die Gebärmutter eingesetzt werden können. Dadurch müssen die beiden keine weiteren Embryonen verwerfen oder sich zwischen mehreren entscheiden.
Nach dem Einsetzen fahren sie nach Hause, zum ersten Mal mit dem feierlichen Gefühl, dass nun ein Kind in Conni entstehen könnte, vielleicht sogar Zwillinge. Sie erleben, wie lang zwei Wochen sich anfühlen können und werden schon vor dem Bluttest in der Klinik damit konfrontiert, dass Connis Periode einsetzt. Die Hoffnung auf eine Schwangerschaft schrumpft auf einen winzigen letzten Rest zusammen. Ihnen wurde gesagt, dass eine Blutung nicht unbedingt bedeuten muss, dass keine Schwangerschaft vorliegt. Doch der Bluttest nimmt schließlich den letzten Funken Hoffnung.
Besonders schwer ist in diesen Tagen für die beiden zu verarbeiten, dass die Frau von Daniels Bruder genau zu diesem Zeitpunkt verkündet, dass sie schwanger sei. Vorher war es für das Paar, trotz des eigenen unerfüllten Kinderwunsches, immer einfach, sich mit befreundeten Paaren und Verwandten über deren Schwangerschaften zu freuen, doch diesmal haben sie daran zu knabbern.
Ein weiterer Versuch, der schon zwei Monate später stattfindet, wird vorzeitig abgebrochen, da nicht ausreichend Eizellen herangereift sind.
Ein dritter Versuch im November, der jedoch erst der zweite kassenfinanzierte ist, verläuft ähnlich wie der erste, nur dass Conni sich durch eine abgewandelte Behandlungsform mit wesentlich längerem Vorlauf sehr in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlt.
Kurz nach dieser weiteren Enttäuschung beginnt sie einen neuen Job in der Arbeit mit Geflüchteten und möchte sich in der Probezeit erst einmal darauf konzentrieren. Da für beide noch immer feststeht, dass der folgende Versuch ihr letzter sein wird, entscheiden sie, sich für diesen besonders viel Zeit zu lassen. Außerdem hört Conni schließlich auf ihr Gefühl, und die beiden wechseln in die mittlerweile neu aufgebaute Klinik ihrer ersten Ärztin, bei der sie sich prompt wieder sehr wohlfühlen.
Elternschaft auf eine andere Weise leben?
2015 ist das Jahr, in dem die Flüchtlingsströme nach Deutschland kommen. Einige Geflüchtete docken in dem Gemeinschaftsprojekt von Conni und Daniel an, das dadurch ganz neu belebt wird. Das Paar nimmt in gewisser Weise eine Elternrolle für viele von ihnen ein und fragt sich, ob ihnen vielleicht eigene Kinder verwehrt bleiben, damit sie auf diese Weise Elternschaft leben können.
Anfangs noch mit Händen und Füßen und wenigen englischen Worten fragen die Neuankömmlinge immer wieder, warum die beiden keine Kinder haben. Das Paar versucht deutlich zu machen, dass ihnen bisher keine Kinder geschenkt wurden, verweisen mit dem Finger gen Himmel und öffnen ihre Arme. Die Geflüchteten reagieren sehr rührend und liebevoll und beteuern, mit ihnen für ein Kind zu beten. Die meisten von ihnen sind Muslime. Auch Conni und Daniel beginnen Gott immer intensiver in ihren Kinderwunsch einzubeziehen und bitten Freunde und Verwandte um Gebet. Dadurch fühlen sie sich geistlich getragen.
Conni: „Ich habe mich auch immer mehr mit dem Thema Meditation beschäftigt und eine kontemplative Haltung eingenommen, wodurch alles ein bisschen mehr integriert und ein gemeinsamer Prozess mit Gott wurde: Wir sind offen und Gott wirkt.“
Auf Anraten ihrer Paarberaterin wollen die beiden sich vor ihrem nächsten Versuch nicht möglichst nüchtern vor einer Enttäuschung schützen, sondern malen sich ganz bewusst ein Leben zu dritt aus. Sie einigen sich sogar schon auf einen Jungen- und einen Mädchennamen für ihr Wunschkind.
Tagebuch Conni, Juni 2016 im Türkeiurlaub
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Genau das ist rückblickend die Erfahrung und Entwicklung der letzten zweieinhalb Jahre. „Leben in Fülle, gute Pläne, Pläne des Heils.“ Gerade die letzten Monate waren so wichtig für die „Ausweitung“, für das „Ausgießen“ in Fülle, für die Intensivierung der Kontakte und Vergrößerung unseres Beziehungsnetzwerks und für das Ausleben unserer Berufung. Es wäre so schön, wenn sich die vielen Leute mit uns über ein Kind freuen – und über Gott staunen könnten.
Gott, Schöpfer, Quelle und Liebe, dir ist das möglich! Ich weiß nicht, ob es tatsächlich „dran“ ist für uns. Es fühlt sich jetzt so an, so stimmig.
Ich merke, ich bin weiterhin wirklich für beide Varianten – Kinderkriegen oder nicht – offen.
Mein Gefühl, meine Hoffnung ist aber trotzdem, dass du ein Wunder an uns tun wirst.
* * *
Nach ihrem erholsamen Paarurlaub wagen sie sich im September 2016, fünf Jahre nach Beginn ihrer Kinderwunschzeit, an ihren letzten Versuch. Ihr Leben läuft zu diesem Zeitpunkt sehr gut. Conni fühlt sich in ihrem Job wohl, das Gemeinschaftsprojekt floriert, sodass sie sich auch gut vorstellen können, ihren Weg ohne eigene Kinder weiterzugehen. Trotzdem sind sie natürlich aufgeregt, weil sich in den kommenden Wochen entscheiden wird, ob sie ein eigenes Kind bekommen werden oder nicht. Ihre Beziehung wurde durch den langen, gemeinsam zurückgelegten Kinderwunschweg vertieft. Nie hat einer von ihnen infrage gestellt, dass sie zusammengehören. Sollte Gott ihnen auch diesmal kein Kind schenken, so sind sie sich sicher, dass er für sie einen anderen Weg bereithält, der sie auch erfüllen wird.
Die Überraschung
Zum ersten Mal betritt Conni die Kinderwunschklinik zum Bluttest, bevor ihre Periode eingesetzt hat. Zu hoffen wagen die beiden trotzdem kaum. Mittags erwarten sie den Anruf der Klinik und verabreden sich, mitten zwischen beruflichen Terminen, in einem entlegenen Restaurant zum Mittagessen.
Als nach dem Essen zur vereinbarten Zeit noch immer kein Anruf vom Labor eingegangen ist, wählt Conni etwas zittrig die Nummer der Klinik: „Frau S., einen Moment bitte, ja, der Bluttest ist positiv. Herzlichen Glückwunsch. Sie können in zwei Wochen zur Ultraschalluntersuchung kommen.“
Conni wird sofort von Tränen überwältigt. Die beiden können es noch nicht fassen, Conni ist tatsächlich schwanger!
Conni: „Ich war gerade noch 36, als ich schwanger wurde. Mit meiner Schwangerschaft durften wir am eigenen Leib erleben: Gott kann wirklich Leben schaffen!“ Darüber sind die beiden sehr ehrfürchtig. Beim Gedanken daran kommen ihnen die Tränen: „Dieses Kind wurde interreligiös erbetet!“
Tagebuch Conni, Dezember 2016
Ich bin im vierten Monat schwanger! Es ist einerseits immer noch recht unvorstellbar und weit weg, dass da wirklich ein Mensch in mir entstanden und am Wachsen ist. Gleichzeitig ist es jetzt auch schon fast wieder „normal“, ich hab mich an den Gedanken schon so gewöhnt und es „geschieht“ auch alles weitere einfach so an mir.
Echt Wahnsinn, womit Gott uns da in diesem Jahr beschenkt hat! Er hat unseren Wunsch gehört und unsere Bitten – und die vieler anderer Leute – erhört.
* * *
Die werdende Mutter genießt ihre komplikationslose Schwangerschaft und im Sommer 2017 halten die beiden einen gesunden Sohn in den Armen. Wegen einer schwierigen Geburt darf Conni drei Wochen lang nicht aufstehen. Dennoch erlebt sie, dass sie, trotz ihrer Hilflosigkeit und dem Angewiesensein auf andere, ihr Kind nähren kann.
Der Kleine wächst heran und ist seinen Altersgenossen häufig in der Entwicklung einen Schritt voraus. Conni und Daniel sind überwältigt, dass sie trotz der schwierigen Ausgangsvoraussetzungen so ein tolles Kind bekommen haben. Sie sind glückliche, entspannte Eltern. Ihr Sohn hat zu beiden eine sehr intensive Beziehung. Als hochsensible Mutter merkt Conni jedoch auch, dass sie häufig an ihre Belastungsgrenzen kommt, da ihr das Leben mit Baby wenig Pausen ermöglicht.
Können wir uns ein zweites Kind vorstellen?
Die Hochsensibilität beziehen sie einige Monate später auch in ihre Überlegungen mit ein, ob sie einen weiteren Anlauf für ein Geschwisterchen wagen sollen. Für ein zweites Kind würde die Krankenkasse wieder drei Versuche mitfinanzieren, allerdings nur bis zum vierzigsten Geburtstag der Frau. In dem Jahr, in dem ihr Sohn zwei wird, steht im November Connis Vierzigster an. Ihnen bleibt also nicht viel Zeit. Deshalb beschließen die beiden, wie schon beim ersten Mal, Gott noch einmal die Möglichkeit zu geben, ihnen ein Kind zu schenken.
Der erste Versuch fällt in eine Zeit, in der Conni wieder zu arbeiten beginnt und die Familie dauerkrank ist. Dass sich keine Schwangerschaft einstellt, ist deshalb für das Paar keine Überraschung und geht im Alltags-Überlebenskampf fast unter. Bei einem weiteren Versuch, ein knappes halbes Jahr später, können zwar genügend Eizellen mit Samen zusammengebracht werden, diese entwickeln sich jedoch nicht zu Embryonen. Deshalb wird auch dieser zweite Versuch vorzeitig abgebrochen.
„Wahrscheinlich hat die Spermien- und Eizellenqualität in den vergangenen zweieinhalb Jahren, seit dem letzten Versuch, noch weiter abgenommen,“ mutmaßen die beiden. Deshalb beschäftigen sie sich nun ernsthaft damit, ob sie es bei diesen Versuchen bewenden lassen und endgültig mit dem Thema Kinderwunsch abschließen sollen. Sie konnten sich eigentlich nie ein Einzelkind vorstellen, wollen sich nun aber intensiv mit diesem Weg auseinandersetzen.
Sie sprechen mit anderen Paaren, die nur ein Kind haben oder erwachsenen Freunden, die selbst Einzelkinder sind. Beide Wege, mit einem oder mit zwei Kindern, werden dadurch vorstellbar. Deshalb besuchen sie erneut ihre Paarberaterin und thematisieren auch ihre Angst, nicht genug Kapazitäten für besonders herausfordernde Situationen wie Zwillinge oder ein Kind mit Behinderung, zu haben.
Letztlich ausschlaggebend für ihre Entscheidung zu einem dritten Versuch ist, dass sie selbst nicht einschätzen können, welcher Weg für sie als Familie der bessere ist, und sie deshalb diese Entscheidung erneut in Gottes Hände legen wollen. Außerdem regt sie die Beraterin dazu an, auch die Wünsche ihres Sohnes mit einzubeziehen. Und der, da sind sich beide einig, wäre ein sehr glücklicher und stolzer großer Bruder!
Der letzte Versuch findet einige Wochen nach unserem Gespräch für dieses Buch statt. Obwohl genug reife Eizellen mit genug intakten Spermien befruchtet werden können, entwickelt sich keine der Eizellen zu einem Embryo. Für das Labor sind das nicht erklärbare Faktoren, für Conni und Daniel Gottes Handschrift. Die Nachricht erhalten die beiden an Connis 40. Geburtstag. Sie sind froh, damit dieses Kapitel ihrer Familiengeschichte im Frieden abschließen zu können und umso dankbarer für ihren Sohn.
Ihre letzten Jahre waren sehr stark geprägt vom Kinderwunschthema und nun freuen sie sich auf ganz neue Wege und Herausforderungen als vollständige Familie zu dritt.
Hilfreiche Reaktionen von Dritten
Das Gefühlsleben in der Zeit des unerfüllten Kinderwunsches kann höchstens annähernd verstehen, wer sich in einer ähnlichen Lage befindet. Daher hatten auch Conni und Daniel immer wieder mit unsensiblen Kommentaren und ungebetenen Ratschlägen oder gut gemeinten Erfolgsgeschichten zu tun. Am meisten fühlten sie sich getragen und verstanden, wenn Menschen ihnen ohne vorschnelle Vorschläge einfach zuhörten.
Auch dass Freunde den Wunsch im Gebet mittrugen und sich trauten, nach einiger Zeit nachzufragen, stärkte sie. Ihnen war es immer lieber, wenn ihre Gesprächspartner offen mit dem Thema umgegangen sind und auch Nachfragen zu medizinischen Details stellten, anstatt eigenmächtig im Internet zu recherchieren.
Einmal gab ihnen jemand einen Eindruck von Gott weiter, der sich letztlich nicht bewahrheitet hat. Deshalb sehen sie es als fraglich an, wie hilfreich so etwas in einer derart fragilen Lage ist. Auf jeden Fall erleben die beiden immer wieder, dass auch andere sich öffnen, wenn sie offen mit ihrem Thema umgehen.
* Die Auszüge aus Connis Tagebuch wurden gekürzt und leicht angepasst.