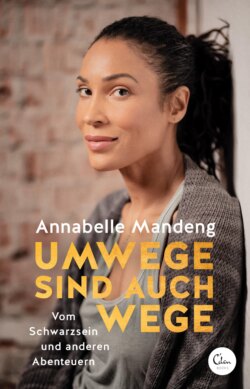Читать книгу Umwege sind auch Wege - Annabelle Mandeng - Страница 6
Überall und nirgends zu Hause
ОглавлениеWo bin ich? Was ist das? Meine Beine … Mein Fahrrad … Es muss da weg. Schnell, schnell … Ich wuchte es von mir herunter, werfe es zur Seite, drehe mich auf den Bauch, strecke beide Arme nach vorne, ganz eng an die Ohren. Unter mir der Asphalt, neben mir die Autoräder. Ich hänge fest, werde mitgeschleift … Stille. Irgendwann höre ich aus der Ferne Stimmen. Da sind Hände, die mich greifen, mich umfassen, mich tragen. Bin ich jetzt ein Engel? Ich schwebe, blicke durch das Loch in der Kuppel aus Köpfen auf mich hinab, wie ich dort unten mit geschlossenen Augen im Gras liege. Am Straßenrand, nicht weit weg von der Kreuzung. Da steht ein Auto, es ist dunkelgrün. Daneben eine Frau, die hysterisch schreit. Dann sehe ich meine Freundin Eske, sie klammert sich an ihr Fahrrad und drückt immer wieder den Ampelknopf. Die Ampel wird grün, Eske fährt los. Auf einmal kommt Elke herbeigerannt. Lalülalüüüü. Die Sirene eines Krankenwagens. Ich werde auf die Trage gelegt und blicke in Elkes vertrautes Gesicht, sie ist da, hält meine Hand, läuft neben der Trage her, steigt in den Krankenwagen ein, sitzt bei mir. Ich bin nicht allein.
Mein zweiter Schultag war zu Ende. Fröhlich schnatternd machten meine Freundinnen und ich uns auf den Heimweg. Um auf die andere Straßenseite zu gelangen, stiegen wir von unseren Rädern ab und schauten, wie es uns beigebracht worden war, nach links, dann nach rechts, und erst dann schoben wir unsere Räder über die Straße. Ich war die Letzte in der Gruppe. Mit meinen dünnen Armen und Beinen und meinem dicken Schulranzen auf dem Rücken kam ich mir vor wie ein Käfer. Aber ich liebte meinen Ranzen. Er war hellblau mit bunten Delfinen drauf. Plötzlich schoss ein Auto um die Ecke, und im nächsten Moment lag mein schweres Hollandrad quer über meinen Beinen. Später erzählte man mir, dass ich das Fahrrad hochgestemmt und von mir geworfen hatte, bevor ich mich auf den Bauch drehte. Als hätte ich gewusst, dass es mir sonst die Beine abtrennen würde. Wie ich das hinbekommen habe, ist mir ein Rätsel. Offenbar habe ich kurzzeitig Superkräfte mobilisiert … Da ich mich danach umdrehte und ausstreckte, konnte meinen Gliedmaßen zwar nichts mehr passieren, dafür hing ich aber mit meinem Schulranzen am Motor fest. Neun Meter wurde ich noch mitgeschleift, mein Gesicht über den Asphalt gezogen, wobei meine Oberlippe aufplatzte. Die Narbe habe ich bis heute. Genauso wie die an der Hüfte. Die sieht aus wie ein großer dicker Tropfen. Ein Metallteil meines Fahrrads hatte mich erwischt und eine große Fleischwunde gerissen. Mein Delfinranzen war zerfetzt und verbrannt; und auch die Straße hat etwas abgekriegt. Jahrzehntelang markierte eine tiefe Schramme im Asphalt die Unfallstelle, bis die Straße eines Tages neu geteert wurde.
Ich lag im Krankenwagen und wurde mit Lalülalü in die Klinik gefahren. Dort meinte der verantwortliche Arzt, dass die Lippe genäht werden müsse. Nach meiner Erfahrung in Kamerun hatte ich darauf überhaupt keine Lust, aber alle um mich herum redeten ganz lieb auf mich ein, sagten, ich bekäme eine Spritze, sodass ich gar nichts spüren würde. Aha … Und was bitte schön ist mit der Spritze? Aber okay, wenn’s denn unbedingt sein muss. Elke hielt mir die Hand, während ich die Pikserei in meine geschwollene Lippe mehr oder weniger tapfer aushielt. Dann fummelte der Arzt in meinem Gesicht herum, aber ich spürte schon nichts mehr und wurde ganz schläfrig …
Als ich aufwachte, klebte ein großes weißes Pflaster auf meiner Hüfte, ein zweites etwas kleineres in meinem Gesicht, und meine Mutter stand völlig aufgelöst an meinem Krankenbett.
Noch am gleichen Tag durfte ich nach Hause, wo mir Ousi ein Berry schenkte. Neben Flutschfinger mein Lieblingseis. Es schmeckte himmlisch erdbeerig und hatte die Form einer dicken Karotte. Guter Bruder. Denn was hätte eine geschwollene Lippe besser kühlen können als ein Eis! Wenn Sie jetzt denken, ich hätte seither ein gestörtes Verhältnis zu Eis – von wegen Assoziation mit Verletzungen oder so –, dann kann ich Sie beruhigen: Eis kann ich immer genießen! Nur mit Spritzen stehe ich inzwischen auf Kriegsfuß.
Ansonsten hielten die nächsten Jahre in Bad Zwischenahn wenig Spektakuläres bereit. Vielleicht abgesehen von der Tatsache, dass ich in der zweiten Klasse als erstes Mädchen in der Geschichte der Schule freiwillig von den Jungs in die Fußballmannschaft gewählt wurde – und dann auch noch das Siegertor schoss. Ha! Tatsächlich war ich beim Sport voll in meinem Element. Zwar sah auch meine Klavierlehrerin ein vielversprechendes Talent in mir, aber nichts lockte mich mehr als jede Art von körperlichem Training. Am liebsten zusammen mit meinen Freunden. Denn ich hatte tolle Freunde. Umso mehr schmerzte es mich, als es plötzlich hieß: Wir ziehen nach Togo!
»Cours! Cours vite!« (Lauf! Lauf schnell!), rufen sie mir hinterher.
Ich renne durch das hohe Gras. Schaue mich dabei immer wieder um und sehe, wie Leute mit Stöcken auf das Gras dreschen, wieder und immer wieder. Auf einmal winken und lachen sie und halten irgendetwas Langes, Dünnes, Grünes hoch. Sie haben die grüne Mamba, die hinter mir her war, erwischt. Glück gehabt. Ich schwitze. Diese Hitze …
Meine Mutter hatte schon immer den Anspruch, ihren Horizont zu erweitern, und so ließ sie sich als Beamtin kurzerhand beurlauben, um zwei Jahre lang für den Deutschen Entwicklungsdienst (DED) in Togo zu arbeiten.
Ich wollte jedoch nicht weg, schon gar nicht von Marens Familie. Aber Ousi und ich mussten natürlich mit. Nur Dolly durfte bei Maren und Britta bleiben; alles andere wurde in Koffer, Kisten und Tonnen verpackt oder – wie mein Klavier – bis zu unserer Rückkehr eingelagert; so lange wurde unsere Haushälfte untervermietet. Ousmènes Gitarre hingegen fand noch einen Platz im Gepäck. Irgendwann war unser Container jedoch voll und wurde über Hamburg nach Lomé4 verschifft, während wir drei Monate in dem DED-Vorbereitungszentrum in Berlin verbrachten. Ousi und ich erhielten dort zusammen mit anderen Kindern angehender DED-Mitarbeiter*innen Sonderunterricht, während unsere Mutter alles Notwendige für ihr zukünftiges Projekt lernte. Im Norden des westafrikanischen Landes sollte sie ein Behindertenzentrum leiten, in dem T-Shirts, Tischdecken, Bettwäsche und andere Textilien bedruckt und gebatikt werden, sowie den dazugehörigen Laden in Lomé aufbauen.
Der Trennungsschmerz war heftig. Es tat so furchtbar weh, und eigentlich war mir die ganze erste Zeit über nach Heulen zumute. In Berlin genauso wie in Togo. Ich fühlte mich herausgerissen, weggerissen von allem, was mir etwas bedeutete. Plötzlich war alles neu und fremd. Anstatt aus dem Haus zu stürmen, um mit meinen Freundinnen zu spielen, mit Gummistiefeln durch Pfützen zu hüpfen und sich gegenseitig auf dem Schulhof zu jagen, waren um mich herum nur wabernde Hitze und lauter unbekannte Gesichter. Ich verstand nicht, was die Menschen um mich herum sagten, die Einheimischen waren sogar völlig anders gekleidet. Am schlimmsten aber war für mich, dass Ousi und ich, kaum waren wir in Togo angekommen, in verschiedenen Expat5-Familien untergebracht wurden; Ousi lebte jetzt erst einmal im Süden des Landes bei einer deutschen Familie in Lomé, damit er dort auf die französische Schule gehen konnte, ich im Norden bei einer Schweizer Familie in Lama-Kara, unweit von Niamtougou. Meine Mutter fing sofort an zu arbeiten und pendelte von nun an die vierhundert Kilometer zwischen dem Projekt in Niamtougou und dem Laden in Lomé. Die Eltern meiner neuen »Familie« sprachen Deutsch, ihre drei Söhne – vierzehn, elf und sieben – allerdings nur Französisch. Das machte mir das Einleben nicht gerade leichter; schließlich hatte ich außer ein paar Brocken Schulfranzösisch aus der Berliner Vorbereitungszeit nichts zu sagen. So spielte ich zwar ab und zu mit den beiden Jüngeren, konnte mich aber nur mit Händen und Füßen verständigen. Zwar sprachen die Eltern Deutsch mit mir, aber dabei ging es eigentlich immer um organisatorische Dinge. Tagsüber besuchte ich die SOS-Kinderdorf-Schule. Jeden Morgen um acht Uhr wurde die togolesische Fahne gehisst, während wir Kinder unter den strengen Augen der Nonnen die Nationalhymne singen mussten.
Salut à toi pays de nos aïeux / Toi qui les rendait forts / Paisibles et joyeux / Cultivant vertu, vaillance / Pour la prospérité / Que viennent les tyrans / Ton cœur soupire vers la liberté …6
Es dauerte etwas, bis ich verstand, was ich da eigentlich sang, aber friedlich und fröhlich war mir in diesem Land überhaupt nicht zumute … Meine Mutter sah ich selten, meinen Bruder gar nicht. Aber es sollte ja nur für kurze Zeit sein, was immer das bedeutete. Also versuchte ich, meine Einsamkeit zu überwinden, zuzuhören und zu lernen, kurz, das Beste aus der Situation zu machen. Maren und ich schrieben uns viele Briefe, was mir dabei half, nicht unterzugehen. Schließlich galt es ja, sich damit abzufinden, dass ich nun in diesem fremden Land war und die nächsten zwei Jahre bleiben würde. Insofern nahm ich brav meine Malaria-Prophylaxe, ging zur Schule und gab mir alle Mühe, das Gefühl der Fremdheit loszuwerden.
»Ça me fait mal!« (Das tut weh!), schrie der siebenjährige Lucien. Er hielt sich das Bein und weinte. Ich merkte, dass er nicht mehr auftreten konnte. Was sollte ich denn jetzt machen? Bei einem unserer Streifzüge über das riesige Grundstück war Lucien umgeknickt und heftig gestürzt. Schnell rannte ich zum Haus, um Hilfe zu holen. Aber nur der vierzehnjährige Bernard war da. Mit hochgezogenen Augenbrauen, wie immer ganz der coole Teenager, starrte er mich an, als ich schwer atmend und aufgeregt mit den Armen fuchtelnd vor ihm stand. Ich versuchte, ihn mitzuziehen, aber er schüttelte mich ab. Verflucht noch mal. Es ging doch um seinen kleinen Bruder, der da draußen lag, vermutlich umgeben von Skorpionen und Schlangen … Und auf einmal sagte ich: »Tu dois m’accompagner. Lucien est blessé. Je t’en prie, viens avec moi!« (Du musst mich begleiten. Lucien ist verletzt. Ich bitte dich, komm mit!)
Ach du meine Güte. Ich habe ja Französisch gesprochen. Offenbar hatte ich während der vergangenen drei Monate nicht nur zugehört, sondern auch die Sprache absorbiert. Bernard war mindestens ebenso überrascht wie ich und folgte mir nun ohne ein weiteres Wort, um seinen Bruder ins Haus zu tragen.
Togo liegt etwas eingequetscht zwischen Ghana und Benin und ist ungefähr so groß bzw. klein wie Bayern, aber viel schmaler. Im Süden peitscht der Atlantik an die weiten Sandstrände, die direkt am Äquator liegen, im Norden stößt Togo an Burkina Faso, das damals noch Obervolta hieß.
Als ich nach gut drei Monaten endlich wieder bei meinem Bruder war, lebte ich regelrecht auf. Wir wohnten nun zusammen mit unserer Mutter in Lomé, in der oberen Etage eines kleinen zweistöckigen Hauses. Ousi und ich mochten dieses Haus, zumal es nur wenige Hundert Meter vom Strand entfernt lag. Vor allem ich liebte es, im Meer zu toben, obwohl Ousi sich immer wieder einen Spaß daraus machte, mich mit riesengroßen Quallen zu bewerfen. In diesen Momenten war ich glücklich und ganz Kind.
Doch insgesamt war das Leben in Togo für mich kein Zuckerschlecken. Mit dem Umzug in die Hauptstadt konnte ich die strengen Nonnen zwar hinter mir lassen, aber auch die kleine Deutsche Seemannsschule, auf die ich nun ging, war gewöhnungsbedürftig. Sie gehört zur Deutschen Seemannsmission, einer Auslandsstation für deutsche Seeleute, wie sie Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts in vielen Hafenstädten rund um die Welt gegründet wurden. Zwölf Kinder aller Jahrgänge saßen hier in einem Klassenzimmer. Wie in einer altmodischen Dorfschule. Unsere Lehrerin war eine ältere Dame, die aber gern auf jünger mimte, mit grellem Make-up, tiefem Dekolleté und viel nacktem Bein. Mit mir, dem einzigen Schwarzen deutschen Kind, konnte sie nicht viel anfangen. Obwohl ich immer super Noten hatte, ignorierte sie mich meist oder machte spöttische Bemerkungen über mein Aussehen. Auch meine Mitschüler ließen mich links liegen oder sagten hämisch, dass ich aussehe wie ein »Biafra-Kind«7, weil ich so dünn war. »Kriegst du zu Hause nicht genug zu essen?« Diese Bosheit kam nicht von ungefähr, denn ihren Eltern ebenso wie der Lehrerin war meine unabhängige Singlemutter suspekt. Wir passten einfach nicht ins Bild der Weißen Expat-Familien.
Umgekehrt empfand ich die deutsche Kommune als Ansammlung merkwürdiger Leute, die sich allesamt – die Kinder eingeschlossen – irre wichtig nahmen und sich aufführten wie Kolonialherren. Bei ihren obligatorischen Zusammenkünften im Goethe-Institut tauschte man sich über verschiedene Projekte aus, hörte gemeinsam deutsches Radio, begrüßte die Neuankömmlinge – und irgendwer rief immer in die Hände klatschend nach einer der einheimischen Angestellten. Viele beschwerten sich über das hiesige Essensangebot, weshalb man bestimmte Delikatessen einfliegen lassen müsse. Mir war das alles sehr unangenehm. Kurzum: Die Deutschen und ich gingen uns möglichst aus dem Weg. Umso lieber spielte ich mit den vielen Nachbarskindern Fangen oder Kästchenhüpfen auf den sandigen Straßen vor unserem Haus und vertiefte dabei en passant mein Französisch. Diese Kinder nahmen mich in ihrer Mitte auf; trotzdem blieb ich immer ein Exot. Waren mein Bruder und ich in der Stadt unterwegs, riefen uns kleine Kinder wie allen Weißen Fremden hinterher: »Jovo, Jovo! Bonsoir, ça va bien? Merciiii!« (Weißer, Weißer! Guten Abend, geht’s gut? Daaanke!) Was war ich denn nun? Schwarz wie in Deutschland und in den Augen der deutschen Expats? Oder Weiß, wie mich die Togolesen sahen? Es war verwirrend, beschäftigte mich damals aber eher unbewusst.
Inzwischen hatte meine Mutter auch in Lama-Kara ein Haus gemietet, weil sie nach wie vor zu diesem staubigen Ort pendeln musste. Es war ein graues Flachdachhaus mit Gittern vor den Fenstern, was hier jedes Haus hatte, und einem großen, staubigen Garten, umgeben von einer hohen Mauer, die Einbrecher und wilde Tiere abhalten sollte. Skorpione ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken. Regelmäßig zog sich meine Mutter Gummistiefel und dicke Handschuhe an und stapfte durch den Garten, um Skorpione zu fangen. Die Regel lautete: je kleiner, desto giftiger! Alle gefangenen wurden dann mit aufgebrochenem Giftstachel in Öl gelegt, woraus sich ein Gegengift bilden sollte. Das obere Regal in der Küche zierten schon bald etliche Einweckgläser mit großen, kleinen und ganz kleinen Skorpionen.
Waren wir zu dritt in Lama-Kara, was oft am Wochenende der Fall war, badete ich gern in einer der Tonnen, die von dem Containertransport übrig geblieben waren. Sie stand unter einer Regenrinne, sodass sie sich während der Regenzeit ganz von selbst füllte, wenn das Wasser sintflutartig vom Himmel stürzte. Ich hockte mich mit ganz eng angelegten Armen in die Tonne, sodass ich am Ende wie ein kleines Paket im Wasser saß und nur noch der Kopf herauslugte. Eine herrliche Abkühlung. Auch unser einheimischer Koch8 wusste die Regengüsse sinnvoll zu nutzen. Er stellte große Schüsseln auf, damit sich das Wasser darin sammelte, und platzierte diese dann direkt unter den hellen Außenlampen des Hauses, sodass viele fliegende Termiten darin landeten, wenn sie zum Licht strebten. Termiten waren eine togolesische Spezialität und wurden gegrillt als eine Art Pommes-Ersatz gereicht. Natürlich probierte ich auch welche, konnte mich aber nie wirklich dafür begeistern. Der Chitinpanzer, der beim Hineinbeißen knackte, und das glibberige Innere waren mir irgendwie unheimlich. Ansonsten kam ich gut klar mit den einheimischen Spezialitäten. Maniok mit frisch zubereitetem Piment zum Beispiel. Köstlich. Das traditionelle afrikanische Piment wird von Region zu Region anders hergestellt und heißt zum Teil auch unterschiedlich. Aber die Grundzutaten sind immer ähnlich: Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenmark, sehr viel Chili oder Cayennepfeffer. Fast wie ein superscharfes Pesto. Davon konnte ich gar nicht genug kriegen. Nur auf eines hätte ich während meines Aufenthaltes in Togo wirklich gern verzichtet: Malaria. Diese gefürchtete, von Stechmücken übertragene Infektionskrankheit lässt einen förmlich verdursten, wenn man Pech hat. Die Familie, bei der ich zu der Zeit wohnte – meine Mutter hatte gerade mal wieder besonders viel um die Ohren –, hätte bestimmt lieber einen gesunden Gast gehabt, aber man kümmerte sich bestens um mich. Ständig hatte ich kalte Waschlappen auf der Stirn und wurde mit Wasser und Joghurt gefüttert, damit ich wenigstens etwas zu mir nahm. Malaria ist echt heimtückisch. Extrem hohes Fieber, ständiges Schwitzen und dazu die Unfähigkeit, Flüssigkeiten bei sich zu behalten, zehren den Körper aus. Ständig war ich durstig, nass geschwitzt und dabei so schwach, dass ich zwei Wochen lang kaum aufstehen konnte. In ein Krankenhaus zu gehen, kam nicht infrage, dazu waren die hygienischen Bedingungen dort zu schlecht. Zwischendurch kam auch meine Mutter an mein Bett, aber so richtig erinnere ich mich daran nicht, weil ich wie im Delirium vor mich hindämmerte …
Immer wieder habe ich versucht, Togo als eine Art Abenteuer zu sehen, vor allem wenn mir die Sehnsucht nach Bad Zwischenahn zusetzte, aber das Komplettpaket mit all der Fremdheit und Einsamkeit war für mich eher strapaziös als abenteuerlich. Richtig aufregend fand ich es hingegen, als ich zehn wurde: mein erster zweistelliger Geburtstag! Doch meine Mutter hatte zu viel zu tun, sodass dieser Tag ohne Feier vorbeiging. Nur gut, dass das Leben weitergeht und irgendwann der nächste Geburtstag vor der Tür steht. Diesmal waren Elke und meine Tante Ilona kurz vorher zu Besuch gekommen. Sie blieben zwei Wochen und sorgten dafür, dass wenigstens mein elfter Geburtstag ein wenig gefeiert wurde. Ich bekam sogar einen selbst gebackenen Kuchen!
Rückblickend haben mich die beiden Jahre in Togo sowohl abgehärtet als auch sensibilisiert. So habe ich zum Beispiel gelernt, mich, wenn nötig, abzugrenzen und dass es Situationen gibt, die mich in dem Moment vielleicht verletzen, die im Grunde aber nicht persönlich zu nehmen sind.
In dem sogenannten Behindertenzentrum, das meine Mutter während der Zeit leitete und in dem sie zweifellos viel Gutes bewegt hat, arbeiteten vor allem ehemalige Polio- und (nicht ansteckende) Leprakranke.9 Die von der Kinderlähmung Gezeichneten humpelten oft mehrere Kilometer, nur auf einen Stock gestützt, um zu dem Zentrum zu gelangen. Und die meisten Leprakranken hatten nur noch Fingerstümpfe, mit denen sie jedoch Pinsel halten konnten, um damit Farben auf die Stoffe zu tupfen. Für mich war es schnell normal, dass mir solche Kranken begegneten ebenso wie die Bettler, die mit offenen Wunden, in denen sich die Fliegen sammelten, am Straßenrand kauerten. Mit der Zeit entwickelte ich eine dicke Haut, die mir auch half, die vielen trostlosen Tage an der Deutschen Seemannsschule zu überstehen. Diese bornierte Arroganz, mit der dort alle Menschen behandelt wurden, die nicht Weißer Hautfarbe waren, machte mich traurig und wütend. Und doch hätte ich gern dazugehört, wurde aber immer wieder enttäuscht. Immer wieder wurde über meine Mutter und ihre beiden Schwarzen Kinder getuschelt. Immer wieder gab man mir das Gefühl, mich wegen meiner Hautfarbe schämen zu müssen, und hielt mir auf diese Weise einen Spiegel vor die Nase: Schau, wie anders du bist! Es tat weh, ausgegrenzt zu werden. Aber ich konnte nun mal nicht aus meiner Haut und wollte es auch nicht.
Lena und ich arbeiten heute an Evas großem Monolog. Mit diesem habe ich Burhan beim Casting so berührt, dass er in mir sofort die Eva sah. Doch ein Casting, in dem man sein Potenzial zeigt, ist das eine, der eigentliche Dreh hingegen etwas völlig anderes. Da müssen die Szenen sitzen, da kommt es darauf an, punktgenau abzuliefern.
In dem Monolog spricht Eva über ihre Hautfarbe und wie sie diese empfindet. Eva ist zerrissen, sie fühlt sich Schwarz, als wäre das eine Art Stigma. Ganz anders als ich. Für mich ist meine Hautfarbe inzwischen ein Geschenk, und die Konflikte, die aufgrund dessen an mich herangetragen wurden und werden, haben mich stets stärker gemacht. Ich zweifle nicht wie Eva, die sich so sehr wünscht, in der Gesellschaft anzukommen, obwohl sie als Klubbesitzerin längst fester Bestandteil der Berliner Szene ist. Eva ist integer, stark und schön, aber einsam. Anderen Menschen gegenüber ist sie vorsichtig-distanziert. Erst als sie Francis begegnet, lässt sie sich fallen. Der Monolog findet nach der Liebesszene zwischen den beiden statt, als sie ihm ihr Herz öffnet und von ihrer Zerrissenheit erzählt.
Lena und ich sitzen uns am Tisch gegenüber.
»Ich fühle nicht wie Eva«, sage ich und schaue Lena leicht verunsichert an.
»Dann musst du nach Momenten in deinem Leben suchen, die du übertragen kannst.«
Mir fällt ein, dass ich einmal mit 19 in eine Disco wollte, mich der Türsteher aber mit den Worten abwies: »Schau dich doch an, wie Schwarz du bist. Du kommst hier nicht rein!« Reflexartig holte ich aus und verpasste ihm einen Faustschlag auf die Nase, woraufhin er mich packte und auf den Bürgersteig schmiss. Dort saß ich dann heulend und tat mir unglaublich leid in meiner Hilflosigkeit. Gleichzeitig war ich wütend und verwirrt. Schließlich konnte ich ja nichts für meine Hautfarbe! Genau dieses Gefühl passt zu der Szene. Mit dem eigenen inneren Konflikt connecten notierte ich ins Drehbuch … Und am Ende des Coachings bin ich bereit für den Dreh.
Welket liegt auf dem Rücken, ich auf seine Brust gelehnt. Wir sind bis zur Taille nackt, unser restlicher Körper ist zugedeckt. Im Film kommt der Monolog nach der Liebesszene, doch wir drehen ihn zuerst. Ich tauche ein, wie ich es mit Lena erarbeitet habe. Dann lasse ich los, und bei Burhans »Uuund bitte!« werde ich zu Eva.
EVA
Die Leute sehen mich an und denken
nur das eine: Schwarz. Zumindest
denke ich, dass sie das denken.
FRANZ
Dadurch wird es wahr …
EVA
Es muss so sein. Meine Haut ist
das Erste, was sie sehen. Man kann
es nicht ignorieren. Sie hören
meine Stimme, die ist Weiß. Meine
Worte, die sind Weiß. Ich sehe die
Welt durch ihre Augen – in Weiß.
Meine Gedanken sind Weiß. Mein
Blut ist rot. Aber mein Herz ist
Weiß. Wann bin ich Weiß genug?
Oder Schwarz genug? Selbst wenn
alle Menschen blind wären, würde
ich immer noch wissen, dass ich
Schwarz bin und dass es einen
Unterschied macht, denn es macht
einen Unterschied.
Eva kämpft mit sich, sie beneidet Francis/Franz um seine Hautfarbe, da sie eindeutig ist, nicht gemischt wie ihre.
EVA
Deine Welt ist einfach.
Einfarbig …
FRANZ
Ich würde sofort mit dir tauschen.
EVA
... Aber du weißt, wer du bist.
Deine Haut und deine Seele stehen
nicht in Widerspruch zueinander.
Meine Haut reißt an meiner Seele.
Du bist ignorant, aber du bist eins.
Ich bin zerrissen.10
Burhan ist zufrieden. Welket und ich funktionieren als Einheit. Ob das auch für die Liebesszene gilt? Eine Liebesszene ist nie leicht zu drehen. Sich von einem oder einer Fremden anfassen und küssen zu lassen, ist überhaupt nicht leidenschaftlich oder sexuell stimulierend. Vielmehr gilt es, das Ganze technisch abzuwickeln, damit der Kameramann einfangen kann, was der Regisseur braucht, um dem Zuschauer das Gefühl der Intimität zu vermitteln. Welket und ich mögen und verstehen uns, das erleichtert die Sache.
Das Set ist jetzt geschlossen; nur Regisseur und Kameramann werden dabei sein. Das ist bei einer Liebesszene so üblich. Welket und ich liegen auf dem Bett, während die Kostümbildnerinnen noch etwas an uns herumfummeln, um den Schambereich mit eigens in unseren Hauttönen eingefärbten Klebestreifen abzudecken. Wir kichern, weil sich das alles ziemlich komisch anfühlt. Dann sind wir so weit, und die Kostümbildnerinnen verlassen das Zimmer …
Da Welkets Haut so viel dunkler ist als meine, spielen wir beim Drehen mit den Kontrasten, bieten meine Hände auf seinem Rücken an, was Burhan gefällt. Mal sitze ich auf Welkets Schoß, mal liege ich unten. Einmal setze ich mich allerdings so abrupt auf, dass die Klebestreifen abfallen. Wir müssen furchtbar lachen! Dann wird das Set umgebaut, damit Yoshi auch von der anderen Seite filmen kann. Das braucht Burhan, um daraus am Ende eine stimmige Szene zu schneiden. Und schließlich ist die Liebesszene im Kasten.
Während der Aufnahmen ist es mir gelungen, das große Ganze zu betrachten, obwohl ich die Situation selbst als schwierig und befremdlich empfunden habe. Vielleicht ist auch das etwas, was ich in Togo gelernt habe.
4Hauptstadt von Togo am Atlantischen Ozean.
5Kurzform von Expatriate, womit Fachkräfte gemeint sind, die für ausländische Organisationen arbeiten.
6Deutsche Übersetzung: Gegrüßt seist du, Land unserer Ahnen / Du, der du sie stark gemacht hast / Friedlich und fröhlich / Pflegst Tugend, Tapferkeit / Für den Wohlstand / Und kommen die Tyrannen / Seufzt dein Herz nach Freiheit …
7Der Ausdruck entwickelte sich während des Biafra-Krieges, der von 1967 bis 1979 in Nigeria wütete und in dem Hunger zur Waffe wurde. (Quelle: https://www.welt.de/geschichte/article166324755/Als-hungernde- Kinder-Symbole-der-Dritten-Welt-wurden.html)
8Expats zählen zu den Privilegierten im Land, weshalb es sich gehört, einheimische Hausangestellte zu beschäftigen.
9Die Poliomyelitis ist eine meist im Kindesalter durch Polioviren ausgelöste Infektionskrankheit, die zu bleibenden Lähmungen der Arme und Beine führen kann. Leprakranke verlieren meist das Gefühl für Kälte, Wärme und auch Schmerz. Ohne Behandlung verletzen sich die Patienten oft unbemerkt und infizieren sich dann an lebensgefährlichen Krankheiten wie Tetanus. Diese Wunden werden vielfach unbehandelt gelassen, und infolge von Entzündungen können diese Körperbereiche absterben.
10Berlin-Alexanderplatz, Produktion: Sommerhaus Filmproduktion GmbH, Regie: Burhan Qurbani, 2020, Drehbuch: Burhan Qurbani und Martin Behnke.