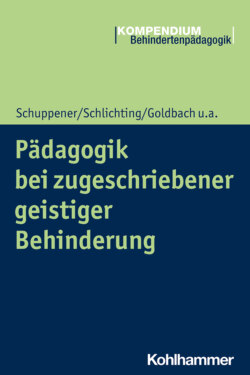Читать книгу Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung - Anne Goldbach - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Macht
ОглавлениеDie theoretischen Auseinandersetzungen zur Macht im Kontext einer Pädagogik bei zugeschriebener Behinderung sind vielfältig (vgl. Arendt & Reif 2017; Goffman 2016; Goffmann 1967; Jantzen 2012a; Freire 1998; Bourdieu 2015; Dederich 2007b; Kremsner 2017; Ackermann & Dederich 2011; Foucault 2000; Laubenstein 2008, u. a.) und müssen an dieser Stelle eine Begrenzung erfahren.
Wie Abbildung 2 zum Beginn dieses Kapitels zeigt, kann davon ausgegangen werden, dass zwischenmenschliche Kommunikation von machtvollen Strukturen durchzogen ist. Sowohl gesamtgesellschaftliche Faktoren, aber auch individuelle Lebensbedingungen haben Einfluss auf erlebte Machtstrukturen.
Im Folgenden soll versucht werden, einzelne Facetten und Bedingungsgefüge von Macht im Kontext der Behindertenpädagogik aufzuspüren, denn »Pädagogik ist in spezifische Macht- und Herrschaftsverhältnisse verstrickt und involviert« (Krenz-Dewe & Mecheril 2014, 58 f.). Auch Greving betont die Bedeutsamkeit von Macht in der (Behinderten)Pädagogik, indem er sagt: »Eine Beziehung ohne Macht erscheint somit kaum denkbar – Organisationen, welche sich primär beziehungsorientierten oder -gebundenen Aufgaben oder Themen widmen, können demnach nur Organisationen sein, in welchen Machtphänomene eine außerordentliche Rolle spielen« (Greving 2004, 290).
Waldschmidt veranschaulicht sehr gut, dass Behinderung im Sinne Foucaults generell als eine Machtstruktur verstanden werden kann, die unter anderem durch die Wissenschaftsdisziplin der Behindertenpädagogik selbst hervorgebracht wird (vgl. Waldschmidt 2006). Auch Jantzen gibt zu bedenken, dass Macht und Gewalt möglicherweise eine notwendige Bedingung für die Herausbildung einer Behindertenpädagogik sind (vgl. Jantzen 2001). Inwiefern diese Betrachtungen begründbar sind, sollen die nachfolgenden Aspekte deutlich machen.
Waldschmidt arbeitet heraus, dass behinderte Körper im Sinne Foucaults keine Naturtatsachen sind, sondern vielmehr in Diskursen konstruiert werden (vgl. Foucault et al. 1996). Vor allem die Humanwissenschaften, Fächer wie Medizin, Psychologie und Pädagogik stellen Wissensordnungen her, die bestimmen, was als (soziales) Problem wahrgenommen wird (vgl. Waldschmidt 2006; Laubenstein 2008). Wissenschaftliche Disziplinen legen demnach fest, was als Abweichung und behandlungsbedürftig gilt und diagnostiziert werden muss. So beschreibt Kremsner die Diagnostik (von Intelligenzstörungen) als »behindernden Unterdrückungsmechanismus«, aufgrund dessen sich Behinderung als Zuschreibung während des gesamten Lebenslaufes manifestiert und in Folge eines hegemonialen Zusammenspiels verschiedener sozialer Welten und ihrer Akteurinnen* fortlaufend reproduziert wird (vgl. Kremsner 2017). Durch Abgrenzungspraktiken zwischen normal und nichtnormal wird Normalität durch eine Dominanzkultur in der Gesellschaft produziert und unweigerlich mit Machtstrukturen verknüpft (vgl. Laubenstein 2008).
Foucault beschreibt, wie in solch staatlichen hegemonialen Institutionen (z. B. Armee, Schule, aber auch Krankenhäuser) Körper diszipliniert und an die vorherrschende Norm angepasst werden (sollen) (vgl. Foucault 2000). Kremsner sieht in der Funktion von Institutionen der so genannten Behindertenhilfe den Prozess des Othering, der dazu führt, dass die Menschen, die als behindert klassifiziert wurden, sich mit ihrer Rolle als ›außerhalb der sozialen Welt‹ identifizieren und diese nicht in Frage stellen, womit gleichzeitig die normative Setzung erhalten wird.
»Konkret bedeutet dies, dass Menschen in Folge kategorial-diagnostischer Zuschreibungen sinnbildlich zunächst aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, um sie in weiter Folge und weitgehend alternativlos in Hegemonialapparaten einzuschließen, wo sie – ebenfalls auf sozialen Konsens beruhend – Konzepte wie Heilung, Förderung, Therapie und dergleichen zugeführt werden sollen« (Kremsner 2017, 281).
Wie machtvoll sich das Verhaftetsein in Institutionen auf die persönliche Entwicklung und Identitätsbildung auswirken kann, hat Goffmann (vgl. Goffman 2016) und später eine Reihe von anderen Autorinnen* (vgl. Kremsner 2017; Plangger & Schönwiese 2010) gezeigt. Kremsner verdeutlicht in ihrer Arbeit, dass auch das derzeitige System der so genannten Behindertenhilfe, obschon es nicht mehr/immer alle Merkmale ›totaler Institutionen‹ aufweist, als Hegemonialapparat funktioniert. Die Akteurinnen* in diesem Feld sind danach bestrebt, ihre soziale Welt und ihren Status aufrecht zu erhalten, weshalb es im Gegenzug zur Unterdrückung oder Nichtbeachtung der Stimmen der Menschen kommt, die das System der sogenannten Behindertenhilfe in Anspruch nehmen.
Geben und Helfen erhöht den eigenen Status und verringert den des in Anspruch Nehmenden. Im Kontext der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen wird oft nicht mit einer reziproken Gegenleistung gerechnet. Aus der sich so ergebenden Machtasymmetrie (vgl. Dziabel 2017) entstehen paternalistische Austauschbeziehungen. Der Unterstützung in Anspruch Nehmende reagiert mit emotionaler Bindung, angepasstem Verhalten oder bspw. dankbarer Unterwürfigkeit als Gegenleistung (vgl. ebd.). Er selbst erkennt seine Rolle als Hilfeempfänger an. Somit besteht durch die Institutionen eine Macht der Setzung, aber gleichzeitig reproduzieren die ›Beherrschten‹ diese Zustimmung immer wieder, weil ihnen die Anerkennung als zur sozialen Welt Zugehöriger fehlt (vgl. Kremsner 2017, 255 f.).
Als Folge von machtvollen Entscheidungen und Handlungen im institutionellen Kontext von Behinderung werden unter anderem Überbehütung, erlernte Hilflosigkeit, Sprachlosigkeit und erlernter Ausschluss diskutiert (vgl. Freire 1998; Jantzen 2001; Kremsner 2017; Goffman 2016). Kremsner macht unter Rückbezug auf Spivac (2008) deutlich: Subalterne (unterdrückte Gruppen) sind oft Menschen, die sich aufgrund ihrer Vorerfahrungen nicht trauen zu sprechen, die nicht sprechen dürfen oder deren Stimme einfach nicht gehört oder ernst genommen wird (vgl. Kremsner 2017).
Ein erster Schritt, um eine bessere Gleichverteilung von Machtverhältnissen zu schaffen, ist das Erkennen des eigenen Machtpotentials. So schreibt Freire, dass die Erkenntnis des Unterdrückers, selbst Unterdrücker zu sein, »beträchtliche Qualen erzeugen (mag), aber es führt noch nicht notwendig zur Solidarität mit den Unterdrückten. Es genügt nicht, daß er seine Schuld durch eine paternalistische Behandlung der Unterdrückten rationalisiert, während er sie noch weiterhin in ihrer Lage der Abhängigkeit hält« (Freire 1998; 102).
Notwendigerweise muss sich die unterdrückende Person ihrer unterdrückenden Rolle erst einmal bewusst werden. In aktuellen Diskussionen im Bereich der Behindertenpädagogik werden machtrelevante statusabhängige Privilegien sowohl vor dem Hintergrund der Schaffung von Wissen in der Wissenschaft (vgl. Mohseni et al. 2018; Kremsner 2017; Hauser & Plangger 2015) als auch im Kontext der Herstellung von Differenz durch Professionelle in der pädagogischen Arbeit (vgl. Weitkämper & Weidenfelder 2018; Rehr 2018) diskutiert. Misamer zeigt anhand ihrer empirischen Untersuchung, dass die Machtanwendung aus empirischer Sicht eine grundlegende Komponente der Lehrkräfte-Schülerinnen*-Beziehung ist (vgl. Misamer 2018). Es muss Aufgabe von Akteurinnen* in der so genannten Behindertenhilfe sein, tatsächliche Solidarität zu ergreifen und einen möglichen Empowermentprozess wirklich in Gang zu setzen, denn Noack folgend ist Empowerment die symmetrische Verteilung von Macht (vgl. Noack 2003).
»Dieser radikale Verzicht auf Stellvertretung und Bevormundung zugunsten der Perspektive etwas gemeinsam mit Behinderten zu tun, setzt voraus, daß BehindertenpädagogInnen ›eigene Gründe haben, sich an den diesbezüglichen Auseinandersetzungen zu beteiligen‹« (Jantzen 2001, 66).
Jantzen sieht in der »eigenen Befreiung […] aus den […] unwürdigen Verhältnissen entfremdeten Handelns gegenüber den sog. Behinderten« einen tragfähigen Grund für Pädagoginnen*, ihr Handeln neu auszurichten (vgl. Jantzen 2001).