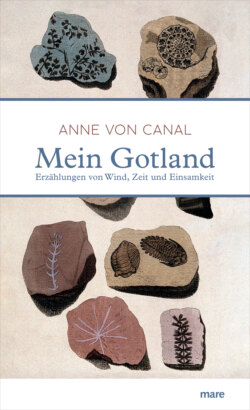Читать книгу Mein Gotland - Anne von Canal - Страница 8
Оглавление1 Fortuna.
Hier liegt das Glück verrostet im Meer; verlassen und aufgegeben zerfällt es langsam im Angesicht der Gezeiten, des Windes und der Jahre. Wird täglich kleiner, poröser, durchlässiger und gibt dennoch nicht auf. Noch nicht.
Fortuna.
Viel mehr als die Bugspitze ist von dem alten deutschen Frachtschiff nicht übrig, doch die ragt hoch aus den Wellen, hält den Namen eisern über Wasser.
Ich muss lachen über so viel Symbolhaftigkeit.
Auf den Rostlöchern im Schiffsstahl pfeift der Novemberwind ein ungestümes Lied, er pflückt die Gischt von den heranrollenden Brechern und trägt sie in wehenden Fahnen davon, zurück aufs Meer. Er war es auch, der mich hergeschoben hat, eine Hand fest in meinem Rücken, über Stein, über Stein, über Stein. Kilometerweite, karge Kalksteinflur. Geh, bis du nicht mehr weiterkannst, geh und sieh dich nicht um!
Das ist Norsholmen: Außenposten des Außenpostens. Der nördlichste Zipfel Fårös, dieser eigensinnigen Schwesterinsel, die wiederum selbst wie ein Zipfel an der Nordspitze Gotlands hängt. Das ist dort, wo selbst die Heide aufgibt, wo auch die trutzige Geröllebene nicht mehr Land sein mag und sich dem Meer ergibt.
Keine Seemöwe krächzt am saphirblauen Himmel, und kein verirrtes Schaf ruft; der Kalksteinbruch, den ich auf halbem Weg passiert habe, lärmt schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Hier ist wochen-, vielleicht sogar monatelang niemand mehr gewesen, seit der Sommer und die wenigen Besucher sich in wirtlichere Gefilde verzogen haben.
Ein Stück weit draußen an der Sandbank, dem Salvorev, brechen sich schwarzblau die Wellen. Ich las, das Riff trage seinen Namen des Passionsgedichts wegen, das schiffbrüchige Matrosen anstimmten, wenn sie dem Tod gottesfürchtig ins Auge sahen und Trost suchten in einem alten, größeren Leiden:
Salve, caput cruentatum,
totum spinis coronatum,
conquassatum, vulneratum,
arundine verberatum,
facie sputis illita.
Rhythmus und Reim. Bangen und Hoffen.
Oh, Haupt voll Blut und Wunden. Fast höre ich die beschwörenden Stimmen, die, auf Rettung harrend, diese martialischen Worte kreisen lassen wie ein Karussell.
Mich schaudert.
Ob die Crew auf der Fortuna ans Beten dachte, in dieser stürmischen Oktobernacht 1969, als sie ihr Schiff verlor?
Nirgends ein Licht. Windstärke zehn, und die Wellen schlagen über das Vorschiff. Der Kapitän und der Steuermann navigieren durch die dichte Finsternis, wohl kaum mit einem Lied auf den Lippen. Konzentriert starren sie hinaus und erkennen doch zu spät, dass sie in der Bucht Ekeviken in eine gefährliche Sackgasse geraten sind. Alle Versuche, zurück in offenes Gewässer zu kreuzen, scheitern. Krachend läuft die Fortuna auf Grund, nur dreißig Meter vom Ufer entfernt, und sie können nichts tun. Notraketen! Dreißig Stück schießen sie ab. In der Ferne passiert ein Schiff, doch das Dunkel reißt nicht auf. Kein Scheinwerferkegel, der übers Wasser zu ihnen huscht, nicht mal der zuckende Punkt einer Taschenlampe im nahen Uferwald. Sie lassen das Rettungsboot zu Wasser, entschlossen, es auf eigene Faust zu versuchen, ehe das Leck zu groß wird und die Kraft der Wellen sich ungehindert Bahn bricht, doch sie kommen nicht von Bord. Zu wild die Brandung. Es ist kurz vor vier Uhr morgens, als eine Patrouille des Grenzschutzes das Schiff endlich entdeckt, die Küstenwache informiert und den Hubschrauber zur Bergung anfordert.
In der Zeitung Gotlands Allehanda am nächsten Tag ein Foto der befreiten Crew mit folgender Bildunterschrift: »Die mit dem Helikopter gerettete Besatzung der Fortuna am Kaffeetisch in der Polizeiwache von Visby. Von links: die Köchin Fockra Voss und ihr Mann, Steuermann Walter Ross, Aurich. Der Matrose Käse Hodnstta, Apeldorn, Holland; der befehlshabende Kapitän, Dieter Baschin, Bremen, und der Matrose Nanne Meyer, Emden.«
Käse Hodnstta? Fockra Voss und Walter Ross? Nanne Meyer? Allein die Namen schreien nach einer Kurzgeschichte.
Die Telefonverbindung, über die ihre Daten übermittelt wurden, muss sehr schlecht gewesen sein.
Da steht ein aufgeregter Lokalreporter in der Telefonzelle in Sudersand – dieser einen Telefonzelle, von der aus Staatsminister Olof Palme alle seine Anrufe tätigte, wenn er Sommerferien auf Fårö machte (denn in seiner Hütte hatte er weder fließend Wasser noch Strom noch Telefon) – und schreit in den Hörer: Ich verstehe dich so schlecht! Wie heißt der Kerl?
Und auf der anderen Seite schreit es zurück: Käse, wie ost, nur auf Deutsch!
Was? Wurst?
Nein, Kalle! Käse!
Und der Wind ist noch längst nicht abgeflaut und brüllt immer noch sehr laut, Regentropfen wehen durch die Luft, und für Kalle ist es wahrhaft schwierig, unter diesen Umständen gleichzeitig den Block, den Stift, den Hörer und die Zigarette zu halten.
Wieder an seinem Schreibtisch, betrachtet er unsicher seine Aufzeichnungen. Hm. Ob er lieber zurück zur Telefonzelle geht und noch mal anruft? Ein Blick aus dem Fenster ins Unwetter, dann gibt er seinem Journalistenherzen wahrscheinlich einen Ruck und dichtet diesen fremden Menschen Namen an, die in seinen Ohren deutsch genug klingen, um nicht schwedisch zu sein.
Von Lügenpresse spricht noch niemand.
Es ist nicht genau zu sagen, was »von links« bedeutet, denn die fünf Crewmitglieder sitzen versetzt in zwei Reihen hinter einem Tisch. Erste Reihe, dann zweite Reihe? Oder systematisch von links nach rechts?
Fockra, die Köchin, in gemusterter Bluse unzweifelhaft am linken Rand. Mausezähnchen und ein rundliches Gesicht mit kleinem Doppelkinn. Neben ihr, der massive, vierschrötige Türstehertyp mit dem dunklen Gesicht, dem dunklen Bart, dem dunklen Blick – ist das Walter? Ist der Fockras Mann? Oder doch eher der Schmächtigere schräg hinter ihr? Zwei Männer wie Tag und Nacht.
Ich schaue ihr in die Augen. Aber ihr Blick verrät kein Gefühl, keine Zugehörigkeit, nur eine blitzwache, aufgeschreckte Erschöpfung.
Der Dünne ganz rechts, mit einer Art Seitenscheitel auf dem Kopf und Zigarette in der Hand, ist vermutlich der Holländer Käse, und hinter ihm, der einzige der Männer im Hemd, ist das Dieter, der Kapitän?
Sie alle wirken unerhört wenig seemännisch; dazu kaum vertraut oder verbunden, als säßen sie rein zufällig hier zusammen bei der Visbyer Polizei, nur vereint in einem Punkt: Resignation. Keiner zeigt auch nur den Ansatz eines Lächelns für die Kamera.
Ob es Streit gegeben hat? Wegen Fockra?
»Frauen an Bord bringen Unglück und Mord«, heißt einer von tausend alten Seemannsaberglauben. Und selbst 1969, als man sich in der Küstenschifffahrt bestimmt für sehr fortschrittlich hielt, werden es manche Seeleute noch als böses Omen gewertet haben, wenn eine Frau zur Crew gehörte.
Ob es schon Diskussionen gegeben hatte, ehe sie in Antwerpen ausliefen? Und dann später, in der Sturmnacht, als sie endgültig festsaßen? Ob sie Fockra die Schuld gaben? Offen? Heimlich?
Hat Nanne geschrien: Ich hab euch gewarnt! Ich hab euch ja gewarnt? Und Walter, hat er mit der Faust auf den Tisch gehauen? Hat er den hysterischen Matrosen am Kragen gepackt und ihn an die Wand gedrückt, hat er gezischt: Du kleine Ratte, ich schmeiß dich über Bord, wenn du nicht dein Maul hältst! Haben sie sich geschlagen, ihrer Verzweiflung über die aussichtslose Lage handfest Luft gemacht? Hat der Kapitän eingegriffen, oder hat er vielleicht schweigend zugesehen, weil er insgeheim selbst dagegen gewesen war, die Frau des Steuermannes anzuheuern? Denn, ja, ganz ehrlich, wer war er denn, das Schicksal herauszufordern?
Und Fockra? Saß sie mit klopfendem Herzen zwischen taumelnden Töpfen und Suppenkellen unten in der Kombüse und jammerte: Vater unser im Himmel, mach, dass es nicht meinetwegen passiert ist!
Vielleicht. Vielleicht waren sie aber auch Freunde; erschöpfte Kollegen nach einer langen Nacht, ohne Schiff jetzt, dafür mit einem Haufen Probleme.
Wer kann schon sagen, was sie gemeinsam durchgestanden hatten. Durch wie viele Stürme die Fortuna av Rhaudermoor sie schon sicher geschaukelt hatte, ehe sie, kaum auf der Hälfte des Weges nach Örnsköldsvik, einsehen mussten, dass das Glück nur ein Name war und sie in Wahrheit gerade verließ?
Die Ebbe lässt schöne Trittsteine aus dem Wasser schauen, und ich springe mit großen Schritten von einem zum nächsten, um dem Wrack noch näher zu kommen. Es zieht an mir; hat schon an mir gezogen, seit ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal von ihm reden hörte, zufällig, und heute Morgen, als ich noch in der Küche saß und mir für den Tag eine Thermoskanne mit Tee vorbereitete, da rief es: Komm, komm. Schau dir an, was werden kann.
1917. Als die Fortuna vom Stapel lief, war meine Großmutter fünf Jahre alt und spielte mit ihrer Zwillingsschwester vierhändig auf dem Klavier die Ode an die Freude. Ihr Vater, der Alte Pundt, erhielt laut Marineverordnungsblatt vom 1. Juli den Charakter eines Korvettenkapitäns, obwohl er offiziell bereits außer Dienst war, und wurde eingezogen. Nach drei Jahren endlosen Schlachtens ging dem Krieg langsam die Puste aus, und es wurde jede verfügbare Einsatzkraft gebraucht, selbst die eigentlich Ausgemusterten. Glück und Hoffnung waren in diesen Tagen so selten geworden, dass die Taufe eines Schiffes auf den Namen Fortuna wie ein Pakt mit dem Schicksal erscheint. Er hat lange gehalten, aber nach gut fünfzig Jahren, an jenem stürmischen Oktobertag 1969, verlor er seine Gültigkeit.
Seither stirbt die Fortuna, von der Welt vergessen, an diesem alten Strand ihren langsamen Tod und erfüllt immerhin noch den einen Zweck: in ihrem Verfall die Zeit sichtbar zu machen, die ansonsten weitgehend unbemerkt über die silbergrau schimmernde Steinlandschaft zieht.
Auf einem Felsstück im Wintermeer balancierend, was weder klug noch sinnvoll und dennoch unumgänglich ist, strecke ich den Arm, die Hand, die Finger aus, mache mich lang, ganz lang, um das hundert Jahre alte Eisen zu berühren. Vergeblich. Ein paar Meter fehlen mir.
Arm z’kurz!, höre ich die Stimme meines Vaters und sehe vor mir, wie er sich dabei belustigt mit dem Zeigefinger an die Wange tippt – als könnte seine Hand die Schläfe nicht erreichen, um mir einen Vogel zu zeigen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um diesen Witz zu verstehen. Gut möglich, dass darüber meine Kindheit vergangen ist.
Eine siebte Welle spült mir Wasser und Tatsachen in den Schuh: Es ist Zeit.
Ich muss zurück zum Wagen, ehe ich zu frieren beginne, ehe die Sonne untergeht und das Ummichherum zu groß wird und ich zu klein. An den Rückweg habe ich, als ich losging, nicht gedacht, nur an das Wrack mit seiner sirenenhaften Anziehungskraft.
Ahoi, Fortuna!, brülle ich zum Abschied, so laut ich kann, dann stemme ich mich gegen den Wind, der mich kaum fortlassen will von hier und mir unablässig ins Gesicht beißt.
An den Kieshaufen im ehemaligen Kalksteinbruch, die sich weiß in den Himmel türmen, ducke ich mich für einen Moment hinter einen Fels, um Luft zu holen. Sie schmeckt nach Salz und Kalk. Knirscht mineralisch.
Aus dem Augenwinkel nehme ich ein Stück entfernt eine Bewegung wahr. Ich schiebe die Kapuze zur Seite. Da ist nichts. Nicht mal ein Vogel.
Als ich endlich ins Auto steige, schmerzen meine Wangen, meine Stirn, meine Zähne.