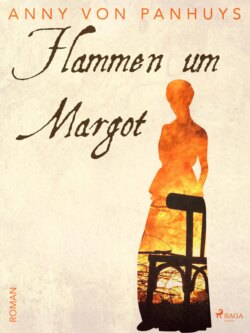Читать книгу Flammen um Margot - Anny von Panhuys - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеMargot saß in ihrem behaglichen kleinen Wohnzimmer im ersten Stock. Die Fenster gingen nach hinten hinaus in den nicht besonders umfangreichen Park, der noch ein Stückchen Föhrenwald mit einschloß. Ihr Vorfahre, jener Werner, der das Nonnenhaus von der Stadt gekauft, hatte auch den Park anlegen lassen. Und er war schön und eigenartig geworden. Margot liebte ihn und erging sich gern in ihm. Sie verspürte auch jetzt Lust, ein wenig unten herumzuspazieren. Aber Klein-Hedi sollte mit hinunter in Sonne und Luft.
Sie rief nach Betty; doch diese kam nicht gleich, und so suchte Margot das Kinderzimmer auf.
Sie fand Klein-Hedi auf dem Teppich sitzend und vergnügt mit ein paar Wolltieren spielen, daneben Betty anscheinend ganz geistesabwesend und in Tränen gebadet.
Margot näherte sich ihr, hüstelte. Das Kind hob das Köpfchen, krähte jauchzend: Mama!
Erschreckt fuhr Betty zusammen, erhob sich sofort und versuchte mit dem Taschentuch die Tränenspuren zu verwischen, was ihr aber nicht gelang und auch zwecklos gewesen wäre, denn Margot hatte sie weinen sehen.
Die blonde Frau nahm das Kind auf den Arm, ließ sich auf einen Stuhl nieder und fragte teilnehmend:
„Was für Kummer haben Sie, Betty? Es fällt mir schon seit Tagen auf, daß Sie sehr verstört sind. Hat es irgendein Unglück in Ihrer Familie gegeben?“
Betty versuchte zu lächeln, aber es mißlang jämmerlich.
„Nein, gnädige Frau, und mir fehlt auch nichts. Ich bin eben mal in trauriger Stimmung, ich — bin —“
Sie stockte, und jedes weitere Wort erstarb in Schluchzen.
Margots Rechte streichelte sanft das Köpfchen des Kindes, das sich so vertrauend an ihre Brust drückte und entgegnete sanft:
„Es handelt sich bei Ihnen nicht nur um eine vorübergehende traurige Stimmung, sondern um mehr. Ich will nicht in Sie dringen, Betty; aber Sie tun mir leid, und wenn ich Ihnen helfen kann, ich bin gern bereit dazu.“
Betty war völlig zerrüttet, seit sie erfahren, Fred von Lindner war bei dem Brande, den er so sorgfältig vorbereitet, umgekommen. Sie litt wahre Folterqualen, weil sie zu niemand, zu keinem einzigen Menschen darüber sprechen durfte. Oft glaubte sie wahnsinnig werden zu müssen von dem Ansturm der entsetzlichen Gedanken.
Wie so ganz anders war alles beabsichtigt gewesen! Das Feuer sollte Fred Lindner zu einer guten Versicherungssumme verhelfen, mit der er die böse drängenden Gläubiger abfinden und billig wieder aufbauen wollte. Später, nachdem die Scheidung mit der blonden Frau ausgesprochen, hätte er sie dann geheiratet.
Aber nun war das über alle Maßen Gräßliche geschehen. Der Mann, den sie anbetete, war ein Opfer seiner Tat geworden. Überall, wo sie ging und stand, sah sie Flammen — hochschlagende, grelle Flammen — und sah den schlanken Mann in der Lohe, sah, wie die furchtbaren Flammen ihn vernichteten.
Gräßliche Bilder zeigte ihr die erregte Phantasie.
Margot wiederholte:
„Liebe Betty, wenn ich Ihnen helfen kann, bin ich gerne bereit dazu.“
Betty lachte rauh auf, und unbeherrscht drängte es sich über ihre Lippen:
„Sie wären die allerletzte, die mir helfen könnte!“ Erschrak jedoch alsbald selbst und stammelte: „Verzeihung, gnädige Frau, ich meinte natürlich nur, mir kann niemand helfen, auch Sie nicht.“
Margot aber hatte der Satz Bettys, sie sei die allerletzte, die ihr helfen könnte, plötzlich die Augen geöffnet. Sie sah das Mädchen lange an und ihr fiel erst jetzt richtig auf, wie hübsch es war mit den großen dunklen Augen, dem dichten, dunklen Haar — wie vorteilhaft sie die tadellose volle Figur zu kleiden verstand, trotz aller Einfachheit.
Sie vermochte im ersten Moment der Erkenntnis kaum zu sprechen, dann aber drückte sie das Kind fest an sich und sagte leise:
„Mein Mann hat vielen hübschen Mädchen von Liebe geredet, doch sein Herz war niemals dabei. Vielleicht hat er Ihnen dasselbe gesagt wie alle den anderen. Ich glaube Sie zu verstehen.“
Betty erwiderte mit blitzenden Augen:
„Er hat mir bestimmt nicht dasselbe gesagt wie den anderen! Ich galt ihm mehr! Er wollte mich heiraten!“
Ihr war gleich, was nun kam, aber sie konnte nicht auf sich sitzen lassen, daß sie Fred Lindner nicht mehr gegolten als die vielen anderen Mädchen, mit denen er seine Frau betrogen.
Margot brachte auf diese Antwort sogar ein schwaches Lächeln fertig; auch ihre Stimme ließ keine Erregung merken. Sie hatte ja ihre Liebe schon längst zu Grabe tragen müssen, lange, bevor der unselige Mann eines so furchtbaren Todes starb. Sie antwortete:
„Ich möchte Ihnen keine Illusionen rauben, Betty. Denken Sie an Fred Lindner so gut, wie Sie nur können, es gibt nicht allzu viele, die das tun. Aber ich glaube, es ist doch ratsam, wir beide trennen uns.“
Betty starrte ganz entgeistert auf die Herrin und schrie dann auf:
„Nein, nein! Nur das nicht!“ Sie stürzte auf die Knie, rang die Hände: „Verzeihung für meine dummen Reden, gnädige Frau, Verzeihung für alles! Aber schicken Sie mich nicht fort. Ich kann nicht leben ohne das Kind. Klein-Hedi ist doch sein Kind, ist ein Stück von ihm, und wenn ich es hergeben, es nicht mehr täglich sehen soll, gehe ich zugrunde. Es ist ja gar nicht auszudenken, wie das werden sollte.“
Über Margots Gesicht glitt es wie Mitleid, und Mitleid gab ihr auch die Antwort ein:
„Sie brauchen ja nicht sogleich fort, Sie haben Zeit, sich nach einer guten neuen Stelle umzusehen. Ich werde Ihnen ein ausgezeichnetes Zeugnis ausstellen, das Sie als Kinderfräulein ja auch verdienen.“ Dann wurde ihr Ton hart: „Daß Sie mich mit meinem Mann hintergingen, war häßlich von Ihnen, aber ich vergebe Ihnen, weil Sie an Klein-Hedi hängen.“
Betty erhob sich von den Knien. Was lag ihr an der Vergebung der blonden Frau? Nichts, gar nichts! Bei dem Kinde wollte sie bleiben. Nur darauf kam es ihr an. Aber sie dachte nicht daran, sich nochmals zu demütigen vor der Frau, für die sie niemals Zuneigung und schließlich nur Haß empfunden. Und sie haßte sie nach Fred Lindners Tod noch mehr.
Diese blonde Frau durfte wenigstens seinen Namen tragen, den Namen, auf den sie selbst sich so sehr gefreut, aus Liebe, aber auch aus Ehrgeiz. Diese blonde Frau hatte hinter seinem Sarge hergehen dürfen; sie aber hatte nicht einmal daran zu denken gewagt, heimlich und von ferne der Feier beizuwohnen. Diese blonde Frau war die Mutter seines Kindes, war reich und sie — war ein Nichts, ein Niemand!
Sie ballte die Hände und drückte die Fingernägel fest in das Fleisch, um den Zorn zu unterdrücken, der sich aus ihrer Brust lösen wollte. Leidlich beherrscht antwortete sie:
„Ich werde also in zwei Wochen das Haus verlassen, gnädige Frau.“
Margot neigte den Kopf und erhob sich.
„Es ist gut, Betty, und nun soll dieses Thema von eben nicht mehr zwischen uns berührt werden, bitte. Ich will in den Park gehen und nehme das Kind mit. Ziehen Sie Hedi das weiße Mäntelchen an.“
Betty holte das Mäntelchen herbei und zog es der Kleinen in so netter spielerischer Art an, trieb dabei so zärtlich Scherz mit dem Kind, daß Margot überlegte, sie hätte Betty eigentlich doch nicht entlassen sollen. Eine ähnliche Pflegerin für Hedi fand sie kaum wieder. Mit dem Tod ihres Mannes war doch all der Unfug zu Ende. Wie vielen anderen Mädchen mochte der leichtsinnige Mensch die Ehe versprochen haben unter Hinweis auf seine bevorstehende Scheidung!
Aber eben hoben sich Bettys Lider. Ihr Blick, der kurz zuvor noch auf dem Gesicht des Kindes gehaftet, richtete sich jetzt auf Margot — dunkel, haßerfüllt.
Diese erschauerte vor dem Blick und dachte gequält, sie würde froh sein, wenn die zwei Wochen, die Betty noch blieb, vorüber waren.
Schnell verließ sie mit Klein-Hedi das Zimmer.
Und während sie das Kind durch den Park trug, es ab und zu auch ein Weilchen gehen ließ, es sorgsam vor dem Fallen schützend, dachte sie an Betty — wie falsch sie gewesen, als sie sich nach dem Sühnetermin noch erkundigt, ob die Scheidung nun bald erfolgen würde. Sie hatte die Frage für Teilnahme gehalten, und doch war sie nur der Selbstsucht entsprungen.
Die Köchin kam ihr in den Park nach.
„Gnädige Frau, zwei fremde Damen sind da, die Sie dringend sprechen wollen.“
Sie reichte Margot eine Karte, auf der stand: Ludwiga Zeidener, Berlin, Alexanderstraße 40.
Margot übergab der Köchin das Kind.
„Bringen Sie Hedi zu Betty, bitte. Ich werde zu den Damen gehen.“
„Sie sind unten im Empfangszimmer, gnädige Frau!“ rief Marie der schnell Davoneilenden nach, die sich nach einem Kuß auf die Stirn des Kindes entfernt hatte.
*
Margot ging erst in ihr Zimmer, bürstete noch einmal ihr leichtgewelltes kurzes Blondhaar, wusch sich die Hände und trank ein Glas Wasser zur Beruhigung, denn die Unterhaltung mit Betty schwang doch noch erregend in ihr nach.
Sie grübelte flüchtig darüber nach, was die fremden Damen, deren Namen sie bisher niemals gehört, von ihr wollen könnten, stieg die Treppe hinunter und stand bald vor der Tür des sogenannten Empfangszimmers, das wohl der am schönsten ausgestattete Raum des alten Nonnenhauses war. Er enthielt mit wertvollem Gobelinstoff überzogene Polstermöbel, köstliche alte Truhen und Kirchenschränke und vor allem kostbare Bilder von berühmten alten Malern.
Als Margot eintrat, drehten sich zwei Damen nach ihr um, die an einem Fenster standen — eine sehr dicke Frau, Mitte der Vierzig, und ein Mädchen von etwa zwanzig — beide schwarz gekleidet — die Gesichter von derbem Schnitt.
Margott trat näher und sagte einfach:
„Mein Name ist Margot von Lindner. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen, und mir mitzuteilen, was Sie zu mir führt?“
Die Besucherinnen setzten sich, und Margot ließ sich ebenfalls nieder. Sie saß nun zwischen den beiden. Der Älteren schien der Anfang schwer zu fallen, doch nachdem sie ihn einmal gefunden, rauschte ein Wortschwall auf, dem kein Einhalt geboten werden konnte, und Margot saß da, mußte anhören, was ihr neue Pein schuf.
Noch hatte sie die Enttäuschung mit Betty nicht verwunden, als schon wieder neuer Ärger, neue Aufregung ihr nahten.
Die Frau saß plump und gewichtig in ihrem Sessel und gestikulierte lebhaft. Ihre Hände schienen alles, was sie sagte, zu unterstreichen. Ihr Organ war hart und blechern.
Margot hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, aber sie mußte alles anhören, denn in dem, was ihr wie ekler Klatsch erschien, war ihr Mann wieder die Hauptperson.
Frau Zeidener erzählte gell und keifend:
„Herr von Lindner war mit meiner Tochter Ida verlobt.“ Sie zeigte auf das Mädchen, das verweint aussah und wiederholte: „Er war mit ihr verlobt. Ganz zufällig lernten wir ihn kennen — bei einem Jazzkonzert — und aßen dann zusammen in einem feinen Restaurant am Kurfürstendamm. Ich lud Herrn von Lindner ein, weil er uns gut gefiel und so unverheiratet aussah. Ich dachte gleich, er wäre so‘n Mann, wie ich ihn mir für mein Idelchen wünschte. Na ja, und dann haben wir uns öfter getroffen, und er kam auch zu uns in die Wohnung. Er hatte uns von seinem Gut erzählt und, daß er sehr unglücklich verheiratet wäre, daß seine Frau so schrecklich viel Geld verbrauchte und schon fast sein ganzes Vermögen verjuxt hätte. Daß er sich jetzt aber eine Frau wünschte wie mein Idelchen.
Das war nun ganz nach unserem Geschmack, denn Idelchen hatte sich mächtig verknallt in den schönen Mann. Ich auch, ich genau so! Und er erzählte, er läge schon seit langem mit seiner Frau in Scheidung, die bald ausgesprochen werden müßte. Dann wollte er wieder heiraten, aber diesmal nicht so unüberlegt. Danach lud er uns ein, wir sollten uns sein Gut einmal ansehen, und das haben wir auch getan, Idelchen und ich. Im Schloß, nach dem Kaffee, hat er mich gleich um Idelchens Hand gebeten, und Idelchen hat gestrahlt und war glücklich. Aber die Verlobung müßte vorläufig noch geheim bleiben, verlangte er, weil er doch noch nicht geschieden wäre. Darauf gingen wir ein, und weil er das Gut wieder etwas hochbringen wollte, wie er erklärte, gab ich ihm hunderttausend Mark in bar.
Doch mit einem Male hörten Idelchen und ich nichts mehr von ihm. Also fuhr ich mit ihr nach Lindenhof, und da erfuhren wir dann Schreckliches.“
Ida Zeidener fing an zu weinen, und ihre Mutter zeterte:
„Wir hörten Dinge, die wir erst nicht glauben wollten und doch glauben mußten. Ein Filou ist der saubere Herr gewesen, ein Mädchenjäger schlimmster Sorte, ein Geldvertuer und Liederjahn. Und Sie wären so was wie ‘n Engel, machte man uns klar. Er soll ja das Gut an allen vier Ecken angesteckt haben, und manche behaupten, er hätte den Tod im Feuer gesucht, weil er nicht mehr ein und aus wußte — allerdings, er wäre unfreiwillig mitverbrannt. Ist ja auch gleich, er ist jedenfalls ein Lump gewesen. Von dem Titel fegt ihn auch das Feuer nicht sauber.“
Endlich machte die Erregte eine Pause, und Margot hätte sprechen können. Aber jetzt war es ihr nicht möglich. In ihr war alles so wund, und ihr war es, als müsse sie sich selbst noch Schmerzen zufügen, wenn sie jetzt redete.
Inzwischen hatte die andere auch schon wieder Atem geschöpft, und die Sätze schnurrten weiter, als würde der Mund von einem Uhrwerk bewegt.
„Ich bin auf den Schwindler, Ihren Mann, reingefallen und mein Idelchen auch. Jetzt verstehe ich, wie dumm wir beide waren! Schon am ersten Tag haben wir dem Menschen unsere Verhältnisse erzählt. Er konnte ja alles so geschickt aus uns dummen Weibern herausholen. Ich erzählte ihm, daß mein Mann Bauunternehmer gewesen und uns eine halbe Million an Werten hinterlassen hatte. Die Auskunft genügte ihm wohl schon, seinen Plan zu machen, wie er uns schröpfen könnte. Ich blöde Gans gab dem Erstbesten, bloß weil er ein schöner Mann war und einen adligen Namen trug, bare hunderttausend Mark!“
Sie entnahm ihrer Handtasche ein Taschentuch, drückte es gegen die Augen.
„Den fünften Teil unseres gesamten Vermögens gab ich ihm, und nun muß ich dem Geld nachlaufen.“
Sie sah Margot fast herausfordernd an.
„Sie sind reich, hörte ich bei meinen Erkundigungen. Da ist es wohl nicht mehr als recht und billig, daß Sie mich schadlos halten, daß Sie für das Geld aufkommen.“
Jetzt hatte Margot sich wieder in der Gewalt und erwiderte kühl und zurückhaltend:
„„Ich kenne Sie nicht und brauche das, was Sie mir mitteilten, nicht zu glauben.“
Die Frau antwortete auftrumpfend: „Ich erhielt eine Art Quittung von ihm.“
Sie holte ein Stück Papier aus der Handtasche und reichte es Margot.
Diese las:
„Von meiner lieben zukünftigen Schwiegermutter, Frau Ludwiga Zeidener, erhielt ich heute hunderttausend Mark.
Fred von Lindner.
Lindenhof, den 8. Mai 1949.“
Margot erkannte sofort die Handschrift ihres Mannes und sagte:
„Er hat, wie ich aus dem Datum schließe, das Geld also erst zwei Tage vor seinem Tode erhalten?“
Die Frau nickte.
„Idelchen und ich brachten es ihm nach Lindenhof. Er war sehr vergnügt an dem Tage, fast übermütig, und Idelchen war so sehr, sehr glücklich.“
Sie stöhnte laut auf. „O, wenn wir an dem Tage geahnt hätten, mit was für ‘ner Sorte von Mensch wir zu tun hatten!“
Margot gab hart zurück:
„Wenn Ihnen am Glück Ihrer Tochter lag, hätten Sie sofort, nachdem Fred Lindner behauptet, Ihre Tochter zu lieben, Erkundigungen über ihn einziehen müssen, anstatt die Schwiegermutter eines verheirateten Mannes zu spielen. Er hat Ihnen ja nicht verhehlt, daß er noch nicht geschieden war. Mich geht die ganze Sache nichts an, und ich meine, damit ist unsere Unterredung zu Ende.“
Die Frau zog die Brauen hoch.
„Nein, nein, so geht das nicht! Da Ihr Mann schon zwei Tage nach dem Erhalt des Geldes umkam, ist nicht anzunehmen, daß er es noch verbrauchte. Er schloß das Geld in unserer Gegenwart in einen alten Schrank, der sich nur auf umständliche Art öffnen ließ. Dort wird es sich also wahrscheinlich noch befinden, und weil Sie die Erbin sind, muß ich mich an Sie wenden.“
Margot zuckte die Achseln.
„Ich habe nur Schulden von meinem Manne geerbt; der Grundbesitz ist mit Hypotheken vollständig überlastet, und wenn er das Geld in den betreffenden Schrank schloß, ist bestimmt nichts mehr davon vorhanden.“ Sie betonte den nächsten Satz: „Das Arbeitszimmer Fred Lindners ist beinahe ausgebrannt; jedenfalls ist der Schrank mit allem, was darin war, den Flammen zum Opfer gefallen. In dem Zimmer kam auch Fred Lindner um. Vielleicht hat er gerade das Geld retten wollen.“
Sie vermied nach Möglichkeit, ‚mein Mann‘ zu sagen.
Idelchen weinte jetzt ganz laut; sie zwängte hervor:
„Fred tut mir wirklich so schrecklich leid — und das Geld auch.“
Margot erwiderte achselzuckend:
„Ich habe in meiner Ehe schon Unsummen hergegeben für ihn. Ich denke nicht daran, mich ganz zur armen Frau machen zu lassen. Ich habe Verpflichtungen gegen mein Kind.“
„Und ich Verpflichtungen gegen mein Kind“, gab die Frau zurück und hatte mit einem Male ganz rabiat funkelnde Augen, „Jawohl, Frau von Lindner, so ist es. Und deshalb kann ich mich mit Ihrer Weigerung nicht zufrieden geben. Ich will mein gutes Geld, und wenn ich es nicht bekomme, mache ich einen Mordsskandal. Ich blamiere den Toten, blamiere Sie und erzähle jedermann, was Ihr Mann für‘n Kerl gewesen. Ich kann beschwören, dem Lumpen das Geld gegeben zu haben, und ob das Geld wirklich mitverbrannt ist, weiß keiner. Sie können es ja wo anders als im Schrank gefunden haben. Er kann es ja später rausgenommen haben. Und die Schande, sich an unserem Geld bereichert zu haben, bleibt dann an Ihnen haften. Ich laufe zu einem tüchtigen Rechtsanwalt und klage gegen Sie als Erbin des Toten. Dem Filou kann man nichts mehr tun, aber Sie dürften noch so viel Ärger erleben, daß Sie bereuen werden, das Geld nicht freiwillig gezahlt zu haben.“
Margot sah sofort ein, diese Frau konnte ihr unendlich viel Ärger bereiten; trotzdem wehrte sie ab.
„Nicht einen Pfennig erhalten Sie von mir! Tun Sie, was Sie wollen!“
Idelchen sprang auf und schlug mit der Faust auf den Tisch.
„Schämen Sie sich, meine Mutter betrügen zu wollen! Ich bin sicher, Sie haben das Geld gefunden und möchten sich damit bereichern.“
Margot zuckte es durch den Sinn. Wenn diese beiden unangenehmen Weiber ihre Auffassung hier im Städtchen laut werden ließen, lief der Klatsch hinter ihr her, wie ein häßliches Tier. Und wenn es zu einem Prozeß käme, würde sie überhaupt keine Ruhe mehr finden. Ihr graute davor, die Öffentlichkeit könne sich mit ihr beschäftigen, und sie fürchtete, wenn ihre Tochter groß geworden, schlüge vielleicht noch etwas von alledem an ihr Ohr — in irgendeiner häßlichen entstellten Form.
Um ihres Kindes willen mußte sie nachgeben.
Noch wußte man hier im Städtchen wohl nichts von dem Geschehenen, und wenn sie versprach, das Geld zu ersetzen, würden Mutter und Tochter nach Berlin zurückkehren. Sie hatten dann gar kein Interesse mehr daran, darüber zu Fremden zu reden; denn sie selbst hatten sich ja reichlich blamiert in der Sache.
Sie entschloß sich zu der Antwort:
„Ich möchte nicht, daß der Name, den ich trage, allzusehr durch den Schmutz gezogen wird. Ich will Ihnen deshalb das Geld ohne weitere Nachprüfung durch meinen Anwalt überweisen lassen, nachdem Sie sich einwandfrei ihm gegenüber ausgewiesen haben.“
Idelchen trocknete ihre Tränen.
„Sie scheinen ja vernünftig zu sein.“ Sie konnte schon lächeln. „Die Hunderttausend sind nämlich mein Heiratsgut, und ich brauche sie hoffentlich bald.“
Margot dachte, das Mädchen mit den gewöhnlichen Zügen würde sich rasch trösten und Fred Lindner bald vergessen haben, viel eher als Betty, viel eher!
Sie erhob sich.
„Ich habe nun leider keine Zeit mehr, meine Damen. Alles Weitere wird mein Anwalt für mich in Ordnung bringen. Er wird sich schon morgen mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich besitze ja Ihre Adresse.“
Schwerfällig erhob sich Ludwiga Zeidener.
„Es ist gut, und ich danke Ihnen auch, daß Sie uns vor Schaden bewahren wollen.“
„Sie vor Schaden zu bewahren, daran liegt mir nicht das geringste“, gab Margot trocken zurück, „aber ich möchte mich und mein Kind, obwohl wir beide nichts dafür können, nicht in neuen, eklen Kleinstadtklatsch hineinziehen lassen. Mein Kind soll nie erfahren, wie leichtsinnig sein Vater gewesen. Nur darauf kommt es mir an. Nur darauf!“
Sie öffnete die Tür, und die Besucherinnen gingen still und grußlos. Ein scheuer Blick der Jüngeren streifte die Herrin des Nonnenhauses.
Margot aber schlich sich in ihr Schlafzimmer, als hätte sie ein Unrecht begangen. Sie riegelte sich ein und warf sich verzweifelt über das Bett. Hatte Fred ihr denn noch nicht genug Böses und Häßliches im Leben angetan, mußte die Qual auch nach seinem Tode weitergehen?
Es war alles so widerlich, so ekelhaft!
Sie schluchzte in die Kissen hinein. Warum mußte ihr so viel Schmach geschehen? Wodurch hatte sie das verdient?
So glücklich war sie damals gewesen, als Fred von Lindner sie zum Altar geführt. Die strahlendste Braut auf Erden. Sie war in die Ehe getreten, wie ein Kind zum Gabentisch tritt am Heiligabend. In ihrem Herzen war nur Jubel gewesen. Aber bald — ach, so bald! — zerrann ein wunderschöner Traum! Der Mann ihrer Liebe, der Held ihrer Träume, war ein Selbstsüchtling, ein Komödiant, der in ihr nur das reiche Mädel gesehen, nichts weiter. Kurz war ihr Glück gewesen; bald war der Rausch verflogen, und immer häßlicher wurde die Ehe, so häßlich, daß es kein Weiter mehr gab. Sie verließ den Lindenhof.
Weit hinter ihr schien das alles schon zu liegen, und doch kam sie nicht frei aus dem schmutzigen Netz, das Fred von Lindners Treiben auch um sie geworfen. Er war tot; aber sie mußte weiter leiden.
Sie seufzte tief. So widerlich war alles, was mit Fred von Lindner zusammenhing.
Sie dachte, ob nun wohl Ruhe werden würde, wenn Betty aus dem Hause wäre und die Frauen, die eben bei ihr gewesen, das Geld wieder hätten — das Geld, von dem auch der Tote keinen Vorteil mehr gehabt.
Sie erhob sich und faltete die Hände. Mochte doch nun Ruhe werden, damit sie ein wenig vergessen konnte, was sie so gern vergessen wollte. Sie sehnte sich so nach Ruhe und Frieden — so von ganzem Herzen sehnte sie sich danach.
*
Es war eine wundervolle Frühlingsnacht, als Margot von einem Geräusch erwachte.
Sie dachte erst, Betty nebenan wäre vielleicht des Kindes wegen aufgestanden und wollte sie wecken. Sie machte Licht, doch sah sie, die Tür nach dem Schlafzimmer Bettys und des Kindes war geschlossen.
Eben hörte sie wieder ein leises Geräusch, aber es kam von der anderen Seite — aus ihrem Ankleidezimmer.
Sollte es sich um Diebe handeln?
Sie verwahrte nebenan in ihrem Ankleidezimmer ihren sehr wertvollen Schmuck, der sich in der Familie seit langem vererbte. Sie faßte in ihre Nachttischschublade, wo ständig ein kleiner Revolver lag.
Auf bloßen Füßen schlich sie sich an die Tür und spähte durch das Schlüsselloch. Drinnen hantierte jemand mit Licht herum, mit einer elektrischen Taschenlampe.
Leise öffnete Margot die Tür, und in diesem Augenblick drehte sich ein Mann um, der Margot noch eben den Rücken zugewendet.
Margot sah mit angstgeweiteten Augen und furchtbarem Entsetzen in das Gesicht ihres Mannes, an dessen Grab sie vor kaum zehn Tagen gestanden!
Das Herz lag ihr wie ein schwerer, drückender Stein in der Brust vor Schreck und Grauen. Sie mußte sich an der Türleiste festklammern, um nicht zu Boden zu sinken.
Sie zitterte; kalte Schauer jagten über ihren Körper hin. Wie Beten drängte es sich auf ihre Lippen, und doch war sie nicht imstande, einen Laut hervorzubringen.
Sie starrte regungslos auf den Mann, der nur durch wenige Schritte von ihr getrennt war. Endlich hatte sie die Kraft, das Wörtchen ‚du‘ zu flüstern. Halb erstickt klang es — schaudernd und fragend.
Der Mann antwortete nicht; aber er näherte sich ihr, sein Gesicht schien sich zur teuflischen Fratze zu wandeln.
Mit einem unwillkürlichen Angstlaut wich Margot zurück, wendete sich und wollte fliehen. Doch in der Hast stolperte sie und brach in die Knie. Ihr war, als müsse sich im nächsten Augenblick eine Hand auf ihre Schulter legen. Sie fürchtete irgend etwas Schreckliches, verharrte regungslos und barg das Gesicht in den Händen.
Doch nichts geschah, gar nichts. Alles um sie herum war totenstill und blieb totenstill. Die kleine Taschenlampe des Mannes war erloschen. Aber aus ihrem Schlafzimmer drang der Schein der Ampel, die über ihrem Bette hing.
Margot wartete mit tollem Herzklopfen ein paar Minuten. Doch als alles still blieb, wagte sie endlich den Kopf ein wenig zu drehen und zurückzuschauen. Obwohl sie ein wenig aufatmete, blieb ihr Herzschlag doch ungestüm. Der Mann war verschwunden, und doch hatte sie nicht gehört, daß er sich entfernte.
Sie fürchtete zuerst, er hätte sich versteckt; doch weil alles nach wie vor still blieb, erhob sie sich zögernd, schaltete das Licht ein und durchsuchte das Ankleidezimmer. Aber außer ihr befand sich niemand hier. Die Tür nach dem Flur war von innen verschlossen, das Fenster war fest geschlossen.
An ihr vorüber, in ihr Schlafzimmer, konnte der Mann nicht gegangen sein. Sie hatte ja mitten auf der Schwelle gekauert, und er hätte über sie hinwegsteigen müssen. Das aber würde sie gemerkt haben, trotzdem sie das Gesicht mit den Händen bedeckte. Ohne eine Berührung wäre das nicht abgegangen.
Sie stand in erregtes Nachdenken versunken da und überlegte, auf welche Weise so leise und spurlos Fred das Ankleidezimmer verlassen haben konnte.
So leise und spurlos, als wäre er überhaupt nicht dagewesen! Sie murmelte vor sich hin:
„Fred ist doch tot!“ Obwohl ihr jede Silbe Qual und Grauen verursachte, mußte sie sich doch sagen, daß der Mann, den sie eben gesehen, tot war.
Sie schwankte auf ihr Bett zu, ließ sich auf dem Rand nieder, beide Hände gegen die Schläfen pressend. Sie zwang sich, niemand zu rufen, denn man würde glauben, sie sei wahnsinnig geworden, wenn sie behauptete, eben ihren toten Mann gesehen zu haben — ihn, der verbrannt war, und an dessen Grab sie gestanden! Seit zehn Tagen ruhte das, was von ihm übriggeblieben, schon auf dem Friedhof des kleinen Dorfes, und doch hatte sie ihn vorhin so gesehen, wie sie ihn im Leben gesehen — so, wie sie ihn geliebt und dann so sehr verachtet hatte. Sie drückte beide Fäuste auf den Mund, um nicht doch noch laut aufzuschreien.
Es war ja auch entsetzlich, was sie erlebt! Ein Toter kehrte zurück, kam zu ihr, sah sie an. Gab es Geister? Konnten Tote aus dem Jenseits wiederkommen?
Bis jetzt hatte sie noch zu sehr im Banne des Schreckens gelegen; nun aber ward sie sich klar darüber, wie schauerlich und seltsam ihr Wiedersehen mit ihm gewesen, der aus dem Totenreich den Weg zu ihr gefunden.
Sie drückte den Kopf in die Kissen und dachte verzweifelt: Was soll ich tun? Irgendeinem Menschen mußte sie doch anvertrauen, was ihr begegnet; sie konnte es nicht allein mit sich herumtragen.
Draußen hatte sich ein starker Wind erhoben, und von den Föhren am Ende des Parkes kam einförmiger Singsang der Zweige, die sich hin- und herbewegten, sich aneinanderrieben. Das pfiff und knackte eigen und unheimlich. Margot, deren Nerven aufs äußerste gespannt waren, sprang hoch und riß die Tür zu dem Zimmer auf, in dem Betty und das Kind schliefen.
Der Raum lag in tiefes Dunkel gehüllt; aber schon wurde das Licht einer Nachttischlampe eingeschaltet. Betty richtete sich in ihrem Bett auf, blickte der Eintretenden mit großen, wachen Augen entgegen. Sie hatte noch nicht geschlafen, hatte nur daran gedacht, daß sie nun bald das Kind verlassen mußte — und an ihren Haß gegen die blonde Frau hatte sie auch gedacht. Hatte überlegt, ob sie ihr nicht noch irgendwie recht wehtun könne.
Als Margot von Lindner jetzt so plötzlich und mit allen Anzeichen großer Erregung bei ihr erschien, begriff sie nicht, was das bedeutete.
Sie erhob sich und warf den auf einem nahen Stuhl liegenden Morgenrock über. Doch sie fragte nichts, wartete eine Anrede Margots ab. Aber diese sprach nicht, ging nur auf das Bettchen des Kindes zu, fast, als beabsichtigte sie, Klein-Hedi in ihre Arme zu reißen.
Doch Betty stellte sich ihr abwehrend entgegen, flüsterte:
„Lassen Sie Hedi schlafen! Es wäre Sünde, das Kind aus seinem guten Schlummer zu wecken.“
Da ließ Margot die erhobenen Arme sinken.
Sie hätte nun wohl irgend etwas sagen, hätte irgendeinen Grund erfinden müssen, warum sie das Kind hatte wecken wollen — aber sie war am Ende ihrer Kraft. Viel spukhafter und rätselhafter noch schien ihr jetzt ihr Erlebnis als vorhin. Kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn; ihr Gesicht war fahl und farblos. Ihr ward schlecht; eine schreckliche Übelkeit quälte sie.
Betty fragte leise: „Sind Sie krank, gnädige Frau? Soll ich Ihnen Tee kochen oder eine Limonade zurechtmachen?“
Obwohl sie Margot von Lindner haßte, schoß ihr der Gedanke durch den Kopf: Wenn sie sich jetzt der Gehaßten gefällig erwies, durfte sie vielleicht im Hause bleiben — bei dem Kinde, an dem sie seit dem Tode Fred Lindners mit fanatischer Liebe hing. Sie bat:
„Kommen Sie in Ihr Schlafzimmer, gnädige Frau, damit Klein-Hedi nicht aufwacht.“
Sie faßte den linken Arm Margots, und die junge Frau ließ sich ohne Widerspruch hinüberführen und zu Bett bringen. Sie zitterte jetzt wieder vom Kopf bis zu den Füßen.
„Ich werde den Arzt rufen, Sie haben Fieber, gnädige Frau“, sagte Betty und zog Margot die seidene Steppdecke bis zu den Schultern empor.
Jetzt erst öffneten sich die Lippen der blonden Frau.
„Bitte, gehen Sie nicht aus dem Zimmer, Betty! Ich fürchte mich grenzenlos so allein. Ich kann nicht allein bleiben in dieser Nacht!“
Eben schlug es eins auf der alten Uhr unten im Eßzimmer, die immer in so gellem, erregendem Ton die Stunden verkündete.
Margot zuckte zusammen, hauchte: „Von zwölf bis eins ist Geisterstunde!“
Betty schüttelte befremdet den Kopf. Was fehlte nur der Frau? Sie machte fast den Eindruck einer Geistesgestörten. Ihr wurde unheimlich zumute, obwohl sie keine ängstliche Natur besaß.
Sie zwang sich, recht freundlich zu sprechen.
„Ich will ja nur die Köchin wecken oder das Hausmädchen. Und der Chauffeur soll zum Arzt fahren und —“
„Und damit wäre dann glücklich das ganze Haus alarmiert“, fiel Margot ihr ins Wort, „und gerade das möchte ich doch vermeiden.“ Sie blickte Betty mit flimmernden Augen an. „Ich will nicht, daß noch jemand außer Ihnen zu mir kommt. Ich will niemand weiter sehen. Ich — ich —“
Sie schluckte und konnte nicht weiterreden. Das Grauen von vorhin war wieder da und saß ihr würgend im Halse.
Betty war fest entschlossen, die anderen Dienstboten doch zu wecken; denn sie fürchtete sich jetzt vor der jungen Frau. Diese benahm sich so befremdend, so unbegreiflich. Man konnte an ihrem Verstand zweifeln, und es war wohl nicht ratsam, mit ihr allein zu bleiben.
So wagte sie denn zu widersprechen:
„Gnädige Frau, Sie sind krank! Der Arzt ist nötig.“
Die blonde Frau, deren Nerven keine Widerstandskraft mehr besaßen, verlor den letzten Rest von Besinnung. Es war völlig aus mit ihrer Beherrschung, und sie gab keuchend vor Erregung zurück:
„Sie sollen mich nicht allein lassen! Ich kann doch nicht hier allein bleiben, denn nebenan, in meinem Ankleidezimmer, habe ich eben Fred Lindner gesehen!“
Betty wich schnell einen Schritt zurück, jetzt fest überzeugt, daß Margot von Lindner den Verstand verloren hatte.
Sie holte hörbar Luft und stieß rauh hervor:
„Sie haben vergessen, gnädige Frau, daß Herr von Lindner tot ist!“
Margot richtete sich halb im Bett auf. Ihr bedeutete es in diesem Augenblick eine förmliche Erleichterung, über ihr Erlebnis sprechen zu dürfen, und es war ja nun auch schon zu spät, etwas zurückzunehmen. Sie antwortete hastig:
„Ich habe natürlich nicht vergessen, daß er tot ist. Wenn ich das vergessen hätte, wäre ja alles gar nicht so schlimm! Vor einem Lebenden kann man sich doch nicht so fürchten wie vor einem Toten.“ Sie zeigte nach links. „Da in meinem Ankleidezimmer ist er gewesen und hat eine Taschenlampe gehabt. In dem Schein sah ich deutlich sein Gesicht —“
Betty wurde immer unheimlicher zumute.
„Aber gnädige Frau, ein Toter und eine Taschenlampe, das paßt doch nicht zusammen!“
Margot drückte die Rechte gegen die schmerzende Stirn, hinter der die wirren Gedanken durcheinanderwogten.
„Nein, ein Toter und eine Taschenlampe passen nicht zusammen, aber ich sah ihn doch damit. Dann aber war er plötzlich fort, das Licht erloschen.“
Betty ging in das Ankleidezimmer, rief zurück:
„Hier ist aber wirklich niemand.“
Margot gab Antwort:
„Das weiß ich ja; er war vorhin schon verschwunden. Ich sagte es doch!“
Aus dem Zimmer nebenan ertönte ein schwacher Schrei. Margot preßte die Lippen fest aufeinander. Was war geschehen? Sah Betty vielleicht auch den unheimlichen nächtlichen Besucher?
Im nächsten Augenblick aber betrat das Mädchen wieder das Schlafzimmer und erklärte lächelnd:
„Ich bin von Ihnen angesteckt worden, gnädige Frau, und glaubte zu sehen, was Sie sahen. Doch es war nur Ihr Bademantel, der am Kleiderhaken hängt und mich erschreckte. Ihre Phantasie hat Ihnen einen Streich gespielt. Ihre Nerven sind eben anscheinend sehr herunter. Ich werde bei Ihnen bleiben heute nacht, mich auf die Couch legen, aber ich will zuvor noch Hedis Bettchen hereinrollen.“
Margot empfand den überlegenen Ton Bettys wie eine Kränkung. Vorhin war der Ton anders gewesen. Jetzt hatte es fast den Anschein, als mache Betty sich über sie lustig.
Das empörte Margot, und sie erwiderte, sich zusammenreißend:
„Sicher hat mir meine Phantasie einen Streich gespielt. Sie können ruhig wieder in Ihr Bett gehen, denn ich finde mein eingebildetes Erlebnis auch schon komisch und kann selber darüber lächeln.“
Betty machte zwar sehr erstaunte Augen; doch sie ging sofort, zog die Tür hinter sich zu. — —
Margot erhob sich wieder von ihrem Lager. Ihr Gesicht sah nicht aus, als könne sie schon über den sonderbaren Vorfall von vorhin lächeln, wie sie doch zu Betty gesagt. Im Gegenteil, sie sah sehr ernst aus.
Sie ging jetzt noch einmal ins Ankleidezimmer und durchsuchte es gründlich. Sie drückte dabei auch noch einmal unwillkürlich auf die Klinke der Tür, die vom Ankleidezimmer auf den Gang hinausführte. Sie tat es wirklich nur gedankenlos, denn sie wußte ja genau, sie hatte vorhin die Tür verschlossen.
Sie erschrak aufs neue, denn die Tür gab nach, öffnete sich. Margot stand sekundenlang wie angewurzelt da, dann aber drehte sie schnell den Schlüssel herum. Die Tür mußte von jemand aufgeschlossen worden sein, nachdem sie selbst vorhin das Zimmer verlassen.
Wer aber konnte es getan haben? Wer konnte von innen aufgeschlossen haben? Doch nur eine Menschenhand! Denn Geistern gebieten verschlossene Türen keinen Halt.
Sie dachte mit einem Male ganz nüchtern. Ihre Phantasie hatte ihr vorhin wirklich einen Streich gespielt. Ein ganz gewöhnlicher Einbrecher, der eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrem Manne besaß, hatte sie so aufgeregt. Sie hatte den Toten zu sehen geglaubt und sich töricht benommen, anstatt laut um Hilfe zu rufen. Inzwischen war der Mensch entkommen, der sich doch noch hier im Ankleidezimmer versteckt gehalten, solange sie darin gewesen. Sie wurde sich plötzlich auch darüber klar. Hinter dem Kachelofen in der Ecke mußte er gewesen sein.
Dahinter hatte sie vorhin keinen Blick geworfen.
Jetzt erst öffnete sie das kleine, geschickt in der Wand angebrachte Schränkchen, das sich hinter einem Bildteppich barg, und nahm den Lederkasten heraus, der den wertvollen alten Familienschmuck enthielt.
Ihre Finger drückten gegen den Knopf des Schlosses, und als der Deckel sich heben ließ, sah Margot, der Kasten war leer, kein Stück des prachtvollen Schmuckes war mehr vorhanden. Fort waren das Kollier und das Armband, fort die Ohrgehänge und der herrliche Ring. Kein Stein des köstlichen, eigenartigen Geschmeides aus Smaragden, Goldtopasen und Brillanten blitzte ihr mehr entgegen.
Ihr erster Gedanke, der dem Schmucke galt, als sie von dem Geräusch nebenan erwachte, war doch der richtige gewesen.
Sie warf einen Mantel über, riß die Tür zu dem Schlafzimmer Bettys auf, winkte ihr, die noch nicht wieder zur Ruhe gegangen.
Als Betty eintrat, rief sie ihr entgegen:
„Der Chauffeur soll sofort geweckt werden; er muß das Haus durchsuchen. Mir ist Schmuck von großem Wert gestohlen worden!“
Bettys Augen blitzten sie an, als wollte sie rufen: Es freut mich, daß du Schaden hast! Sie sagte aber statt dessen sehr ruhig:
„Sie sollten bis zum Morgen warten, gnädige Frau. Wenn wirklich ein Dieb hier war, ist er doch schon längst über alle Berge.“
„Stefan soll aufstehen, ich wünsche es“, erwiderte Margot fast heftig.
Betty sah sie spöttisch an.
„Ich bin hier als Kinderfräulein engagiert worden und nicht dazu da, auf die Gespensterjagd zu gehen und nachts den Chauffeur zu wecken.“
Margot war sprachlos über das Benehmen Bettys, die ihr vorhin doch noch zugeredet hatte wie einem kranken Kinde. Sie erwiderte zornig:
„Sie sind reichlich unverschämt. Es ist gut, gehen Sie.“
Sie klingelte, daß es grell durch das ganze Haus klang, öffnete die Tür, rief laut nach der Köchin und dem Zimmermädchen, rief immer wieder. Die Köchin kam zuerst, sie alarmierte den Chauffeur.
Das Kind war nun doch erwacht; es schrie ängstlich auf. Margot eilte zu ihm, nahm es aus dem Bettchen, beruhigte es und bettete es bei sich. Sie mochte es jetzt nicht mehr bei Betty lassen, es schien ihr irgendwie gefährlich.
Sie hörte, wie Betty sich einschloß.
Im Haus wurde niemand gefunden. Als der Morgen graute, telefonierte Margot die Polizei im Städtchen an. Der Kommissar kam selbst, brachte einen Beamten mit. Margot erzählte ihm genau, was geschehen war, und von der großen Ähnlichkeit des Diebes mit ihrem toten Mann. Sie setzte aber nachdenklich hinzu:
„Es ist freilich möglich, daß die Ähnlichkeit gar nicht so groß war und meine Nerven mich etwas getäuscht haben.“
Das Haus wurde noch einmal gründlich untersucht; aber man fand nirgends Spuren, daß ein Einbrecher dagewesen. Vor allem blieb rätselhaft, auf welche Weise er ins Haus gelangt sein sollte. Es war kein Laden ausgehängt, keine Scheibe eingedrückt oder zerschnitten, der Dieb mußte sich schon am Tag ins Haus geschlichen haben.
Margot hätte alles für einen wüsten Traum gehalten, hätte nicht das leere Lederkästchen den Gegenbeweis geliefert.
Als die Polizeileute im Auto fortgefahren, war es Mittag. Margot ließ jetzt Betty zu sich rufen. Sie befand sich in dem kleinen Wohnzimmer; das Kind saß auf einem weißen Fell und spielte mit allerlei bunten Bällen.
Betty trat ein, etwas Dreistes und Keckes in ihrem Gesicht.
Margot begann:
„Nach Ihrem Betragen in dieser Nacht möchte ich Sie ersuchen, noch heute, und zwar so bald wie möglich, das Nonnenhaus zu verlassen. Es ist besser für uns beide! Ich zahle Ihnen, damit Sie mir nicht mit Ansprüchen kommen können, den Lohn für ein Vierteljahr sofort aus. Auch habe ich Ihnen das Zeugnis ausgestellt, daß Sie als Kinderfräulein sich bewährten.“
Betty, die sich gestern nach der Kündigung so aufgeregt benommen, nickte heute gleichmütig.
„Ich werde sofort packen und hoffe, noch bis zum Abend fort zu können. Sollte es zu spät werden, gestatten Sie mir vielleicht, noch eine Nacht hier zu schlafen. Ich gehe dann morgen in aller Herrgottsfrühe.“
Margott nickte.
„Gut! Doch mit dem Kind haben Sie nichts mehr zu tun, ich wünsche es nicht.“
Eben streckte Klein-Hedi die Ärmchen nach Betty aus.
Betty erwiderte mit einem Blick auf das Kind:
„Ich muß mich fügen, gnädige Frau, Sie sind die Mutter.“
Margot sah, wie Betty die aufsteigende Rührung bekämpfte, dann aber trat sie an den kleinen Schreibtisch, nahm Geld und Zeugnis in Empfang und verließ schweigend das Zimmer, ohne das Kind noch einmal anzusehen, das nach ihr rief.
Das Hausmädchen mußte zunächst das Kind hüten, Margot wollte ins Städtchen, um gleich für Betty Ersatz zu suchen.
Die Stellenvermittlerin wußte sofort Rat.
„Meine Tochter Hilde ist achtzehn Jahre und hat eine gute Schulbildung, sie würde gern ins Nonnenhaus in Stellung gehen, gnädige Frau“, bot sie Margot an.
Tilde wurde gerufen. Sie gefiel Margot und konnte sogleich mit ihr fahren. Sie nahm nur das Notwendigste an Sachen mit; alles andere sollte der Chauffeur Stefan am nächsten Tage holen.
Klein-Hedi freundete sich rasch mit Tilde an und Margot konnte sich am Spätnachmittag ohne Sorge um das Kind ein wenig niederlegen. Sie war wie erschlagen von der gräßlichen Nacht und diesem lebhaften Tag. Sie hatte den Wunsch geäußert, man möge sie nicht ohne gewichtigen Grund wecken, und als Betty gegen Abend fortging, schlief sie.
Betty hatte sich telefonisch eine Autodroschke aus dem Städtchen bestellt und fuhr nun fort.
Die Köchin meinte zum Hausmädchen:
„Was mag es eigentlich zwischen der Gnädigen und Betty gegeben haben?“
Die andere zuckte die Achseln.
„Was geht es uns an?“
Die Köchin machte ein wichtiges Gesicht.
„Ich glaube, es muß was gespielt haben, was jetzt vielleicht erst herausgekommen ist. Ich will damit sagen, die Betty und der Mann von der Gnädigen —“
Sie brach ab und zwinkerte bedeutungsvoll mit den Augen.
Das Hausmädchen lächelte verstehend und erwiderte leise: „Ja, der Betty traue ich sowas bestimmt zu.“
Margot schlief fest und tief in den Abend hinein.
Das neue Kinderfräulein wurde von der Köchin beraten, die für Tilde das Bett neu bezog, in dem bis jetzt Betty geschlafen. Sie sprach im Flüsterton, denn das Kind schlief auch bereits. Tilde hörte aufmerksam zu, was ihr die Köchin zu sagen für nötig hielt.
Aber mitten in das etwas einförmige Flüstern ertönte ein lauter Schrei — ein Schrei, so wild und entsetzenerregend, daß Tilde beide Hände weit von sich streckte vor Schrecken, wie in Erwartung von etwas Furchtbarem.
„Um des Himmels willen, wer war das?“
Die Köchin hatte das Kopfkissen, das sie gerade in einen frischen, weißen Bezug stecken wollte, fallen lassen; es war ihren bebenden Händen entglitten.
Ehe sie zu antworten vermochte, sprang die Tür weit auf, und auf der Schwelle stand Margot von Lindner. Sie war totenblaß. Sie winkte der Köchin, die hastig folgte. Auch Tilde schloß sich an. Das Kind schlief ja fest.
Tilde war der Meinung, Frau von Lindner hätte den Schrei ausgestoßen, ihr wäre etwas geschehen.
Die beiden anderen achteten kaum auf die Gegenwart des jungen Mädchens, und Margot stöhnte laut:
„Haben Sie den Schrei gehört, Marie, den schauderhaften Schrei? Es klang so wie an dem Abend, an dem meine Mutter starb. Sie wurde getötet von dem entsetzlichen Schrei.“
Tilde horchte auf. Sie kannte, wie viele Bewohner des Städtchens, die Sage des Nonnenhauses. Sie verspürte ein wohliges Gruseln und malte sich schon begeistert aus, wie sie ihrer besten Freundin von dem Spuk, den sie erlebt, erzählen wollte.
Margot von Lindner sagte mit fliegendem Atem:
„Meine Mutter hat jung geheiratet, aber seit mein Vater sie hergeholt ins Nonnenhaus, bis zu dem Tage, als sie starb, hat sie die Schreie niemals gehört, und auch ich hörte sie niemals — doch jetzt —“
Sie verstummte, denn wieder gellte der markerschütternde Schrei auf. Schrill war er und doch voll Stärke. Er schien anzuschwellen und dann zitternd zu verklingen.
Alle drei sahen einander an, und Tilde fand es in diesem Augenblick gar nicht mehr so interessant, einen Spuk zu erleben. Dazu war so einer wie dieser doch zu unheimlich.
Das Hausmädchen stürzte ins Zimmer.
„Ich fürchte mich, gnädige Frau! Verzeihen Sie, aber im Nonnenhaus möchte ich nicht mehr bleiben.“
Margot hielt sich die schmerzenden Schläfen.
„Ich kann niemand zwingen, hierzubleiben.“
Das Hausmädchen unkte: „Wer weiß, wer diesmal im Nonnenhause sterben muß!“
„Raus, dumme Gans!“ kommandierte die Köchin. „Rege die gnädige Frau nicht noch mehr auf!“
Tilde hatte schon, von dem zweiten Schrei dazu gebracht, sagen wollen, sie möchte ihre Stellung aufgeben, aber sie schämte sich jetzt ihrer Angst, sie mochte sich nicht auch „dumme Gans“ nennen lassen.
„Ich kann mir nicht erklären, woher die Schreie kommen, aber sie sind doch nicht abzuleugnen“, meinte Margot etwas ruhiger und sehr nachdenklich. „Wir sind alle hier. Niemand von uns hat die Schreie ausgestoßen, und außer uns befindet sich niemand im Hause.“ Sie lächelte trübe. „Gestern nacht glaubte ich sogar meinen toten Mann zu sehen, doch war es nur irgendein Einbrecher, der auf unerklärliche Weise ins Haus gelangte und mir einen wertvollen alten Familienschmuck gestohlen hat. Heute läßt sich wieder die Nonne hören — Ich muß zugeben, nervenberuhigend ist das alles nicht. Ich werde in Kürze das Nonnenhaus für einige Zeit verlassen und irgendwoanders Aufenthalt nehmen.
Sie werden ja hoffentlich bei mir bleiben, Marie“, wandte sie sich an die Köchin. Die beschwor:
„Ich wäre auch bei Ihnen geblieben, wenn ein Dutzend Nonnen Radau gemacht hätten, gnädige Frau.“
Tilde nickte eifrig: „Ich auch, gnädige Frau, ich auch.“
Es war leicht, die Mutige zu spielen, wenn man wußte, man kam bald aus dem unheimlichen Hause heraus.
In dieser Nacht fand außer dem Kind niemand im Nonnenhause Schlaf; erst gegen Morgen fielen den Übermüdeten die Augen zu.