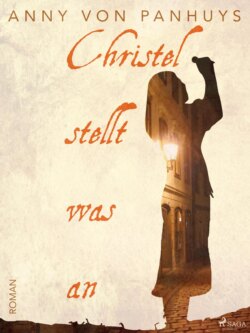Читать книгу Christel stellt was an - Anny von Panhuys - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеKaum befanden sich die beiden Mädel allein, schob Fränze die jüngere Freundin mit ein paar liebevollen, aber kräftigen Stößen zum Sofa und nahm neben ihr Platz.
„Jetzt bekenne mal, du verschlagenes Weibsbild, was du bisher noch nicht bekannt hast, nämlich, daß dir der Mann ganz ungewöhnlich gefallen hat.“ Sie lachte: „Feuerrot bist du eben geworden. Wenn man jemand die Wahrheit auf den Kopf zusagt, kann man danach allerdings oft solchen Farbwechsel beobachten. Schöne Christine: Wie konntest du zum Beispiel wissen, daß seine Schultern ihre edle männliche Breite keiner Rockwattierung verdanken, wie du vorhin in herzerfrischender Offenheit ausgeplaudert hast?“
Christel lachte verlegen:
„Möchtest mich wohl auf den Arm nehmen, Fränze? Meinetwegen, wenn du’s durchaus wissen willst, ich hab’ das gefühlt, als er mich so fest umarmt hat.“
„So, so!“ machte Fränze und ihre grauen Augen blickten äußerst vergnügt. „Schade, daß dieser Held ausgerissen ist wie Schafleder. Er wäre dir sicherlich gefährlich geworden.“
Christel zog die dunklen, schmalen Brauen dicht zusammen.
„Aus Männern, die nicht den Mut haben, für ihre Taten einzustehen, mache ich mir nichts.“
„Eine Tat nennst du den geraubten Kuß?“ lachte Fränze. „Ach, du gütiger Himmel, schöne Christine, was liegt denn an so einem Kuß? Der lange Edgar hat dich zum Beispiel doch auch schon geküßt. Ich hab’s doch selbst gesehen.“
Christel erwiderte zornig: „Laß mich mit dem langen Edgar zufrieden, der küßt alle Mädel, die er hübsch findet, wenn sie sich nicht wehren. Und als du deinen Geburtstag feiertest und uns ein bißchen zuviel Wein spendiertest, hat er mich eben auch geküßt. Ich habe mir aber noch tagelang danach die Lippen abgerieben und den Mund gespült.“
„Das aber hast du heute abend noch nicht getan, Mädelchen“, erinnerte Fränze. „Also, hole es nach, sonst wächst dir der Schnurrbart.“ Sie hob keck ihre etwas breite Nase.
Christine stand auf. „Ich muß Großchen in der Küche helfen, sie wird schon alles auf dem Tablett zurechtgestellt haben.“
Blitzgeschwind hatte sie sich an Fränze vorbeigedrängt, die gar keinen Versuch gemacht hatte, sie festzuhalten, sondern sich nur noch behaglicher in die Sofaecke drückte.
Alte Sofas, von der Art dieses braunen, mit Samt überzogenen Möbels, haben es in sich. Sie speichern in ihrem langen Dasein, irgendwo in ihrer Urväterpolsterung, eine Unmasse von Gemütlichkeit und Behagen auf.
Fränze blickte sinnend vor sich hin und das, was ihr zuletzt durch den Kopf gegangen, faßte sie in die leicht klingenden und doch so inhaltsschweren Worte zusammen:
„Das schlimmste und dümmste, schöne Christine, ist, daß du dich Hals über Kopf in den fremden feigen Mann verliebt hast!“ Sie sagte es sehr leise, als vertraue sie sich damit selbst ein Geheimnis an.
Draußen in der Küche aber sprach eben die alte Frau zu der Enkelin:
„Du wirst bald eine andere Stellung finden, Christel, und es ist vielleicht gut, daß du von Dr. Wendeck fortkommst. Er hat dir mit seinem muffigen Wesen ziemlich oft die frohe Stimmung genommen.“ Sie nickte Christel zu. „Es ist sogar möglich, daß es Dr. Wendeck inzwischen noch leid wird, dir so schnell gekündigt zu haben, und er die Kündigung zurücknimmt.“
Das junge Mädchen ergriff das große Tablett, auf dem Großchen das Abendessen aufgebaut hatte. Die Teller und Bestecke klirrten aneinander.
„Ich möchte nun wirklich nicht mehr bei ihm bleiben, Großchen, es ist ein ekliges Gefühl, immer in der Nähe eines Menschen beschäftigt zu sein, der einem nicht glaubt.“
Frau Anke Ewald schob noch ein Glas auf das Tablett und wollte etwas erwidern. Aber sie unterließ es im letzten Augenblick, dachte an die oft angewandten Sprichwörter: Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird! und: Kommt Zeit, kommt Rat! Eins davon paßte sicher.
Zwei Stunden lang blieb Fränze noch in der kleinen Zweizimmerwohnung am Andreasplatz, und als sie sich verabschiedet hatte, war sie fest überzeugt, Christel wieder ein bißchen ‚aufgemöbelt‘ zu haben. Sie wäre aber bald ganz anderer Meinung geworden, wenn sie die Freundin etwas später hätte beobachten können.
Christel hatte der alten Frau eine gute Nacht gewünscht und war in ihre Kammer gegangen, die außer der Waschkommode nur ein Bett, einen Tisch und einen Stuhl enthielt. Über dem Bett hing ein gemaltes Bild des Schattenhofes, das Großchen einst von daheim mitgebracht hatte.
Christel betrachtete es heute mit versonnenen Augen und dachte: Schön müßte es sein, im Sommer dorthin zu fahren, wenn die Linden zu blühen beginnen, die auf dem Bild schon dicht und grün um das Wohnhaus standen wie treue Wächter. Eine Bank unter einem der mächtigen Bäume lud zur Rast ein, und das Leuchten der scheidenden Sonne lag wie ein goldener Himmelsgruß über den Dächern der Ställe und über dem weiten Hof, auf dem man gerade die Last eines frühen Erntewagens in die Scheuer brachte.
Auf dem Schattenhofe wohnten noch heute die Wobbes, Blut von ihrem Blut, ein kräftiger, gerader Menschenschlag, wie Großchen immer betont erzählte, aber bauernstolz bis auf die Knochen. Man war Anke Ewald, die vor fünfundfünfzig Jahren nach Berlin geheiratet hatte, noch heute nicht besonders gutgesinnt. Es war ihr damals Gelegenheit geboten worden, in einen großen Hof der Marsch hineinzuheiraten, aber sie hatte sich doch für den Musiker aus Berlin entschieden, den sie während eines kurzen Aufenthaltes in Hamburg zufällig kennengelernt. Die Entscheidung Ankes war den Wobbes damals unverständlich geblieben und auch inzwischen keinem der jüngeren Familienmitglieder recht klargeworden.
Christel grübelte: Ausruhen möchte man in dem alten Haus mit den dicken Mauern, hinter dessen Fensterscheiben sich schneeweiße Gardinen bauschten, die Geheimnisse zu verbergen schienen, denn sie verwehrten es jedem Neugierigen, hineinzuschauen.
„Schattenhof!“ sagte Christel vor sich hin. Der Name klang nicht fröhlich, aber er klang eigen, sogar ein wenig unheimlich. Sie lächelte: Eine Tochter vom Schattenhof in den Vierlanden hätte sich wohl kaum so täppisch benommen, wie sie es heute getan hatte. Die würde sich gleich kräftig gewehrt und dem traurigen Helden sicher sofort ihre Meinung in das unverschämte Gesicht geschrieben haben. Christel hob die Rechte, als wollte sie das, was sie unterlassen, noch nachholen. Ihre Hand sank nieder. ‚Ich bin ja verdreht, ein Schlag in die leere Luft wäre blöd‘!
Christel schob die zehn Finger ineinander wie zum Gebet, und in ihr wurde immer inbrünstiger der Wunsch rege, dem Fremden recht bald irgendwo einmal zu begegnen, damit sie ihren Schwur halten könnte.
Plötzlich fühlte sie Tränen hinter ihren Lidern, Tränen, die sich ungeduldig hervordrängten, trotzdem sie sich dagegen wehren wollte. Oh — einmal noch diesen Menschen in das dreiste Abenteurergesicht sehen dürfen, ihm dann vergelten, was er ihr angetan.
Sie überlegte. Wie schön wäre es gewesen, wenn der Fremde sich ruhig und mutig dem empörten Dr. Wendeck gestellt und bekannt hätte: ‚Ich war närrisch geworden, aber das Mädel trägt keine Schuld an dem Vorfall!‘ Sie würde ihm dann vergeben haben.
Vielleicht hätte er nachher sogar unten auf der Straße gewartet, bis sie gekommen, und sie wären zusammen durch den abendlichen Berliner Osten gewandert, lachend und plaudernd. Er hätte sie ein Stück auf dem Heimweg begleitet. Und ihr wäre jetzt anders zumute. Sie schlug die Hände vors Gesicht und weinte leise. Großchen durfte es nicht hören, aber die Tränen taten ihr gut, und sie dachte an das lachende, verwegene Männergesicht, dachte an zwei kraftvolle Arme, die sie umfangen hatten, und an einen Mund, der fest auf dem ihren geruht. Sie dachte an einen Menschen, den sie haßte, und weinte vor — Haß — —
Christel schlief wenig in dieser Nacht, aber ehe sie ihren Gang zur Tagesarbeit antrat, zeigte sie der alten Frau ein recht frohes Gesicht und lächelte:
„Es ist wirklich alles gar nicht so schlimm, Großchen. Im Grunde genommen bin ich zufrieden, daß ich von dem ollen Nörgelpeter weg kann. Ich finde bestimmt binnen kurzem eine andere Stellung. Wir verhungern auch nicht, wenn ich mal ein paar Monate faulenzen müßte; du läßt mich dann ein Weilchen von deiner Witwenrente mitessen.“ Sie scherzte: „Ich schnalle mir den Gürtel auch etwas enger. Es wird schon alles wieder in Ordnung kommen.“
Unterwegs sah ihr Gesicht aber nicht mehr so vergnügt aus. Ein scharfes Fältchen hatte sich zwischen ihren Brauen eingekerbt, und es blieb dort, bis sie vor der Tür ihres Chefs stand. Jetzt verschwand das Fältchen. Christel wollte und konnte sich zusammennehmen. Dr. Wendeck brauchte nicht einmal zu ahnen, wie elend und bange ihr ums Herz war.
Die Frau, die hier täglich vormittags die gröberen Arbeiten verrichtete, öffnete ihr wie jeden Morgen. Sie hieß Frieda Fuchs, war hübsch, sechsundvierzig Jahre und die Witwe eines Kassenboten.
Christel grüßte freundlich, und während sie Mantel und Hut ablegte, fragte Frau Fuchs:
„Haben Sie vielleicht eine Rückfahrkarte verloren, Fräulein Ewald? Wenn nicht, wissen Sie aber wohl, wer sie verloren haben könnte. Sie muß einem von den jestrijen Patienten jehören.“ Sie ging Christel voraus in das Wartezimmer und fuhr fort: „Die Karte hat neben der Schwelle jelejen. Un soviel wie ich davon verstehe, hat sie sojar noch bis morjen Jültigkeit.“ Sie nahm von einer Nickelschale einen Eisenbahnfahrschein und hielt ihn Christel entgegen, die den Namen des Ortes las, der als Ziel angegeben war. Sie meinte: „Mir gehört die Karte nicht, aber ich will nachdenken, wer gestern hier gewesen ist und wer der Eigentümer sein könnte. Ein paar von den gestrigen Patienten werden übrigens heute wiederkommen.“
Frau Fuchs machte ein versonnenes Gesicht.
„Mit Rückfahrkarten muß man sehr vorsichtig sein. Wenn man zum Beispiel denkt, nu is für die Rückfahrt jesorgt, un verkrümelt daraufhin sein janzes Jeld in ‘nem fremden Ort, denn steht man nachher da wie die Kuh vor‘t neue Tor. Nämlich mir is es mal so jejangen in Werder bei der Baumblüte. Einer, der da vom Obstwein puppenlustig jeworden war, hat die Rückfahrt für mich bezahlt. Ein hübscher Kerl war er. Nachher hat er mich sojar besucht, und ich habe ihm, wie sich das jehört, sein jepumptes Jeld wiederjeben wollen. Denken Sie vielleicht, er hätte es jenommen? Bewahre! Er hat mir bloß immerzu vorphantasiert, ich wäre so ‘ne hübsche Frau un janz sein Jeschmack.“ Sie redete frisch darauflos. „So was habe ich natürlich janz jerne jehört, weil mein Verstorbener nie so was gesagt hat.“ Sie verzog den Mund. „Der hat man immer bloß jeschimpft.“
Christel warf einen Blick auf die Uhr, die über dem moosgrünen Plüschscheusal hing, das sich auch heute noch Sofa zu nennen wagte. Sie unterbrach die Redselige:
„Ich muß Dr. Wendecks Instrumente zurechtlegen.“
„Ach, Sie haben noch ein bißchen Zeit“, meinte Frau Fuchs in beinah bittendem Ton. „Ich werde rasch weitererzählen, ich möchte das einmal vom Herzen herunter haben, weil ein paar Frauen damals zu mir jesagt haben, ich hätte mich mordsdämlich benommen.“
Christel verspürte wenig Lust, noch länger zuzuhören. Sie hatte selbst genug auf dem Herzen, und die Rückfahrkarte brannte ihr förmlich in den Händen. Sie hatte im Geist schon alle gestrigen Patienten an sich vorbeigehen lassen. Sie waren ihr alle bekannt, und sie wußte, daß sie sämtlich in Berlin wohnten. Die Karte gehörte also wohl keinem von ihnen. Allerdings war gestern noch jemand dagewesen, den sie nicht kannte, ein dreister und unverschämter Mensch, einer, über den sie gar nichts wußte. Sie hatte auch keine Ahnung, wo er zu suchen wäre. Wahrscheinlich war die von Frau Fuchs neben der Schwelle des Wartezimmers gefundene Rückfahrkarte so etwas wie ein Fingerzeig des Schicksals, wahrscheinlich hatte sie jener Fremde verloren.
„Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Wir gehen lieber mittags zusammen hier weg. Unterwegs erzählen Sie mir dann alles ausführlich, Frau Fuchs.“
„Wenn‘s nich anders jeht, können wir‘s so machen“, stimmte die Frau zu und entfernte sich.
Christel aber ordnete im Arbeitszimmer Dr. Wendecks alles so, wie er es vorzufinden wünschte, wenn er kurz vor neun Uhr den Raum betrat. Der erste Patient des Tages wurde von ihm gewöhnlich um diese Zeit herbestellt.
Die Pinzetten, Bohrer und Messerchen, die Sonden, Spiegelchen und Exkavatoren blitzten. Bald lagen in Reih und Glied ausgerichtet alle die Gegenstände auf dem Drehtischchen, die ein Zahnarzt heutzutage braucht. Christel war es, als blinkten sie ihr spöttisch zu. Sie beeilte sich mit ihrer Arbeit und holte dann den Fahrschein aus der Tasche ihres weißen Kittels, den sie vorhin übergezogen. Eingehend betrachtete sie die Karte. Als Ziel war der Name einer märkischen Stadt darauf gedruckt, die nicht allzu weit von Berlin lag.
Christel glaubte ihrer Sache immer sicherer zu sein. Der Verlierer war der Mensch, der die Schuld trug, daß sie ihre gute Stellung nun bald würde aufgeben müssen. Und was hatte sie noch alles vorgehabt in nächster Zeit. Einen bequemen Liegestuhl hatte sie Großchen schenken wollen, und im Sommer hatte sie beabsichtigt, mit ihr irgendwohin in die Hamburger Landschaft zu reisen — von wo es nicht mehr weit war bis zum Schattenhof —, um ihre Ferien dort mit ihr zu verbringen. Großchen fieberte oft förmlich nach ein paar kräftigen Atemzügen Heimatluft, wie sie ihr gestanden hatte.
Christel unterdrückte einen Seufzer, denn eben ertönte die Flurklingel und im gleichen Moment tat sich auch die Tür von Dr. Wendecks Privatwohnung auf und der Zahnarzt trat ein. Grau in grau! mußte Christel wieder, wie schon so oft, denken, als Dr. Wendeck ihren Gruß lässig und unfroh erwiderte. Frau Fuchs hatte eben geöffnet, denn man hörte, daß jemand nebenan im Wartezimmer Platz nahm. Dr. Wendeck machte eine seiner schlenkernden Bewegungen, die ausdrücken sollte, der Patient könne eintreten, und Christel machte sofort die Tür zum Wartezimmer auf. Eine dicke Dame, mit dem Ausdruck unverhohlener Zahnarztangst auf dem Hängebackengesicht, schob sich herein. Ein liebenswürdiges Lächeln Dr. Wendecks versuchte, ihr Mut zu machen. Jetzt konnte er lächeln, weil ihm das Lächeln gewissermaßen bezahlt wurde.
Christel begriff nicht, daß es noch immer Menschen gab, die vor dem Zahnarzt Angst haben konnten wie vor dem unsinnig heraufbeschworenen schwarzen Mann in Kindertagen.
Sie assistierte gewohnheitsmäßig, denn sie war ja sicher bei der Handreichung, ihre Gedanken aber wollten nicht bei der Sache bleiben, die beschäftigten sich mit der Rückfahrkarte in ihrer Kitteltasche. Der darauf gedruckte Ortsname schien sich immer fester in ihrem Kopf zu verankern, und als das Surren des Bohrers wie das gleichmäßige Hinundherschwirren eines dicken Brummers die im Zimmer herrschende Stille unterbrach, war es ihr, als höre sie immer wieder denselben Namen, der auf der Fahrkarte angegeben war, heraus. Wenn die Karte dem Unbekannten gehörte und er tatsächlich nach dem Ort gefahren war, bestand auch die Möglichkeit, den dreisten Herrn wiederzusehen und den Schwur zu erfüllen. In Christels Augen blitzte es unternehmungslustig auf.
Die Patientin schaute erschrocken drein. Was war denn los? Es hatte beinah den Eindruck gemacht, als wollte das hübsche Ding auf sie losfahren.
Die Vormittagsstunden verflossen in anstrengender Tätigkeit, bis Christel schließlich zu Tisch gehen durfte. Frau Fuchs stand schon bereit, sich ihr anzuschließen.
„Wir machen ja den Weg zusammen, Fräulein Ewald, ich erzähle Ihnen dabei weiter von meinem Abenteuer. Denn ein richtiges Abenteuer ist’s noch jeworden mit dem Herrn, der mir damals die Fahrkarte von Werder zurück nach Berlin bezahlt hatte.“
Was blieb Christel weiter übrig, als zuzuhören. Frau Fuchs, die in der Königsbergerstraße wohnte, schritt neben ihr her. Nett und sauber sah sie aus in einem dunklen Mantel und einem kleinen mützenförmigen Hut, und Christel sagte unwillkürlich:
„Sie hätten eigentlich noch einmal heiraten sollen, Frau Fuchs, Sie sehen wirklich noch sehr gut aus.“
Frieda Fuchs lachte: „Das is es doch jrade jewesen, das hat er doch auch jesagt, der jalante Herr, der dann bei mir auftauchte. Und das wollte ich Ihnen ja jetzt erzählen.“ Sie holte tief Atem. „Ich habe man jelacht, wenn er mir allerhand Komplimente sagte, aber jut jetan hat’s mir doch. Das war immer, als ob mich einer mit so’ne janz weichen, lieben Hände streicheln tat. Ein paarmal sind wir abends ausjejangen un er hat mich überall hinjeführt, wo ich in meinem Leben noch nich jewesen bin. Mein Mann war abends bloß fürs Zuhausebleiben. Es hat mir nu alles natürlich sehr schön jefallen, un ich fing an nachzudenken, was denn woll aus der Jeschichte werden sollte. Was einen Anfang hat, das hat ja auch mal ein Ende. Ich hatte ein paar bekannten Frauen davon erzählt un sie meinten alle: ‚Frau Fuchs, der Mann wird Ihn‘ sicher einen Heiratsantrag machen.‘ Ich habe das riesig jerne jehört, un ich kam mir damals mächtig wichtig vor. Drei Jahre is es nu her. Eine Schlosserei hat er jehabt mit zwei Jesellen, draußen am Wedding. Frau Schlossermeisterin! Das war mir in den Kopf jestiegen un ich war damals eitel wie’n janz junges Mädchen. Dauerwellen habe ich mir machen lassen un Lackschuhe mußte ich haben, un denn hat er wirklich um meine Hand anjehalten. Janz richtig un reputierlich. Wie’s im Buch steht. Ich hab’ ihm nich jleich jeantwortet, weil mir, wo es soweit war, janz besoffen zumute jewesen is, denn das jroße Jlück war nu da.“ Sie machte eine Pause und blickte Christel ganz sonderbar an. Mit einer Mischung von Trauer und Selbstverspottung.
Christel war längst völlig bei der Sache. Sie war begierig zu erfahren, warum Frau Fuchs, obwohl ihr das Leben eine so große Glücksmöglichkeit geboten, noch immer Frau Fuchs hieß, die als Stundenhilfe in den Haushaltungen des Berliner Ostens ihr nicht allzu reichliches Brot verdienen mußte. Sie ermunterte: „Erzählen Sie doch zu Ende, ich möchte gern hören, wie es weiterging.“
Frieda Fuchs lächelte so richtig süßsauer.
„Es jing eijentlich überhaupt nich weiter, denn auf den Antrag folgte nich mehr viel, damit war sie schon beinah aus, die Jeschichte.“ Sie hüstelte, die Kehle war ihr plötzlich rauh geworden. „Ja, sehen Sie, Fräulein Ewald“, fuhr sie fort, „als ich ihm nich jleich Bescheid jab von wejen die Heirat, weil ich mein Jlück erst so recht von allen Seiten bewundern wollte, drängte er: ‚Liebe Frau Frieda, fassen Sie rasch un feste zu. Manche andere an Ihrer Stelle täte das liebend jerne!‘ Un dann hat er jelacht un sich ein bißchen aufjeplustert. Er könnte janz junge Mädchen haben un wäre doch schon fünfunddreißig. Sojar eine von neunzehn wäre dabei, bildhübsch un mit Moneten un ’ner piekfeinen Einrichtung, aber er hätte sich in mich verschossen.“ Sie seufzte. „Da war es mir mit einemmal, Fräulein Ewald, als ob ich aus ’nem janz schweren Traum aufwachte, da sah ich plötzlich die janze Jeschichte anders, da wußte ich, daß ich mir wochenlang selbst was vorjemacht un es nich jemerkt hatte. Aber nu war’s Tag jeworden um mich ’rum und alle die hübschen Zukunftspläne purzelten ’runter un fielen mir auf den Kopf. Dreiundvierzig war ich, un er fünfunddreißig, junge Mädels konnte er kriejen, un ich wollte ihm den Weg versperren. Das durfte ich doch nich, das wäre doch ’ne Jemeinheit jewesen. Ich hatte keine Kinder und mein Seliger hat mir die Schuld jejeben. Der Doktor meinte, ich würde auch keine bekommen. Eine Junge aber könnte dem Mann vielleicht ein halbes Dutzend schenken, un ich wollte einer, die mehr Anrecht darauf hat, einen juten Platz als Frau un Mutter wegnehmen. Wie ’ne Betrügerin kam ich mir da vor, und ich habe ihm das alles offen jesagt. Er hat mich dafür janz jroß un verbiestert anjesehen, so lange anjesehen, daß ich’s kaum ertragen konnte, aber schließlich is er janz still wegjejangen, hat bloß noch jesagt, er will sich das überlejen, aber er käme bestimmt wieder.“
Sie zog mit schmerzlicher Gebärde die Schultern hoch.
„Er ist nich wiederjekommen, un vorijes Jahr hab’ ich in der Zeitung ‘ne Annonce jelesen, da teilt er seinen Freunden mit, daß ihm seine Frau Zwillinge jeschenkt hat. Un ich weiß nu, es war jut, daß ich damals noch rechtzeitig zu Verstand jekommen bin. Aber was meine Bekannten sind, die werfen mir das alles als jroße Dummheit vor un behaupten, ich hätte mein Jlück verscherzt. Nu möchte ich bloß mal hören, was Sie dazu meinen, Fräulein Ewald.“
Sie waren inzwischen am Andreasplatz angelangt, wo Christel wohnte. Sie reichte der anderen die Hand.
„Sie haben wie ein grundanständiges Menschenkind gehandelt, und der Mann wird Ihnen das sicherlich auch heimlich oft danken.“
Frau Fuchs nickte zufrieden.
„Ich freue mich, daß Sie meiner Meinung sind, Fräulein Ewald. Eijentlich is mir die olle Jeschichte nur einjefallen, als ich Ihnen heute die Rückfahrkarte jab. Da dachte ich daran, wie ich damals meine verloren hatte und janz aufjeregt auf ’m Werderschen Bahnhof stand, bis mir der nette Kerl half.“ Sie grüßte, winkte Christel dann noch zu und bog nach links ab.
Das junge Mädchen schaute ihr nach. Hübsch war Frau Fuchs geblieben bis jetzt, und es schien durchaus verständlich, daß sie noch vor wenigen Jahren sogar einem bedeutend jüngeren Mann hatte gefallen können. Daß sie eine sichere Zukunft ausgeschlagen hatte und weiter in fremden Diensten ihren Unterhalt verdiente, mußte ein Opfer genannt werden. Es kam noch dazu, daß sie den Mann anscheinend sehr gern gehabt.
Die Gründe zu dieser Handlungsweise waren ehrenhaft gewesen. Sie hatte wirklich kein Recht auf den Platz gehabt, den ihr ein Verliebter angeboten, der vielleicht in kurzer Zeit von seiner Verliebtheit geheilt worden wäre. Sehnsüchtig hätte er dann allen Vätern, die Kinder an der Hand führten, auf der Straße nachgeblickt und bedauert, daß er sich selbst um das schönste Erdenglück, um Kindersegen, gebracht hatte.
Christel fand, daß die Frau bewundernswert gehandelt hatte und sich manche heirats- und versorgungswütige Witwe an ihr ein Beispiel nehmen durfte. Die späte Liebesgeschichte der einfachen, aber hübschen Frau Frieda Fuchs war sehr lehrreich.