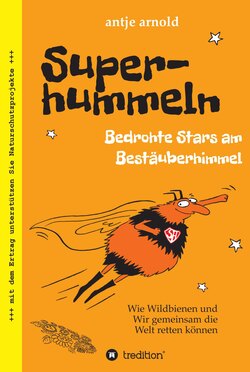Читать книгу Superhummeln - Bedrohte Stars am Bestäuberhimmel - Antje Arnold - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 2
Biodingsdabumsda oder man könnte auchBiodiversität dazu sagen
Wenn man Hummeln und Wildbienen verstehen möchte, kommt man kaum drum rum, die ganze Sache im größeren Zusammenhang zu betrachten. Hummeln sind schließlich auch nur Wildbienen, Wildbienen nur Insekten, Insekten auch nur Tiere und Tiere wiederum sind auch nur ein Teil des großen und ganzen Lebendigen – namens Biodiversität. Diese Biodiversität ist nicht gerade einfach zu verstehen. Zu Beginn erst mal ein Versuch der Erläuterung des Begriffes:
Biodiversität: Fünf Silben, an denen sich ganz viele Menschen noch immer die Zähne ausbeißen. Biodiversität stellt tatsächlich schon ans Aussprechen Ansprüche. Als weitere Hürde kommt das Merken hinzu. Der Entscheidender-Manager sagte einmal zu mir im wohlgemerkt bereits dritten Termin, den wir zu einem Biodiversitätsprojekt hatten, „so, was machen wir denn jetzt mit ihrem Biodingsdabumsda?“. Zugegeben, das war 2013. Immerhin haben mittlerweile über 50 Prozent der Deutschen den Begriff schon einmal gehört, damals hatte das noch fast keiner. Aber Aussprechen und Merken ist das eine, zu wissen über was man tatsächlich spricht das andere. Der Begriff Biodiversität selbst wurde zum ersten Mal 1988 so richtig an die Oberfläche gespült mit dem vom Evolutionsbiologen Edward O. Wilson herausgegeben Buch „Biodiversity“. Er stieg damit aus der Nische der naturwissenschaftlichen Forschungswelt auf das Podest des Vokabulars für die Weltgemeinschaft. Mit der Konvention zur Biologischen Vielfalt (CBD) avancierte er auf dem Erdgipfel in Rio 1992 zum offiziellen Begriff für den weltweiten Naturschutz. So, da haben wir ihn jetzt und können schauen, wie wir mit ihm klarkommen.
Dabei heißt „Biodiversität“ von vorn her zerlegt erst mal nichts anderes als Leben und Vielfalt. Ins Deutsche wird sie oft mit Artenvielfalt übersetzt, was aber nur für einen Teil - genauer gesagt - für ein Drittel zutrifft. Denn sie beschränkt sich nicht nur auf die Vielfalt der Arten, sondern schließt ebenso die Vielfalt ihrer Gene und die Vielfalt der Lebensräume mit ein. Eigentlich logisch - schließlich braucht ein Lebewesen nun auch mal einen Ort zum Daheimfühlen und zum Weiterexistieren der Art eine Mindestzahl an Paarungs- oder Bestäubungspartnern. Ansonsten droht Inzucht. Mit den wohlbekannten Folgen aus früheren Königshäusern.
Der Dreiklang: Gene – Arten - Lebensräume
Gene: Besonders im Zeitalter der Klimaveränderungen, Landnutzungsänderungen und Globalisierung wird das Leben für ganz viele Arten mittlerweile richtig stressig. Dabei geht es nicht mehr nur um Normalo-Sorgen wie: „Oh là là, da lauert der Typ mit den scharfen Zähnen“, sondern zusätzlich um Dinge wie: „Uff, ist das heute heiß! Geht‘s mir deshalb so schlecht oder habe ich etwa dieses neuartige Virus aus Asien aufgeschnappt?“ Deswegen wird es noch wichtiger, dass genügend Individuen und damit auch Genvarianten einer Art existieren. Denn dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Exemplar mit von der Partie ist, dessen Ausstattung an Genen besonders gut mit den veränderten Klimabedingungen oder vielleicht sogar mit dem neuen Erreger klarkommt, der mit dem letzten Flugzeug aus Asien gereist kam. Das führt zu spannenden Wettläufen mit der Uhr, wie etwa aktuell bei den europäischen Eschen zu beobachten ist. Existiert unter ihnen eine Genvariante, die mit dem aus Asien eingeschleppten Pilz namens Falsches Weißes Stängelbecherchen (Hymenoscyphus pseudoalbidus) fertig wird oder nicht? Schließlich hat dieser Pilz Schuld am derzeitigen Eschentriebsterben in Mitteleuropa. Falls ja, wird sich diese resistente Version hoffentlich durchsetzen und uns weiterhin zu 1a-Besenstielen verhelfen. Denn Stiele für Besen und diverse Gartengeräte werden aus Eschenholz gefertigt. Falls das nicht gelingt, steht die europäische Esche und damit auch der mythische Weltenbaum der Germanen demnächst auf der roten Liste. Hexen können dann schauen, wo sie ihre Besenstiele herbekommen. Nachbarinnen auch.
Deshalb ist genetische Vielfalt wichtig – auch für Hummeln. Gerne wird sie aber übersehen, weil sie ohne Hilfsmittel für unser Durchschnittsauge völlig unsichtbar ist. Damit sich eine Art dauerhaft halten kann, benötigt sie einen entsprechend großen Genpool. Bei Wirbeltieren spricht man von mindestens 60 Individuen. Erst dann kann sich daraus eine genetisch einigermaßen stabile Population entwickeln.
Aber nicht nur für die natürliche Biodiversität kann fehlende genetische Vielfalt zu Katastrophen führen. Selbst im Bereich der Nutzpflanzen und Nutztiere erweist sie sich für uns als überlebenswichtig. Eines der historisch dramatischsten Beispiele fehlender genetischer Vielfalt bei Nutzpflanzen kennen Sie sicherlich aus dem Englischunterricht. Die berühmte „potato famine“ in Irland Mitte des vorletzten Jahrhunderts, die für einen Massenexodus nach Amerika sorgte. Auf der Insel baute man damals nur zwei verschiedene Kartoffelsorten an. Beide waren fatalerweise nicht resistent gegen die Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans). Und auch heute noch ärgert sie haufenweise Hobbygärtner, weil sie in nassen Sommern nicht nur Kartoffeln, sondern auch Tomatenpflanzen befällt, reihenweise braun werden und umfallen lässt. Deren Früchte eignen sich dann nur noch zum Wegschmeißen oder bestenfalls als fauler Eierersatz für Demos.
Wegen fehlender genetischer Vielfalt steht aber auch bei der wichtigsten Nutzsorte der Bananen eine echte Katastrophe bevor. Die weltweit hauptsächlich angebaute Sorte Cavendish ist bedroht vom TR4. Das ist die Kurzform für Tropical Race 4 – kein Autorennen 4.0 - sondern ein Pilz. Botanisch heißt er Fusarium oxysporum f. sp. Cubense und löst die berüchtigte Panamakrankheit aus, bei der Blätter braun werden und letztendlich die Pflanze zu Grunde geht. 95 Prozent des Exportes des Bananenweltmarktes mit Milliardenumsätzen gehen auf das Cavendish-Konto. Die Nachteile eines Lebens ohne Bananen wären gravierend: Ein calciumreiches, natürlich verpacktes Lebensmittel fällt weg, das ohne Vollkörperkondom im Plastikformat im Unterschied zu mancher Gurke auskommt, besonders unseren Kindern schmeckt und einen enormen Boom beim Trend-Cooking der Smoothie-Bewegung erlebte. Ganze Regionen in den Tropen leben vom Bananenanbau. Neben der Cavendish gibt es mehr als 300 essbare Sorten. Darunter gibt es Bananen zwischen „weich wie Erdnussbutter“ und „hart wie Kohlrabi“. Es gibt Bananen in allen möglichen Farben: von violett über rot bis hin zu grün. Es gibt Varianten von „faulig stinken“ bis hin nach „Crema Catalana munden“. Also Vielfalt pur. Aber all diese Sorten haben etwas gemeinsam. Sie benehmen sich nicht so brav wie Cavendish, sondern zicken rum wie pubertierende Jugendliche. Mögen keine Massenproduktion, kränkeln anderweitig, passen nicht in den Mainstream-Geschmack oder haben einfach keine Lust geerntet auf weite Reisen zu gehen. Aber immerhin würden sie eine Grundlage liefern, auf der man züchterisch aufbauen kann. Deswegen ist genetische Vielfalt auch bei Nutzpflanzen enorm wichtig. Sonst kann ein unsichtbarer Pilz im Handumdrehen zur Katastrophe in den Erzeugerländern werden und in so manch Kindergärten ihrer Abnehmerländer.
Arten: Unter einer Art kann man sich einen Brutkasten vorstellen. Da drin können die einzelnen Individuen nicht nur Kinder miteinander haben, sondern auch Enkel. Diese Enkel gelten als wichtige Beweisstücke, dass die Mitglieder einer Art nicht einfach nur miteinander Nachkommen, sondern auch „fruchtbare“ Nachkommen zeugen können. Erst dann ist nämlich ein dauerhaftes Fortbestehen der Art garantiert. Bei Esel und Pferd kann man sich bereits im Vorhinein denken, dass es am Ende nicht gut geht. Die sehen schon genügend ungleich aus. Der Maulesel ist steril.
Quantität der Arten: Wie viele solcher Brutkästen es auf dieser Erde gibt ist schleierhaft. Und die Hoffnung, irgendwann einmal eine exakte Artenzahl in Wikipedia hineinschreiben zu können, ist rastertunnelelektronenmikroskopisch klein. Dafür gibt es mehrere Gründe:
1. Zum einen liegt es daran, dass viele Arten durch unterschiedliche Entdecker früher auch schon mal unterschiedlich benannt und dadurch mehrfach gezählt worden sind. Internationale Disziplin in der Benennung der Arten zog nämlich erst mit Ende des 19. Jahrhunderts ein. Da war aber schon vieles fröhlich kreuz und quer benannt. Dadurch herrscht immer noch ein gewisses Kuddelmuddel. Fische gelten dafür als Paradebeispiel: 50.000 Namen führt die Fischliste, gesichert sind aber nur 31.000 Arten. Das Problem liegt auf der Hand - man kann sie nicht nach ihrem Namen fragen. Aber auch bei anderen, etwas gesprächigeren Gattungen funktioniert das Rede und Antwort stehen leider nicht.
DNA-Barcoding hilft hier seit einigen Jahren. Dabei werden artspezifische Gensequenzen analysiert. Das „Internationale Barcode of Life Project“ (IBOL) unterstützt Initiativen aus verschiedensten Artengruppen technisch, internationale Datenbanken mit DNA-Barcodes aufzubauen – so auch die FISH-BOL für alle Fischarten weltweit.
2. Andersherum läuft das Spiel bei den sogenannten kryptischen Arten. Obwohl sie gleich aussehen versteckt sich hinter einer Art manchmal noch eine weitere Art vor den Taxonomen (das sind Menschen, die Ordnung lieben, sich mit Arten wahnsinnig gut auskennen, sie erfassen und Struktur in das komplizierte Wesen des Lebens bringen). Wie etwa beim bereits erwähnten weißen Stängelbecherchen. Hier kann selbst das Mikroskop nichts mehr ausrichten. Die äußeren Merkmale stimmen zwar überein, aber trotz romantischer Zweisamkeit im Brutkasten funkt es auf genetischer Ebene überhaupt nicht. Fortpflanzung à de. Normalerweise können sie nur mit Hilfe einer Genanalyse aufgedeckt werden. Da man ganze Genome und zunehmend auch artentscheidende Genschnipsel mit DNA-Barcoding immer häufiger sequenziert, fliegen diese geheimen Arten auch immer mehr auf. Besonders bei Bakterien liegt das im Trend.
3. Ein weiterer besonders wunder Punkt: Momentan sterben sehr viele Arten aus. Da waren die Mühen des Entdeckens, Beschreibens und Benennens völlig umsonst und zuweilen bekommt man dieses traurige Ereignis nicht mal sofort mit.
4. Und schließlich gibt es noch die vielen unentdeckten Arten, die im Kronendach der Regenwälder, in der Tiefsee, im Boden sehnsüchtig darauf warten, endlich entdeckt und berühmt zu werden. Oder zumindest schon mal einen Namen bekommen möchten.
Diese manchmal gegenläufigen Effekte führen dazu, dass es etwas unübersichtlich wird. Und deshalb spricht man auch bei Wildbienen von 20.000 bis 30.000 Arten weltweit.
Jedes Jahr werden insgesamt ungefähr 20.000 neue Arten aus Flora und Fauna beschrieben, viele davon sind nicht ganz so attraktiv wie Pandabärchen. Sie gehören zu den Würmern, Bakterien und Algen. Denn der Bereich der schönen, offensichtlichen Arten ist besonders in Europa bereits ziemlich abgegrast – wir sind schlichtweg visuelle Wesen. Eine gewisse regionale Unwucht existiert dabei. Europa, wegen der letzten ungemütlichen Eiszeit und dem Querverlauf der Alpen als harte Barriere immer noch ziemlich artenarm, beherbergt im Vergleich zu anderen Erdregionen relativ viele Artenkenner. Ist sozusagen ein Hot Spot für Biodiversitätsprofis. Und Regionen mit hoher Artenvielfalt, also Hot Spots für Biodiversität, wie wir sie in den Tropen vielfach finden, besitzen nur wenige Artenkenner. Deshalb sind Artenkundler auch zum Exportschlager geworden und ziehen auf Entdeckungstour in die Welt hinaus. Als Trendsetter dafür galt Alex von Humboldt vor bereits mehr als 200 Jahren.
Derzeit sind zwischen 350.000 und einer halben Million Pflanzenarten, 1,7 Millionen Tierarten – über eine Million davon Insekten, ungefähr 6.000 Bakterienarten und circa 120.000 Pilzarten bekannt. Das macht aktuell summa summarum ungefähr zwei Millionen Arten aus. Dies ist jedoch nur eine Momentaufnahme. Manche Forscher spekulieren, dass es zehn Millionen Arten gibt und andere glauben an 100 Millionen Arten. Allein Pilzkenner können sich nicht zwischen 2,2 Millionen und der sagenhaften Zahl einer Billion Arten innerhalb ihrer Sparte entscheiden. Aktuell hat man sich bis auf weiteres auf acht Millionen Arten weltweit geeinigt. Soviel zur Quantität der Arten.
Aber ebenso existieren völlig unterschiedliche Qualitäten unter den Arten: Einmal sind da die Allerweltsarten. Das sind die Null-Acht-Fuffzehn-Typen, die an jeder Straßenecke der mittleren Standorte in der Landschaft herumstehen. Anpassungsfähig kommen sie mit recht unterschiedlichen Bedingungen klar. Sogar eine Hummelart, die dunkle Erdhummel, zählt momentan mit zu diesen flexiblen Gewinnern. Aus der Sparte der Pflanzen liegt der Löwenzahn im Aufwärtstrend. Da er aktuell viel mehr Stickstoff bekommt als noch vor 100 Jahren (näheres dazu erfahren wir noch in Kapitel 8), kurbelt er seinen Turbo an und dominiert mittlerweile ganze Landstriche. Mit ganz viel Kraft presst er seine starken Blätter ganz flach auf den Boden. Damit verhindert er, dass sich direkt neben ihm andere Pflanzen niederlassen und ihm womöglich den schmackhaften Stickstoff vom Brot nehmen. Das führt dann schon mal dazu, dass im April stark gedüngte Wiesen buttergelb, mit blühendem Löwenzahn überzogen sind. Von Vielfalt keine Spur.
Weniger konkurrenzstark, aber dennoch häufig vorkommend, sind Arten, die schlichtweg anspruchslos sind. Denen ist es wurscht, ob sie in der Stadt, auf dem Land oder im Wald leben und werden als Ubiquisten bezeichnet. Als Beispiel dafür aus der Tierwelt kennen wir die Amsel.
Im Gegensatz dazu erweisen sich die allermeisten Bienenarten als echte Spezialisten mit diversen Spleens. Etliche benehmen sich wie echte Diven und stellen ganz besondere Bedingungen sowohl an Lebensraum als auch an Nahrung. So etwa sammelt die Natternkopf-Mauerbiene für ihre Brut ausschließlich Pollen des gemeinen Natternkopfes. Oder einige Pflanzen, wie der Sonnentau, finden sauren Moorboden erst so richtig lustig. Noch spleeniger wird’s, wenn eine Art seltene Lebensbedingungen miteinander kombiniert. Der Hochmoorgelbling gehört als Schmetterling zu solch einer extravaganten Sorte. Seine Raupen mögen ausschließlich die Blätter einer ganz bestimmten Moorpflanze, nämlich die der Rauschbeere - dem Namen nach zumindest mehr als verständlich. Als Erwachsener benötigt er hingegen viel Nektar von blütenreichen Wiesen zur eigenen Energieversorgung. Und diese bitte schön in unmittelbarer Nachbarschaft zum Moor gelegen. Nicht etwa aus Faulheit, sondern aus Vorsicht. Lieber verhungert er, als dass er weiter als einen Kilometer von seinem Gelege wegflattert. Schließlich schlagen Schmarotzer dann gern zu, wenn die Luft rein ist.
Seltene Arten besitzen häufig weitere Eigenarten. Einige von ihnen ziehen nur wenige Nachkommen groß und trifft besonders große Tiere. Sie investieren lieber in Klasse statt in Masse - in lange Tragezeit und in liebevolle, intensiverzieherische Aufzucht. Bei dem Aufwand kann man sich eben nur wenige Kinder leisten. Selbst manche Bienenarten handhaben das ähnlich und legen nur wenige Eier zugunsten eines spektakulären Nestbaus wie die Schneckenhausmauerbiene. Ebenso sollten Lebensräume entsprechend groß sein, um sich genügend Nahrung beschaffen zu können. Selbst ein relativ kleines Tier wie der Igel beansprucht bereits ein Revier von einem Quadratkilometer. Ein Steinadler benötigt bis zu 150 Quadratkilometern und ein Wolf bereits 250 Quadratkilometern.
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft ihre geographische Verbreitung. Einige Arten kommen nahezu weltweit vor wie etwa Hahnenfußgewächse (die gemeine Butterblume gehört dazu). Andere natürlicherweise nur auf der Nordhalbkugel wie die Hummeln. Und andere sind wiederum so wählerisch, dass sie sich nur in einem ganz umgrenzten Gebiet wohlfühlen wie die Malven-Langhornbiene nur in einer winzigen Region Bayerns. Viele Inseln beherbergen solche Arten, die sich aufgrund ihrer Abgeschnittenheit vom Rest der Welt weiterentwickeln und spezialisieren konnten. Als berühmte Beispiele dafür fungieren die Galàpagos-Inseln inklusive Darwinfinken oder Madagaskar, das viele endemische Pflanzen und Tiere besitzt. Oder mittlerweile - leider - besaß.
Kommen bei einer Art mehrere dieser Aspekte zusammen, die seltene Arten kennzeichnen, wird man zur besonders seltenen Art. Für solch Sensibelchen wird das Aussterben inzwischen täglich zur realen Bedrohung.
Lebensräume: Ohne die Vielfalt der Lebensräume würde es keine Vielfalt der Arten geben, die sich den äußeren Bedingungen anpassen müssen. Die unterschiedlichsten Individualisten – vom Grottenolm über die Sägehornbiene, der Bergprimel und bis zum Chamäleon - hätte es ohne die unterschiedlichsten Lebensräume nie gegeben.
Eine Art fällt jedoch völlig aus dem Bilderrahmen dieses Gesamtarrangements. Diese Art heißt Homo Sapiens und stellt möglicherweise sogar nur eine Unterart namens Homo sapiens sapiensis dar. Mit Hilfe vieler Tricks schafft sie es fast alle Lebensräume für sich zu nutzen. Die Wüste als Beduine, die Arktis als Eskimo, den tropischen Regenwald als Indigener oder den Himalaya als Kaschmirziegenhirte. Im gemäßigten Flachland hingegen macht sie gerne einen auf zivilisiert, plastifiziert sich und ihre Umgebung und beschleunigt liebend gerne ihren Körper sowie die Verbreitung ihrer Ideen. Lange Zeit galt in dieser Region die Faustformel: je schneller desto fortschrittlicher. Kein Lebensraum scheint ihr unangenehm genug. Selbst im Weltall ist sie bereits gesichtet worden. Obwohl dieser, mangels echter Lebewesen – mal abgesehen von Marsianern und Vulkaniern - nicht ganz der Definition eines Lebensraumes genügt. Als Supertalent der Anpassung stellt sie den Extremisten unter den Anpassungsfähigsten. Ihren körpereigenen klimatischen Toleranzbereich weitet sie durch jede Menge Innovationen aus. Klimaanlagen, Fußbodenheizungen, Sauerstoffmasken, selbstgestrickte Pudelmützen. Als letzte existierende Art aus der Gattung der Hominiden muss sie nicht mal mehr die Konkurrenz der eigenen Mischpoke fürchten. Allen anderen Hominiden, etwa den Neandertalern, hat sie die evolutionären Äste bereits abgesägt. Und nur weil diese mit etwas leichterem Gepäck – intellektuell gesehen - unterwegs waren. Damit ist keinerlei nähere Verwandtschaft mehr übrig, die ihr ernsthaft Konkurrenz machen könnte.
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wie definiert man genau Lebensräume? Ganz grob lassen sie sich erst mal nach den drei verschiedenen „Elementen“ Erde, Wasser, Luft unterscheiden. Nehmen wir das Beispiel Wasser. Hier geht es dann weiter entweder in Richtung salzig oder süß. Jetzt kommt das Klima hinzu: Befinden wir uns im tropischen Ozean oder im kalten Gebirgssee? Weiterhin existieren Ufer- und Tiefseezonen, und so weiter. Stellen wir uns einen See vor. Hier gibt es den Seegrund, den tieferen Wasserbereich, den seichten Bereich, die Uferzone und vielleicht noch einen Schilfgürtel. Sauerstoffreiche, sauerstoffarme Wasserzonen. Alles verschiedenste Lebensräume mit speziell angepassten Arten. An Land gilt das ebenso. Hier gibt es vielfältigste Lebensräume wie Wüsten, Steppen, Gebirge, Wälder. Wälder können weiter in Gebirgswald, Regenwald, Hochwald, Niedrigwald aufgespalten werden. Der Regenwald wiederum weiter in einen tropischen oder gemäßigten Regenwald. Im tropischen Regenwald geht‘s dann los in welche der Etagen - von minus drei über Parterre bis vielleicht zur 20. - sich der Lebensraum befindet. Und so weiter bis hin zu niedlichen Mikrolebensräumen für Bakterien und Pilze, wie sie vielleicht unter dem Nagel des linken großen Zehs des Brüllaffen Archie zu finden sind.
Offiziell sind allein für Europa 231 Lebensraumtypen definiert, angefangen bei „Salzwiesen im Binnenland“ über „Trockene europäische Heiden“ bis hin zu „Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation“. Einige tierische Organismen lassen sich dabei nicht nur auf einen Lebensraum begrenzen, sondern nutzen verschiedene, Zugvögel sogar besonders weit auseinanderliegende Lebensräume für sich. Die scheren sich dann nicht mal um irgendwelche politischen Grenzen. Und selbst winzige Bienen oder Hummeln können in der Abbruchkante des Flussufers ihr Nest anlegen und nebenan auf dem Lebensraum Magerrasen Pollen und Nektar sammeln. Folglich macht es manchmal eher Sinn, eine Lebensraumsituation vom Bewohner aus zu betrachten und dessen jeweiligen Kiez als Habitat zu bezeichnen.
Werden wir konkret und kommen zum Regenwald mit seinen unterschiedlichsten Lebensräumen in den einzelnen Stockwerken zurück. Da gibt es ein Untergeschoß mit dem Minuszeichen davor im Aufzug. Es befindet sich direkt in der obersten Schicht des Erdbodens. Hier nisten schillernde Persönlichkeiten: die Orchideenbienen. Weiter geht’s eins drüber ins Erdgeschoss mit seiner Kraut- und Strauchschicht. Es ist schummrig düster mit nur einem Prozent des Sonnenlichtes. Im ersten Stockwerk stehen Sträucher und Büsche recht lässig verteilt. Die mittleren Stockwerke – endlich wird’s deutlich heller - bestehen aus kleineren Bäumen wie Mango, Kakao und jungen Urwaldriesen, die hier in den Startlöchern stehen. Noch eins drüber kommt das Kronendach, die eigentliche Shopping- und Flaniermeile des Regenwaldes. Hier, in der turbulenten Haupteinkaufsstraße, spielt sich das meiste Leben ab - ein Leben über dem Abgrund. Nur wer oben bleibt, überlebt. Es sei denn er besitzt Flügel. Das kostet zwar Energie, das Problem wird aber lösbar. Geplapper, Geschrei und Gesummse in ohrenbetäubender Lautstärke kommt von den Delikatessläden, Restaurants und Straßencafés in dieser Etage. Hier geht es zu wie auf dem Viktualienmarkt an einem schönen Sommertag. Ein Gedränge an Käfern, Grillen, Vögeln, Affen, Bienen, Ameisen, Schlangen, Baumkatzen, die im Angebot der Blüten, Früchte und Beutetiere baden. Und natürlich kann man hier auch potenzielle Partner mit und ohne Sinn für Familiengründung kennenlernen.
Noch weiter höher, in der obersten Lebensraumetage, die bis erstaunliche 65 Meter reicht, wachsen solch Urwaldriesen wie die Paranussbäume. Man nennt sie auch Überständerbäume, weil man von ihnen, wie vom höchsten Hochhaus aus runter auf die Stadt, auf das Kronendach des Regenwaldes schauen kann. Diese exklusiven Büroetagen mit atemberaubendem Blick sind für besonders exaltierte Arten wie Orchideen und Orchideenbienen reserviert. Viele Orchideen sind von Haus aus Aufsitzerpflanzen, was so viel bedeutet, dass sie am liebsten in lichten Höhen der Astgabeln von Bäumen herumlungern. Und hier, in diesem obersten Lebensraum des Regenwaldes, finden wir die verzwickte Symbiose zwischen Orchideenbienen, Orchideen und Paranussbäumen (Details dazu in Kapitel 3).
Kein Wunder, dass in diesem Ökosystem die meisten noch unbekannten Insekten- und Bienenarten vermutet werden. Erstens paradiesisch für Insekten, zweitens nicht gerade paradiesisch für Menschen. Immerhin müssen sie sich durch unwegsamen Dschungel zwängen, bis zu 40 Meter am Seil in die Höhe klettern, um hinterher auch noch auf den Ästen dort oben herumzubalancieren. Dabei sollten sie unbedingt schwindelfrei sein, denn Gravitation hätte hier besonders ätzende Folgen. Das alles schaffen nur Besessene oder Forscher. Daher erscheint uns dieser Lebensraum immer noch unnahbar, unerforscht, unfassbar. Dennoch erobern zunehmend Mitarbeiter vieler Pharmafirmen diesen Lebensraum: logischerweise nicht wegen neuer Bienenhighlights, sondern wegen neuer Heilsubstanzen und das liebe Business.
Ökosysteme
Lebensräume, Habitate, Biotope, ökologische Nischen, Ökosysteme. Vom simplen Raum zum System. Ökosysteme stehen nach der genetischen Vielfalt, der Vielfalt der Arten und der Lebensräume für die höchste Organisationsstufe der Biodiversität. Wir befinden uns in der Königsdisziplin. Wer sich hier ein wenig auskennt, der hat es drauf. Wie dreidimensionale Zahnräder sind Organismen mit anderen Organismen und haufenweise abiotischen Faktoren wie Klima, Bodenbeschaffenheit und Stoffflüsse dynamisch verbunden. Dadurch entstehen Ökosysteme, deren Komplexität bisher nur zu ahnen ist. Ein System verdient nur dann diesen Namen, wenn hier die Zahnräder dieser vielfältigen Dimensionen nicht nur ineinandergreifen, sondern auch noch reibungslos funktionieren. Es sollte klar sein wer welche Position auf dem Fußballplatz des Ökosystems übernimmt, sonst gibt es ein Riesenkuddelmuddel und alle purzeln durcheinander oder rennen schlichtweg zum falschen Tor. Zugegebenermaßen hatten einige Ökosysteme bereits ein paar Milliönchen Jahre Zeit, sich nicht nur Gedanken darüber zu machen wie ein Miteinander am besten funktionieren könnte, sondern auch ein bisschen Muße, es einfach mal auszuprobieren und ständig nachzubessern.
Die Ökologie ist diejenige wissenschaftliche Disziplin, die versucht zu verstehen, wie Ökosysteme tatsächlich funktionieren. Ernst Haeckel lieferte als Vater der Ökologie 1866 eine erste Definition: „Unter Oecologie verstehen wir die gesammte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenz-Bedingungen rechnen können. Diese sind theils organischer, theils anorganischer Natur … von der grössten Bedeutung für die Form der Organismen, weil sie dieselbe zwingen, sich ihnen anzupassen.“ Und Frederic Vester hat als Biokybernetiker mehr als hundert Jahre später das so richtig sichtbar gemacht. Seine nach ihm benannten „Vester-Netze“ visualisieren prägnant die Zusammenhänge, die Verknüpfungen und die daraus resultierende Stabilität eines Ökosystems. Vester war es auch, der daraufhin den Begriff des „vernetzten Denkens“, dem Denken in Kreisläufen und Zusammenhängen für uns, schuf. Als einer der Ersten machte er die Folgen des bis dahin oft egoistischen und planlosen Ausbeutens der Natur durch uns Menschen plakativ. Damit wurde er zu einem Vordenker der Umweltbewegung. Also statt eines „Ich kam, sah und siegte“, besser ein „Ich sehe, kapiere und handele als ein Teil des ganzen Systems“. Die Ökologie steht für eine Systemwissenschaft, da in ihr Erkenntnisse aus vielen anderen, naturwissenschaftlichen Disziplinen wie in einer Regentonne zusammenfließen. Das macht es nicht gerade einfacher.
Aber wie entstehen eigentlich Ökosysteme und wie sieht ein klassisches Start-Up dieser Branche aus? Zu Beginn werden erst mal wenige Beziehungen aufgebaut, weil nur ein paar versprengte Organismen zur Stelle sind, die Interesse an solch rohen Bedingungen haben könnten. Es ist eben alles noch ziemlich wüst und leer. Ein Vulkanausbruch oder eine Überschwemmung hat soeben stattgefunden. Pionierpflanzen sind die ersten Mutigen, die diesen neu entstandenen Lebensraum erobern. Das ein oder andere nützliche Bakterium sollte im Boden vorhanden sein und das ein oder andere Bienchen als Bestäuber vorbeikommen. Besonders stabil ist dieses Unternehmen allerdings nicht gerade. Falls trotz widriger Umstände die Start-Up Idee einschlägt, erfolgt in der zweiten Ausbaustufe ein reger Zuwachs. Alles wird vielfältiger und dichter. Neue Verknüpfungen und Verbindungen entstehen, neue Mitarbeiter ergänzen die kleine Start-Up-Truppe und lange Kontaktlisten potenzieller Geschäftspartner werden geführt. Aber die Qualität dieser Beziehungen ähnelt der von Teenagern, die sich schnell mit vielen Gleichaltrigen anfreunden. Superstabil und lebenslang halten diese vielen Bindungen selten. Später hingegen, in einem highend Ökosystem und in einem fortgeschrittenen Menschenleben, unterhält nicht jeder mit jedem eine Beziehung. Notwendigkeiten und Vorlieben bilden jetzt Vernetzungen, die über mal dicke und mal weniger dicke Knoten gebündelt sind. Knoten bringen richtig Stabilität ins System. Das neuronale Netzwerk im Gehirn des Homo Sapiens – es soll das komplexeste System des Universums sein - hat sich das abgeguckt und funktioniert auch über solch Knotenpunkte. Und selbst U-Bahn-Netze konnten nicht widerstehen beim Streber Ökosystem abzukupfern. Jeder kennt die Abbildungen von Nervensystemen oder U-Bahn-Netzen.
Somit sind einige Ökosysteme, die schon lange unter ähnlichen klimatischen Bedingungen existieren durften und viele Knoten bilden konnten, sehr stabil. Das bedeutet: je älter und betagter, desto elastischer, stabiler und resilienter. Auch deshalb beherbergen die Regenwälder der tropischen Zonen die artenreichsten und komplexesten Ökosysteme der Erde. Sie konnten immer wieder ausprobieren, verwerfen, weiterentwickeln. Tropenbewohner hatten eben viel Glück. Kaltzeiten gingen an ihnen ziemlich glimpflich vorbei. Alt sein ist hier prima und macht fit gegen Aussterben.
Normalerweise hält sich eine Art durchschnittlich ein bis zehn Millionen Jahre in einem stabilen Ökosystem. Dann jedoch ist die Zeit reif für den nächsten Schritt: Weiterentwickeln, Aufspalten oder Aussterben. In der Regel folgt das Aufspalten und somit eine Zunahme an Arten. Die jetzt gemäßigten Zonen der nördlichen Halbkugel mussten sich hingegen öfter mal mit einem fetten Eispanzer herumschlagen. Das fanden die meisten Lebewesen im echten Leben mitunter nicht ganz so lustig wie das Säbelzahn-Eichhörnchen aus „Ice Age“, das immerzu fröhlich plappernd hinter seiner Eichel her hüpfte.
Die Hauptschuld an der deutlich schlechteren Laune der Organismen während der Kaltzeiten trägt das Wasser. Es transportiert lebensnotwendige Nährstoffe nun mal in flüssigem und nicht in gefrorenem Zustand. Wasser gilt als der Logistikdienstleister des Lebens und Transport gehört zu seinen Kernkompetenzen im Erdsystem. Ständig schafft es alle möglichen wasserlöslichen Stoffe wie Mineralien, Zucker, Sauerstoff oder Hormone in alle möglichen Ecken der Organismen auf dieser Erde und wieder hinaus. Und es transportiert selbst Unlösliches als Baumaterial für Ökosysteme: Kies für Kiesbänke, Steinbrocken für Steinhaufen, Schlämme und Stäube für fruchtbare Böden. Alles hält es im Fluss und gestaltet und designt. Weil das Wasser aber in Mitteleuropa bis vor ungefähr 10.000 Jahre sehr lange als Gletschereis existierte, gibt es hier nur 2.700 Arten an Gefäßpflanzen, im indonesischen Regenwald hingegen 45.000. Zeit bedeutet hier Vielfalt.
Stabile und gesunde Ökosysteme können elastisch auf Störungen von außen reagieren. Sie verhalten sich nicht so starr wie die Gummimatte an der Eishockeybande, an der der Puck abprallt, sondern federn ab wie das superelastische Spinnennetzt oder der grob gestrickte Wollpullover. Netz und Pulli halten das locker aus, wenn mal der ein oder andere an der ein oder anderen Ecke zerrt und dabei aus Versehen sogar eine Laufmasche macht. Fällt eine Art aus, kann eine andere einspringen oder es ist schlichtweg genug Zeit, dass sich neue Arten entwickeln, die die entstandene Nische nutzen. Locker kann das Loch gestopft, die Laufmasche aufgefangen werden. Biologen nennen das Resilienz.
Dabei gibt es aber auch Arten, die für ein Ökosystem bedeutender sind als andere Arten. Sie heißen Schlusssteinarten und sind, wie beim Bogenmauern, unentbehrlich für das Gesamtsystem. Fehlt diese eine Art, bricht das ganze System zusammen, wie es der gemauerte Bogen letztendlich ohne seinen letzten Stein tun wird, wenn Belastungen auf ihn zukommen. In diesem Konzept wird klar, dass nicht jede Art die gleiche Bedeutung für das Funktionieren eines Ökosystems besitzt. Oftmals treten diese Schlusssteinarten als „Endkonsumenten“ wie große Pflanzenfresser oder wie ein Wolf auf. Und weil Wölfe in europäischen Wäldern nach wie vor noch fehlen, sind Jäger heute die Wölfe im Wolfspelz. Schlusssteinarten können aber auch Tiere sein, die ihren Lebensraum aktiv gestalten. Der Specht gehört dazu. Er haut Nisthöhlen ins Holz und schafft damit nicht nur für sich selbst Wohnraum, sondern auch für viele andere Ökosystemkollegen wie Eule, Marder, Meise, Siebenschläfer, Käfer, Wildbiene und Hummel, die sich gerne als Nachmieter in die Warteschlange einreihen. Denn all diesen Zweitnutzern fehlt ein starker Schnabel, scharfe Zähne oder Krallen, um Löcher ins Holz zu hauen, beißen oder kratzen. Und vielleicht bildet sogar eine winzige Orchideenbiene die Schlusssteinart für die oberste Etage bestimmter Regenwälder, weil nur sie allein die Paranussbäume bestäubt.
Dringt jedoch der Mensch in solch ein funktionierendes Ökosystem ein und randaliert, überschlagen sich die Ereignisse. Nun wird es eng für das Überleben des ganzen Ökosystems. Holzt er die Bäume im Regenwald großflächig ab, bricht das gesamte Stützkorsett dieses Ökosystems mit Krawumm weg und das strukturgebende Element der dritten Dimension verschwindet. Das bedeutet Kriegszustand. Mit Flucht, Vertreibung und dem ganzen dazugehörigen Elend. Einigermaßen Glück haben noch Tiere mit schnellen Beinen oder Flügeln. Ihre mobilen Ausstattungen nützen aber nur dann, wenn die Umgebung Unterkünfte mit entsprechender Infrastruktur bietet. Zudem beeinflusst das Abholzen abiotische Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Temperatur, Regenhäufigkeit - kurzum das gesamte Mikroklima. Der Boden, Lebensraum für unzählige Arten, sieht sich völlig anderen Bedingungen ausgesetzt. Urplötzlich wird es hier superheiß, die Temperatur verdoppelt sich. Regen prasselt ungebremst auf ungeschützte Erde und spült ihre dünne Humusschicht weg. Selbst wenn bei der ganzen Aktion nur 50 Prozent des Waldes verschwinden sollte, trocknet der Boden aus und der Wald verschwindet. Dabei lebt ausgerechnet der Dschungel vom Umsatz und nicht von der Substanz. Ist der Mensch wieder abgezogen, weil es für ihn nichts mehr zu holen gibt, wagt sich kein Keimling aus dem Häuschen. Das schattige und feuchte Klima des Regenwaldes als Kinderstube fehlt. Da geht dann erst mal gar nichts mehr. Nur unter großen Anstrengungen, Glück und viel Zeit entsteht ein schwächerer und viel artenärmerer Sekundärwald. Damit daraus wieder das echte Ökosystem Primärwald mit einem dichten Netz an Artenvielfalt wird, braucht es mindestens 500 Jahre Ruhe und Ungestörtheit. Die Aussichten darauf sind im Moment nicht optimal.
Hot Spots
Nun hat es die Natur so eingerichtet, dass Biodiversität nicht gerade schön gleichmäßig über den Erdball verteilt vorkommt. In den Tropen brummt das Biodiversitätsgeschäft, in arktischen Gebieten dümpelt es eher vor sich hin. Eine Faustregel lautet: je wärmer und feuchter eine Region ist, desto vielfältiger und bunter das Leben. Im Bauchspeck der Erde, am Äquatorgürtel, trifft man deshalb die meisten Arten an. Das hat erstens einmal mit dem fehlenden Eis während vieler Kälteperioden zu tun. Und zweitens fühlt sich das Leben in diesem Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich einfach am wohlsten, weil viele Prozesse hier im Optimum laufen. Die meisten Enzyme lieben schließlich moderate Temperaturen im dreißiger Bereich.
Der hotteste Hot-Spot der biologischen Vielfalt befindet sich in Ecuador. Der Yasuni-Nationalpark ist stolzer Besitzer der wahrscheinlich höchsten Biodiversität auf dieser Erde. 132 Kolibriarten, 7000 Schmetterlingsarten sind identifiziert und vier bis sechs Millionen Insektenarten werden vermutet. Ein einziger Urwaldriese, schmückt sich mit 98 verschiedenen Orchideenarten und mehr Insektenarten als ganz good old Europe. Warum ist das so? Auch hier gilt ein Leitsatz aus der Immobilienbranche: Lage, Lage, Lage. Der Yasuni liegt am Äquator mit hunderttausenden von Jahren idealer Geschäftsbedingungen für die Evolution. Vom sumpfigen Amazonasbecken bis zum 6000 Meter hohen Andenkamm. Von flach zu hoch garantiert diese Lage vielfältigstes Klima, Material und Struktur. Leider rollen jetzt die Bagger und Motorsägen kreischen, nachdem die Weltgemeinschaft dramatischerweise nicht in der Lage war, 3,5 Milliarden Dollar in einen ecuadorianischen Umweltfond einzuzahlen. Das wäre die Hälfte des Wertes, des unter dem Yasuni-Erdboden lagernden Erdöls gewesen und hätte Ecuador dazu bewogen, das Erdöl dort zu lassen, wo es ist. Ein fabelhaft deprimierendes Beispiel, für das was wirklich zählt.
Insgesamt 34 Hotspots für Biodiversität wurden weltweit definiert. Um auf dieses Hotspot-Treppchen zu klettern, sollte man mindestens 1500 endemische Arten von Gefäßpflanzen vorweisen. Immerhin zwei Hotspots konnte das seit Jahrhunderten überbevölkerte Europa ergattern: das mediterrane Becken und den Kaukasus als Grenze zu Asien.
Naturschutz schützt, aber…
Mit Naturschutz könnte man den Schutz der Biodiversität zwar ganz gut eindeutschen – immerhin beinhaltet er alle drei Aspekte: Genetik, Arten, Lebensräume und sogar noch viel mehr. Konkrete Handlungen und politischen Diskurs, beispielsweise. Ungeheuer wichtig, hat Naturschutz unglückerweise ein Akzeptanzproblem. Immer noch umweht ihn ein wenig der Hauch von selbstgestrickten Schafwollsocken (kratzige!) in Biolatschen. Immer noch liegt er nicht so richtig im Trend, trotz Demonstrationen fürs Klima und Artenschutzbegehren. Schließlich beschränken Naturschützer quasi von Natur aus. Beschränken Möglichkeiten, Visionen und Fantasien des immer mehr und immer Größer - also begrenzen ganz ureigene, menschliche Eigenschaften. Oft gelten sie als Verhinderer und Rückwärtsdreher und leider so gar nicht als Innovatoren. Naturschutz kommt inmitten von IT-Hype, künstlicher Intelligenz und pathologischem Innovationszwang mächtig angestaubt daher. All das macht Naturschutz für viele Businessmenschen unsympathisch.
Umweltingenieure verhielten sich taktischer. Sie haben sich ein deutlich cooleres Image –passend zu unserer technikverliebten Gesellschaft – zugelegt. Menschbezogener, uns ganz direkt nützlich und damit schlichtweg näher an uns dran. Mittels technischer Errungenschaften reinigen sie Luft, Wasser und Boden von unseren Schadstoffen und versorgen uns Energiejunkies. Immerhin verbraucht ein Homo Sapienser abendländischen Lebensstils mindestens das Hundertfache an Energie, die sein Körper mit 24 Stunden härtester Bergwerksarbeit selbst erzeugen könnte. Für diesen Energiehunger entwickeln sie uns krasse Windräder, funkelnde Solarplatten und clevere Speicher, damit wir schnurrende E-Vehikel und viele weitere smarte Dinge auch daheim betreiben können. Schlaue Kühlschränke und Heizungen unterhalten sich dann schon mal mit unseren Smart Phones.
Sie garantieren unseren komfortablen Lebensstil und liefern netterweise auch gleich das gute Gewissen mit.
Unzählige Studiengänge schießen wie Pilze aus dem Boden, die im Titel irgendwas mit Erneuerbar, Energie, Nachhaltigkeit tragen. Aber Biodiversität, Naturschutz, Ökologie? Sie gelten nach wie vor als Orchideenfächer und besetzen lediglich eine schützenswerte ökologische Nische unserer Hochschullandschaft. Besonders im Vergleich zu Studiengängen einer anderen Öko-Branche, nämlich die der Ökonomie. Denn wie so oft in unserem echten Leben, sticht auch bei der Anzahl der Studiengänge die Ökonomie die Ökologie. Geld wird eben in der Ökonomie gedruckt und nicht in der Ökologie – denkt man.
Das Business der Ökosysteme
Aber brauchen wir denn tatsächlich Biodiversität? Ist sie für uns wirklich wichtig? Und ist das denn überhaupt ein Business Modell? Drei Fragen – eine klare Antwort: Ja! Natur macht all das schon immer. Und sogar wesentlich effektiver und nebenwirkungsfreier als unsere technischen Krücken.
Dabei tranchieren und filetieren Pflanzen, Bakterien und Pilze unermüdlich Schadstoffe. Im Boden, in der Luft, im Wasser futtern sie sie weg. Pflanzen verarbeiten gemeinsam mit Algen Kohlendioxid, generieren mit Hilfe ihrer genialen Photosyntheseenzyme Sauerstoff und Pflanzenmassen als die Ernährungsgrundlage ihrer tierischen Mitbewohner. Sie liefern die essbare, schmackhafte und brennbare Energie für diesen Planeten. Sonnenstrahlen direkt zu kauen ist genauso wirkungslos wie Geld zu verzehren. Unbekömmlich und frei von jeglicher Kulinarik. Und ganz egal, ob Pflanzenmaterial gefressen, gegessen oder eben verbrannt wird. Jedes Mal findet eine Art Verbrennung statt. Entweder im Stoffwechsel der Tiere oder in der Flamme. Beim Brennen entsteht Kohlendioxid und der Kreis hat sich geschlossen. Aber Pflanzen legen auch Blatt an, um organische Schadstoffe wie Formaldehyd, Benzol oder Triclosan abzubauen, die aus Abwasser, Abrieb, Ausdünstungen und Abgasen stammen. Spezielle Bakterien- und Pilzarten können chemische Verbindungen knacken und mitunter einen gesunden Appetit auf giftige Chemikalien entwickeln. Besonders gut funktionieren sie häufig in Kooperation. Beliebt sind bei manchen dieser Teams aus der Sanierungssparte besondere Schmankerl wie Erdöl im Boden oder Beta-Blocker und Antibabypillen aus den Kläranlagen.
Diese Dienstleistungen, die die Natur an uns abdrückt, heißen Ökosystemdienstleistungen. Wissenschaftler meinen damit, dass Ökosysteme sich darum kümmern, Luft, Wasser, Böden wieder sauber und gesund zu machen, Bestäubung und damit Nahrung und Rohstoffe zu garantieren und uns nebenbei auch noch zu entspannen und zu erfreuen. Für uns Menschen ergibt das das Business Modell schlechthin. Denn die Natur besitzt noch keine IBAN-Nummer, auf die wir Geld überweisen müssen, wenn wir frische Luft atmen oder in Blütenduft schwelgen. Würde auch hier das aktuelle Wirtschaftsmodell gelten, wäre der Atemzug an einem schönen Sommertag günstiger zu haben als an einem trüben Tag im November mit deutlich eingeschränkter Photosyntheseleistung. Angebot und Nachfrage. Also im Winter besser die Luft anhalten, wenn es mal soweit ist. Bisher ist Natur ein 24/7/365-Selbstbedienungsladen ohne Kasse.
Eine Untersuchung der Vereinten Nationen (Millemium Ecosystem Assessment) hat jedoch gezeigt, dass sich die Erde bereits 2005 im Zustand der Degradation - also schwer im Sinkflug – befand. 15 der 24 Ökosystemdienstleistungen wie etwa die Wasserversorgung galten schon damals als schwer geschädigt oder anhaltend zerstört mit einem unumkehrbaren Verlust an Biodiversität.
Rohstoffe stellen im weiteren Sinne auch nichts anderes dar als Natur – Naturmaterialien aus belebter oder unbelebter Materie. Und egal, ob das Erdöl, die Manganknollen aus der Tiefsee, die Mohrrübe aus dem Boden, die Bergwanderung - nirgendwo bezahlen wir für die Leistungen der Natur. Das Mitnehmen oder der Eintritt ist frei. Das einzige, für das wir an der realen Kasse bezahlen, ist unsere Arbeitszeit und unser Gewinn. Der Benzinpreis enthält nur Kosten für Förderung, Transport, Aufbereitung, Logistik, Infrastruktur, Steuern, Knappheit und Gewinn. Die Natur als Erzeuger geht dabei leer aus und wird in der Regel bei vielen Zwischenschritten zudem noch geschädigt. Die Ressource „Erdöl“ ist für lau zu haben und derjenige, der sie entdeckt oder dem das Land gehört, auf dem sie lagert, kann sie ausbeuten. Beute machen, ohne dafür zu bezahlen. Davon leben dann zumindest Ölscheichs einigermaßen passabel.
Auch bei der Ressource „Boden“ verhält es sich mittlerweile ähnlich. Das war aber noch nicht immer so. Im Frühmittelalter nutzten Gemeindemitglieder große Bereiche des Landes gemeinsam - Almende genannt. Die Indianer praktizierten dieses Modell sogar noch bis zum Eintreffen des weißen Mannes. Heute dürfen sie das Land ihrer Väter teuer von der katholischen Kirche zurückkaufen.
„Landveredeln“ findet mittlerweile fast überall statt: Urwald wird in Kulturland, Kulturland in Bauland umgewandelt und für viele Euros oder Dollar verkauft. Ungewöhnliche Veredelung, wenn aus üppigem Regenwald Sojawüsten und aus bunten Hummelwiesen tolle ABC-Architektur wird - Asphalt, Beton, Cotoneaster. Zwar erleben wir eine extreme Dollar-Sicht auf Welt und Natur, aber eben nicht bis in ihre letzte Konsequenz, da ausgerechnet der Erzeuger leer ausgeht.
Und genau hieraus resultiert das Hauptproblem für die Biodiversität in unserer monetisierten Welt: Was nix kostet, ist nix wert. Ideen, der Ressource einen Preis zu geben, um mit diesen Einnahmen Ressourcensicherung und Naturschutz zu betreiben, existieren schon länger. Diese Preise sind schwer zu bestimmen und der Ansatz würde einen globalen Systemwechsel mit vielen Gesetzen und vor allem auch Gesetzesvollzug bedeuten. Negative Umweltauswirkungen, die ein Produkt auf seinem Lebensweg verursacht, trägt bisher häufig genauso die Allgemeinheit wie im Falle von Zubetonierung, Lärm und Atomendlager. Eine Ausnahme dazu existiert jedoch bereits europa- und kalifornienweit: den Emissionshandel. Die Deponierung des Abfallstoffes Kohlendioxid in der Luft kostet Bares – zumindest für die Industriezweige, die viel davon verursachen wie die fossile Energiebranche. Dies entspricht zwar nichts weiter als einem Ablasshandel, aber je mehr Geld dieser kostet, desto stärker die Motivation zur Vermeidung von Klimasünden. Ein erster Schritt.
Der zweite, konsequente Schritt würde bedeuten auch den Ökosystemdienstleistungen ein Preisschild zu verpassen. Und wieder war es Frederic Vester, der einen Vorstoß wagte und einfach mal den Wert eines Blaukehlchens (das sieht aus wie Rotkehlchen in Blau) zu berechnen. Der rein materielle Wert liegt bei zwei Euro, Federn und Fleisch inklusive. Beim volkswirtschaftlichen Wert kam er schon auf 154 Euro, weil das Blaukehlchen Schadinsekten vertilgt, Samen verbreitet und schlichtweg mit Gesang und Anblick erfreut. Das war 1983. Die 2011 aktualisierte Zahl, die auch indirekte Faktoren wie eine Kohlenstoffspeicherung (Samenverbreitung fördert Pflanzenwachstum, Pflanzenwachstum fördert Kohlendioxid-Bindung) mitberücksichtigte, liegt etwas höher: bei 53.000 Euro - zugegebenermaßen für ein Pärchen. Dafür bekommt man schon einen mittleren SUV im Sonderangebot. Aber welch Glück für Katzenbesitzer! Sie müssen noch keine Strafe für die täglichen Verbrechen ihrer Kuscheltiere an Singvögeln zahlen.
Im gesunden Zustand zeigen Ökosysteme enorme Manpower und wahres Engagement, die ganze, von uns stammende Sauerei wegzuputzen – aber eben nur bis zu einem bestimmten Grad. Irgendwann ist auch dieses System gesättigt und eine unsichtbare Schwelle erreicht, an der die Badewanne überschwappt, der vollgesogene Schwamm alles volltropft und selbst Bakterien und Pilze bulimisch reagieren. Genau das passiert gerade.
Von Planetaren Grenzen und Tortenstücken oder: Hinterm Horizont geht’s nicht weiter und zu viel Torte ist auch ungesund
Diese unsichtbaren Bakterienkotzschwellen nennt man planetare Grenzen. Etwas wissenschaftlicher ausgedrückt definieren diese globalen und biophysikalischen Grenzen den sicheren Handlungsspielraum für uns Menschen auf dieser Erde. Schadensgrenzen erkennen, um zu wissen, wann mit unserem komfortablen und gemütlichen Leben hier auf Erden Schluss sein könnte, sollte man natürlich besser im Vorfeld. Dann könnte man dem Captain der Weltgemeinschaft noch melden, man segle mit heftigem Rückenwind direkt auf einen riesigen und gefährlichen Eisberg zu. Dieser Ausguck am Segelmast heißt offiziell Erdsystemforschung.
Eine Disziplin, die in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts aufkam als der Captain einer Raumfähre, Major Tom, die Erde vom Weltraum aus sah und als ein einziges, zusammenhängendes, dynamisches System begriff. Diese Disziplin beschäftigt sich heute damit, uns klar zu machen, wann die geochemischen Kapazitäten des Erdsystems erschöpft kapitulieren. Oder die Gülle vom Rand der Scheibe runter ins Weltall tropft, wenn die Erde noch eine Scheibe wäre. Um das vorhersagen zu können, muss man messen, messen und nochmals messen - und rechnen und modellieren und prognostizieren. Alles Mögliche: physikalische, chemische, biologische Werte, Prozesse und Wechselwirkungen, aber auch gesellschaftliche Komponenten sind von Bedeutung. Diese Ergebnisse müssen eingetütet, in Relation zueinander und in Relation zu den Kapazitäten der Erde gesetzt werden. Knapp 30 richtig intelligente Leute, das Sahnehäubchen unserer Naturwissenschaft, die Creme de la Creme – es befinden sich schließlich etliche Nobelpreisträger unter ihnen – haben ihre Köpfe zusammengesteckt. Sie wollten auf einen Nenner bringen was unsere Erde gerade noch an Zumutungen verträgt, damit auch unsere Enkel noch auf ihr und von ihr leben können.
Herausgekommen sind dabei die „planetaren Grenzen“, veröffentlicht als erstes vom Forscher Rockström im Jahr 2009. Darunter darf man sich keine echten Grenzen mit Stacheldraht oder Mauer vorstellen, sondern eine Torte. Diese Torte besitzt nicht die gewöhnlichen zwölf Stücke wie beim Konditor um die Ecke, sondern neun unterschiedlich lange und demzufolge unterschiedlich dicke Tortenstücke mit verschiedenen Namensschildchen dran.
Statt Erdbeer-Sahne-Torte, Prinzregententorte oder Schwarzwälder Kirschtorte stehen so Namen wie „Versauerung der Meere“, „Ozonabbau“, „Landnutzungsänderungen“, „Stickstoffverfügbarkeit“ und eben auch „Verlust der Biodiversität“ drauf. Nicht lecker. Das besondere und entscheidende hierbei: Die Torte besitzt drei verschiedene ringförmige Zonen. Die Mitte als innerste Zone ist grün gefärbt und bedeutet: „alles safe“. Solange sich der Homo Sapiens innerhalb dieses grünen Ringes auf einem der Tortenstückchen herumtummelt, befindet er sich innerhalb der planetaren Grenzen und damit in Sicherheit. Diesem folgt ein gelber Ring – da wird es kritisch. Es hakt und kriselt an der ein oder anderen Stelle bereits. Im äußeren roten Ring jedoch ist die Stimmung düster. Hier läuft bereits „Spiel mir das Lied vom Tod“ als Dauerschleife. Nicht als Kugel aus dem Colt, sondern als schleichendes Gift mit dafür qualvollerem Endergebnis. Das Erdsystem ist an dieser Stelle aus dem Ruder gelaufen und das bedeutet allerhöchste Gefahr, auch für die Weiterexistenz unseres Homo Sapiens.
Einige wenige dieser Tortenstücke sind bescheiden und begnügen sich tatsächlich mit nur einem kleinen Radius um den grünen Tortenmittelpunkt, dem grünen Bereich. Sie sind kurz, schlank und kommen geradezu diätisch daher, wie der „stratosphärische Ozonabbau“ (darunter versteht man die Zerstörung der in zehn Kilometer Höhe liegenden und vor Hautkrebs schützenden Ozonschicht). In diesem Fall hat es die Weltgemeinschaft doch tatsächlich noch einmal geschafft das Steuerrad rechtzeitig herumzureißen. Denn diese Kategorie sah auch schon mal deutlich schlechter aus. Etliche von Ihnen mögen sich noch an die Zeiten stark erhöhter Hauskrebsgefahr durch ein Sonnenbad erinnern. Mit dem Protokoll von Montreal aber wurden dann 1987 die ozonschichtzerstörenden FCKWs verboten. Und siehe da: nach einigen Jahren erholte sich die Ozonschicht wieder. Geht doch!
Gelb: Hier heißt es Achtung, bremsbereit sein! Wie beim Klimawandel. Da beginnen schon die Gletscher und Polkappen zu schmelzen, die Permafrostböden aufzutauen, Hitze, Kälte, sintflutartige Regenfälle und Dürren sich abzuwechseln und in Franken der Rotweinanbau lukrativ und kulinarisch zu werden. Auch weitere Tortenstücke blähen sich zunehmend auf. Sie werden dicker und größer und wachsen weit in den gelben Bereich hinein. Ein Beispiel dafür ist die „Landnutzungsänderung“ – das bedeutet so viel wie Soja statt Regenwald, Industriegebiet statt Bienenwiese oder Betonflussbett statt fröhlich sprudelndem Gebirgsbach. Oder nehmen wir das Tortenstück „Ozeanversauerung“ – hier löst sich das viele Kohlendioxid aus der Luft im immer wärmer werdenden Meereswasser und bildet Kohlensäure, die Korallen einfach wegätzt wie der Essigreiniger den fiesen Kalkrand im Waschbecken.
Rot: Das Tortenstück „Verlust der Biodiversität“ jedoch ist das Fetteste unter ihnen mit bereits manifestiertem, metabolischem Syndrom. Es sprengt alle Hosengürtel. Dabei überragt es haushoch alle anderen Tortenstücke wie den Klimawandel, die Wassernutzung oder die Landnutzungsänderung. Planetare Grenzen Adieu!
In der Rockström‘schen Darstellung wird sofort klar, dass wir tatsächlich das allergrößte Problem auf diesem Planeten mit dem Verlust der Biodiversität haben. Nicht mit dem Klimawandel, wie wir das zurzeit häufig noch glauben. Klimawandel ist schlimm genug, aber bei weitem nicht alles, was wir gerade verursachen. Näher betrachtet wird dabei recht schnell klar, weshalb der Verlust der Biodiversität an erster Stelle steht.
Biodiversität - ähnlich wie die Gesundheit - gehört zu den sogenannten „Endpoint-Kategorien“. Unterschiedlichste Faktoren fließen hier zusammen und sammeln sich darin wie das Wasser mehrerer Regenrinnen in nur einer Regentonne. Die läuft auch ruck zuck über. In die Regentonne, auf der Gesundheit draufsteht, fließen solch Faktoren wie ungesunde Ernährung, wenig Bewegung, Stress, Schlafmangel, Lärm, Luftverschmutzung, Rauchen, zu viel UV-Strahlung oder schlechte Laune. In die Biodiversitätstonne fließen alle menschgemachten Einflüsse auf das Erdsystem und üben Druck aus wie Stickstoffüberfluss, Ozeanversauerung, chemische Verschmutzung, Landnutzungsänderung und eben Klimaerwärmung. Biodiversität fungiert stets als die Regentonne aller anthropogenen, ökologischen Einflüsse.
Nehmen wir als konkretes Beispiel das Ökosystem „Fluss“. Hier kann man glasklar erkennen, wie so etwas läuft. Statt wie ehemals munter und sauerstoffreich dahinsprudeln, über Steine hüpfen und sich in die Kurven legen, wabert er jetzt unter Atemnot trüb und schnurgerade begradigt im Steinbett dahin. Wenn es hochkommt, ab und zu mal eine Staustufe. Das ist alles an Abwechslung und Luftholen. Angrenzende Landwirtschaft spült Dünger, Pestizide und Humus in den Fluss. Das Wasser wird trüb und braun. Aber auch die Industriebetriebe und Kläranlagen liefern Abwässer versetzt mit Schad- und Nährstoffen. Algen können jetzt besonders gut wachsen. Das Kernkraftwerk entnimmt Unmengen Wasser für seine Kühltürme und das Gaskraftwerk erhöht die Temperatur des Flusses mit dem Einleiten seines Kühlwassers. Der Klimawandel führt dazu, dass das Wasser noch wärmer wird. Für viele Organismen wird es jetzt besonders im Sommer eklig warm. Zu allem Überfluss kommen noch Invasoren hinzu. So nennen Biologen Pflanzen und Tiere mit oft unfreiwilligem Migrationshintergrund. Sie bringen das Gleichgewicht des Ökosystems im Fluss zusätzlich zum Taumeln. All diese Faktoren bezeichnet man als sogenannte „Mid-Point-Kategorien“, die in der „End-Point-Kategorie“ Biodiversität, hier der des Flusses, zusammenlaufen und diesen toxischen Cocktail bilden.
Klimawandel verändert das Klima – schlimm genug, aber Verlust der Biodiversität verändert alles. Deswegen wächst das Tortenstück mit dem Namensschildchen „Verlust der Biodiversität“ zum mächtigsten und unverdaulichsten heran. Quasi zur Kalorienbombe für die eigentlich streng unter Diät Stehenden. Und Herr Atlas stöhnt bereits mächtig unter seiner Last.
Seit der Industrialisierung greift unser Homo Sapiens erstmalig so massiv und spürbar ins Erdsystem ein, weshalb man an dieser Stelle auch gerne vom „Anthropozän“ als letztes der bisherigen „Zäns“ unserer Erdneuzeit spricht. Angefangen vor 66 Millionen Jahre beim Paleozän bis zum Holozän, und eben das vor ungefähr 250 Jahren begonnene Anthropozän.
Bereits ein Klimawandel ist komplex, sehr komplex. Zigtausende Wissenschaftler messen, modellieren, berechnen und versuchen die Daten zusammen zu führen und zu interpretieren. Immerhin weiß man hier schon exakt wie die wichtigsten kritischen Klimagase heißen. Denn das sind gerade mal ganze vier Stück: Kohlendioxid, Methan, Lachgas und die Gruppe der Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Im Falle der Biodiversität wissen wir jedoch noch nicht einmal was sich auf diesem Planeten so alles herumtreibt. Sind es zwei Millionen, zehn Millionen oder doch hundert Millionen Arten, die die Erde „Heimat“ nennen? Diese gerade mal vier klimawirksamen Gase auf dem Tortenstück zum Klimawandel entsprechen den x Millionen Arten auf dem Tortenstück zum Verlust der Biodiversität.
Zweiter Punkt: Man weiß ziemlich exakt wie stark die Klimagase wirken. Deshalb kann man sie alle simpel in Kohlendioxidäquivalente umrechnen. Das ist praktisch. Also ein Methanmolekül wirkt dann so stark wie etwa 23 Moleküle Kohlendioxid. Damit könnte man einfach ausrechnen, dass einmal Kuhpupsen meinetwegen drei Kilometer Porschefahren entspricht. Aber solch schlichte Kuhpupsrechnungen im Dreisatzmodus à la: ein Blaukehlchen entspricht fünf Orchideen funktionieren in der Biodiversität leider nicht.
Hummeln lassen sich nicht in Schmetterlinge, Vögel nicht in Blumen umrechnen und nicht mal Blaukehlchen in Rotkehlchen. Biodiversität funktioniert mehrdimensional, systemisch, nicht linear und lässt sich somit bisher kaum bewerten.
Dritter Punkt: Kohlendioxid ist wirklich ein ziemlich schlichter Geselle: Egal wo es auf der Welt entsteht, wirkt es gleich. Ein Molekül Kohlendioxid aus Honolulu wirkt genauso stark auf das Klima wie eins aus Buxtehude. Deswegen kommen hier simple Grundrechenarten wie Addition und Subtraktion in Frage. Auch diese funktionieren in der Biodiversität leider nicht. Gilt eine Art in einer Region als fast ausgestorben, kann sie durchaus woanders noch massenweise auftreten.
Aber selbst beim Klimawandel wird es, trotz des schlichten Charakters seiner klimawirksamen Gase, letztendlich dann doch noch kompliziert. Sobald man eine Stufe höher steigt und sich mit ihren vielfältigen Wechselwirkungen, Rückkopplungs- und Verstärkungseffekten anderer geochemischer Parameter beschäftigt, wird das Ganze systemisch und für ein Menschenhirn kompliziert. Deshalb streiten auch schon mal Klimaforscher, ob jetzt der ein oder andere Aspekt eher zu einer Klimaerwärmung oder vielleicht doch sogar zu einer Abkühlung führen könnte.
Wie in der belebten Natur in einer nächsten Stufe all die unzähligen Arten miteinander agieren, nennt man funktionale Biodiversität oder auch Synökologie. Sie will mehr wissen als bloße Artenzahlen, sie will das große Ganze verstehen. Sie analysiert die Wechselwirkungen innerhalb einer Artengemeinschaft, innerhalb eines Ökosystems und schaut sich ebenso Rückkopplungsfunktionen bestimmter Organismen an. Ein historisches Beispiel: Fischotter wurden wegen ihrer Fischverfressenheit und ihres schönen Fells gejagt. Fischotter fressen aber nicht nur Fisch, sondern auch Seeigel. Und letztere dachten: „Heya, Fischotter sind weg, Party - wir können uns prima vermehren!“. Seeigel haben aber die äußerst schlechte Angewohnheit nicht nur abgefaultes Seegras, sondern frische Seegraswiesen wie moderne Mähroboter abzuweiden, was diese stark dezimierte. Viele Fischarten benutzen aber gerade diese Seegraswiesen als ihre Kinderzimmer. Und schwups, obwohl man eine Fischräuber fast ausgerottet hatte, nahmen die Fischbestände dramatisch ab anstatt zu. Man merkt: Selbst für solch vermeintlich simplen Beispiele Vorhersagen zu machen, ist immer noch unfassbar kompliziert und macht deutlich, dass der Forschungszweig der Synökologie gerade erst die Kinderkrippe besucht.
Klimawandel hat wenigstens noch ein klein wenig Glück im Unglück. Denn immerhin hat er mittlerweile Promistatus durch einen Ritterschlag zum Megatrend erlangt. Das konnte passieren, weil er so allumfassend sichtbar und auf Dauer unser Leben verändern wird. Wetterextreme sind leicht spürbar und Überschwemmungen, Stürme, Dürren und Hitzewellen lassen keinen kalt. Dass selbst methanpupsende und methanrülpsende Kühe zum Klimawandel beitragen, weiß mittlerweile jedes Kindergartenkind. Jedenfalls macht sich auch schon mal eine Weltgemeinschaft Sorgen um ihn und stellt dies auf regelmäßig wiederkehrenden Klimagipfeln immer wieder fest. Und dennoch, obwohl die Notwendigkeit eines Handelns bereits in der Hirnrinde vieler Köpfe angekommen ist, sitzt der Verhinderer zum Aktiv-Werden zwischen denselben Ohren - im Stammhirn. Dieser Uraltbereich des Gehirns ist einzig und allein auf Energiesparen aus. Beim eigenen Körper allerdings und nicht beim Erdsystem. Deshalb greift Homo Sapiens auch lieber zum Auto als zum Fahrrad – Klimawandel hin oder her. Und deshalb folgen Taten nur dort, wo die Hirnrinde das Stammhirn oder die Vernunft den Instinkt besiegt.
Biodiversität hingegen ist die noch immer ignorierte Katastrophe. Bisher scheiterte sie bereits am ersten Schritt, mal etwas tiefer in unser Bewusstsein vorzudringen. Nach wie vor erscheint sie uns verschwommen und fragmentarisch. Denn im 1000er Puzzle zu diesem Weltbild fehlen noch viele hundert Teile.
Schön und auch dringend nötig wäre es, wenn hier zigtausende Wissenschaftler mitpuzzeln würden wie es beim Klimawandel geschieht und sich Fürsprecher fänden. Leider sieht das aktuell eher mau aus. Selbst der Nachwuchs fehlt. Dringend bräuchten wir an dieser Stelle die Taxonomen aus dem Bereich der Biologie. Ihnen ergeht es jedoch mittlerweile auch wie vielen Arten. Sie sind eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Zur letzten Jahrhundertwende wurden Genetik und Biochemie immer hipper, Fördergelder und Drittmittel sprudelten. Erfolg, Ansehen und Coolness winkten. Der Molekularbiologe sucht nach DEM Krebsmedikament. Der Artenkundler sucht vielleicht nach DER Spinne. Welch Spinnerimage! Jetzt fehlen sie. Arten sterben aus und keiner bekommt es mit, weil keiner nachschauen kann. Schließlich fehlen hier spürbare Wirbelstürme und das Totenglöckchen läutet nur stumm. Ist aber eine Art erst einmal verschwunden, ist sie für immer futsch. Spüren werden wir es erst später. Das Aussterben umzukehren oder eine Resettaste zu drücken, funktioniert hier nicht. Klima pendelt sich in ferner Zeit letztendlich doch wieder ein.
Die Welt berät
Tatsächlich gibt es auf der Ebene der Weltgemeinschaft bereits seit 1948 eine internationale Union zur Bewahrung der Natur und ihrer Ressourcen. Da schlummerte ein Klimawandel noch tief im Dornröschenschlaf. Diese Union hört heute auf den Namen IUCN „International Union of Conversation of Nature“ und ist unter anderem für die internationale Rote Liste gefährdeter Arten zuständig. Viele Arten stehen mittlerweile drauf und auch Wildbienen säumen diese zahlreich. Ganz schnell wurde klar, dass Artenschutz nur über internationale Grenzen hinweg erfolgreich sein kann. Es nützt nichts Rotkehlchen in Deutschland zu schützen, nur um sie anschließend wohlgenährt und massenhaft in den Bratpfannen der Südeuropäer schmoren zu lassen.
Seit dem Erdgipfel in Rio 1992 gibt es ein UN-Übereinkommen zur Sicherung der Biodiversität. Sogar ein Weltbiodiversitätsrat analog dem Weltklimarat existiert seit 2012. Und auch innerhalb der EU gab es ein großes gemeinsames Ziel: nämlich das Artensterben bis 2020 innerhalb der EU-Grenzen zu stoppen. Krachender Bauchklatscher. Der Weltbiodiversitätsrat benennt die Gründe für das Artensterben: veränderte Landnutzung, Intensivlandwirtschaft mit Pestizideinsatz, Umweltverschmutzung, Verbreitung gebietsfremder invasiver Arten und Krankheitserreger, Klimawandel. Alles menschgemachte Dinge, deren Faktoren oft zusammen wechselwirken und sich dabei fatalerweise gegenseitig verstärken. Oft unsichtbar. Und wieder mal rutscht dieser Reigen in unserer Wahrnehmung durch.
Herr Einstein lässt zur Relativitätstheorie bitten
Ein weiterer Aspekt zur Wahrnehmung: Wir bewegen uns grundsätzlich in einer relativen Welt und nicht in einer absoluten. Das behauptete bereits Einstein mit seiner Relativitätstheorie, und dann muss es ja wohl stimmen. Wir vergleichen uns ständig mit den Klassenkameraden, den Nachbarn und Kollegen und nicht damit welche Sneakers Mister Homo Neanderthalensis seinerzeit trug und welch Boliden er fuhr. Es kommt immer auf das Bezugssystem an.
Und auch heute noch ergeht es uns ähnlich wie den Bewohnern der Osterinseln. Sie holzten über Jahrhunderte ihre einst mit Palmenwald überwucherte Insel nach und nach ab. Vermutlich mehr als zehn Millionen dieser heimischen Palmen fielen ihnen zum Opfer, um nicht zuletzt Steinklötze für den Bau ihrer kolossalen Statuen zu bewegen. Von Generation zu Generation wurde es immer weniger Wald, und jeder dachte, „Hey, kein Problem, wir haben schon immer Bäume gefällt“.
Eine gewisse Analogie findet man heute bei manch konventionellem Bauer mit Kurzzeitgedächtnis. „Das haben wir schon immer so gemacht“, wenn er von Spritzen und Düngen redet und damit gerade mal die Generation seines Großvaters meint. Denn das alte Wissen seines Urgroßvaters hat er schon längst auf dem Müllhaufen der Geschichten und Anekdoten entsorgt. Also alles ganz normal oder: So geht Wissen verloren. Erst als der letzte Baum fiel, bemerkte der Osterinsulaner: „Ups, wie transportiere ich denn jetzt meinen neuesten Opferstein?“. Und erst, wenn die letzte Wildbiene verhungert ist, sagen wir heute: „Ups, wo sind denn meine Früchte?“ Lange dauerte das mit der Zivilisation auf den Osterinseln dann auch nicht mehr. Heute liegt sie nahezu nackt im Stillen Ozean. Fast keine ursprünglichen Arten findet man mehr auf ihr. Vermutlich erging es einigen Weltkulturen genauso. Die Majas brauchten immer mehr Anbaufläche für ihren Mais, das Angkor Wat der Khmer wuchs und wuchs. War doch schon immer so. In beiden Fällen wurde immer mehr Wasser verbraucht, das regionale Klima änderte sich und der Regen blieb aus. Die Menschen verstreuten sich in alle Himmelsrichtungen und die Hochkulturen gingen den Bach runter.
Und wir? Fiel es uns tatsächlich von selbst auf, dass Windschutzscheiben nach sommerlicher Abendfahrt in den letzten Jahren blitzeblank blieben? Bemerkten wir von selbst, dass die Insekten, Bienen und Hummeln sterben wie die Fliegen? Nein. Wir brauchten dazu die Krefelder Insektenforscher, um zu sagen: „genau, stimmt, da war doch irgendetwas anders“. Wir hatten es schlicht und einfach vergessen, dass jedes Mal nach einer Ausfahrt mühsames Schrubben angesagt war, um den ganzen Insektenbatz von der Scheibe wieder runter zu kratzen („Batz“: bayerisch, wird langgesprochen und bedeutet „klebriges Zeug“).
Deshalb ist es zuweilen hilfreich über den eigenen Zeithorizont hinaus zu denken und mit Alten zu sprechen. Und siehe da, da erfährt man beispielsweise von ihnen, dass sie als minderjährige Gesellschaftsmitglieder ihren täglichen Schulkilometer tatsächlich zu Fuß bewältigt haben und nicht in Mamas‘ SUV. Ganz gesund mal diese vertikale Relation wahrzunehmen - mal nach oben und unten zu schauen und nicht immer nur nach rechts und links. Denn Veränderungen schleichen sich rein und wir glauben nach kurzer Zeit, es sei schon immer so gewesen. Angewandte Relativitätstheorie oder nur eine Folge der genialen Anpassungsfähigkeit des Menschen oder doch nur Vergesslichkeit, gemäß einem alten Gassenhauer: „… Glücklich ist, wer vergisst, was einmal gewesen ist. …“?
Big Five plus eins: Sechstes Artensterben
Trotz des enormen Kuschelfaktors ihrer Kinder ist es Fakt, dass gerade unsere wilden Großtiere alle bald verschwunden sein werden - weil ausgerottet. Das hat mehrere Gründe. Sie brauchen Platz und rauben damit viel zu viel Lebensraum ihrer Menschenkonkurrenz, benötigen lange Tragzeiten mit geringer Reproduktion, verbleiben lange im Schoße ihrer Familie. Obendrein besitzen sie einen Symbolcharakter durch ihre Stärke, Größe, Sichtbarkeit. Diese Symbolik reizt blöderweise Wilderer und Abergläubige. Letztere bezahlen Ersteren Unsummen für Nashornpulver, weil sie glauben, dass es gegen Krebs und Schnupfen helfen soll. Fingernägelkauen wird ja auch nicht als Wundermittel gepriesen, hätte aber den gleichen Effekt. Beides besteht schließlich aus Keratin. Hierbei handelt es sich tatsächlich um echte Dummheit. Oder Tigerhoden gegen Potenzprobleme. Wenn da mal endlich jeMANNd ehrlich wäre! Schnurstracks würde sich ein Tigerabschlachten in Wohlfühl-Tigerstreicheln auflösen und der WWF Unsummen in den Hummelschutz stecken können, den er jetzt für den Schutz der letzten Tiger aufbringen muss.
Und dann gibt es noch die Fraktion der völlig Bekloppten. Kaum zu fassen, man trifft sie noch immer an. Wilderer, die Geld dafür zahlen, Wildtiere einfach nur so zum Spaß abzuknallen. Sich großartig und überlegen fühlen. Wohlgemerkt mit einem Gewehr, nicht mit eigener Kraft, Geschicklichkeit oder etwa echter Intelligenz. Unfair - feige - nutzlos! Denn was fängt man bitte mit solch einem Giraffenkadaver an? Zerlegen und beim Nachbarn klingeln? „Hier, ich hab‘ mal eine Giraffe erlegt, lassen Sie es sich schmecken“, oder den Chef zum sonntäglichen Giraffenbraten einladen?
Viele Großtiere hat Homo Sapiens auf seinem Weg durch die Evolution in den vergangenen zwei Millionen Jahre bereits endgültig erlegt. Den Dodo, vermutlich auch das Mamut und den Säbelzahntiger, den Büffel Amerikas. Letzteren schoss man nur zum Spaß und Zeitvertreib ab. Kaum eines der Verbliebenen wie Tiger, Löwe, Elefant, Nashorn, Panda, Wal, Gorilla hat wirklich langfristig eine echte Chance. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Dabei hat es die Maxifauna noch vergleichsweise gut getroffen. Viele Menschen und etliche Förderprogramme aus Forschung und Wissenschaft halten Elefanten, Orang-Utangs und Eisbären als große, attraktive Arten für schützenswert. Als Botschafterarten für den Naturschutz genießen sie Promistatus. Wobei hier als Faustregel gilt: Pelz vor Federn vor Schuppen.
Diesen Bonus besitzt die Minifauna nicht – auch keine Wildbienen und Hummeln. Unscheinbar und klein, womöglich manche unsympathisch oder gar hässlich, grasen sie manchmal mit und manchmal ohne Chitinpänzerchen am Rande des Abgrundes. Kaum jemand, außer ein paar Spinnern, interessiert sich für die Ängste und zunehmenden Bedrängnisse von Schnecken, Insekten und Spinnen. Schmeißfliegen, Schleimspurzieher und Kakerlaken sind außerhalb der Ekelbranche nicht hipp. Dennoch sind es zuweilen gerade diese Aussätzigen, die als Schlüsselarten in manch Ökosystemen Wunder wirken. So vergräbt der Mistkäfer in der Serengeti täglich die Ladung von 200 Güterzugwaggons Dung der dortigen Großtiere - millionenfach zu handlich kleinen Kügelchen gerollt - und düngt damit die Savanne. Und siehe da, das Grün sprießt und ernährt wiederum Abermillionen Großtiere.
Deshalb macht es häufig mehr Sinn ganze Lebensräume zu schützen als nur einzelne Arten. Dazu geht man mittlerweile immer mehr über. Man sucht kleine, einigermaßen nette Tierchen als Flaggschiffe aus wie etwa die Libelle und macht sie zum „Panda des Süßwassers“.
Aber selbst hässliche Arten haben in dem Moment eine Chance zu Leitarten gekrönt und wirksam zu werden, sobald man eine coole Story über sie erzählen kann. Bei Fledermäusen hat diese Strategie funktioniert. Wenn diese Arten dann noch ähnliche Bedürfnisse wie viele andere Arten in dem Ökosystem anmelden, entsteht durch diese clevere Rollenbesetzung eine Win-Win-Situation. Sie können zu Schirmarten werden, die passiv für ihren gesamten Lebensraum werben. Für die Flora wird es jedoch eine Ecke schwieriger. Eine Pflanze als Leitart für bestimmte Ökosysteme zu positionieren, funktioniert nur selten. Mit Flora kann man innerhalb der Homo Sapiens-Gemeinschaft allerhöchstens mit einer Orchidee einen Blumentopf gewinnen. Sie besitzt eben kein Stupsnäschen und keine Kulleraugen, auf die wir so stehen. Flora ist evolutionär viel zu weit weg, als dass ihre Ähnlichkeit Empathie bei vielen von uns wecken könnte.
Selbst wenn die Hoffnung zuletzt stirbt, so ist es dennoch sehr, sehr ernst für die Biodiversität. Und obwohl sie sich überall herumtreibt, an Land, im Wasser und in der Luft: An allen Fronten kämpft sie ums Überleben. Nirgendwo lebt es sich bald mehr wirklich entspannt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass weltweit pro Tag um die 100 Arten aussterben. Laut IUCN (International Union of Conversation of Nature), der Weltnaturschutzorganisation, liegt damit die derzeitige Aussterberate um den Faktor 100 (schöngerechnet) bis 10.000 (eher wahrscheinlich) über dem natürlichen Aussterbeprozess der Evolution, dem natürlichen Hintergrundsterben mit zwei bis drei Arten pro Jahr. Falls das so weitergeht, werden wir Meteorit spielen und damit das erdhistorische 6. Artensterben in 240 bis 540 Jahren vollbracht haben. So schreibt man Geschichte - Erdgeschichte. Übrigens käme selbst irgendwann mal eine Art namens Homo Sapiens an die Reihe. Biodiversität ist schließlich die Grundlage seines Lebens und schon wenige Stunden ohne feste Nahrung lassen ihn grantig werden.
Natürlich gab es bereits mehrere Massenaussterben, insgesamt fünf innerhalb der letzten 540 Millionen Jahre – unter Wissenschaftlern auch schon mal „Big Five“ genannt. Eigentlich versteht man unter den Big Five, diejenigen Tiere - Löwe, Büffel, Elefant, Nashorn und Leopard -, die man früher unbedingt für das eigene Ego erlegt haben musste und heute bei einer Safari gesehen haben sollte. Massenaussterben bedeutet, wenn 75 Prozent aller Arten in einer geologisch relativ kurzen Zeit flöten gehen. Relativ kurz heißt hier so an die 100.000 Jahre, weil die Erde ein anderes Zeitempfinden besitzt als wir. Statt Massenaussterben kann man auch Faunenumschwünge dazu sagen. Das hört sich fast ein bisschen nett und irgendwie nach Fabelwesen an, aber jedes dieser Ereignisse kommt mit Verlustraten im hohen zweistelligen Prozentbereich auf der Artenliste daher. Am Ende des Perms, ungefähr vor 260 Millionen Jahren - da gab es noch den Superkontinent Pangäa - kam es zum dritten und gleichzeitig heftigsten Massenaussterben in der Erdgeschichte, dem sogenannten Perm-Trias-Ereignis. 95 Prozent aller meeresbewohnenden Arten, 66 Prozent aller an Land lebenden Arten und sogar 30 Prozent aller Insektenarten kostete es damals das Leben. Damals ereignete sich auch das bis heute einzige Massenaussterben von Insekten in der Erdgeschichte. Die Gründe für dieses gigantische Artensterben sind bis heute unklar. Aber Vulkanismus, Meteoriteneinschläge oder ein kosmischer Gammablitz gelten als wahrscheinlich. Das fünfte und bekannteste Artensterben vor 65 Millionen Jahre ist mittlerweile in den Kinderzimmern eingezogen. Jedes Kind kennt es - die Dinosaurier fielen ihm zum Opfer.
Heute sind laut IUCN 13 Prozent der Vögel, 25 Prozent der Säugetier- und Reptilienarten und sogar 40 Prozent der Amphibien vom Aussterben bedroht. Das kennt fast keiner. Und diese Angaben korrigieren sich ständig – nach oben. Dabei sprechen diese Zahlen nur über die Menge der Arten und nicht über die Menge von Individuen innerhalb einer Art. Da sieht es nämlich ebenfalls dramatisch aus: Innerhalb von 14.000 Tierpopulationen sind die Bestände über 60 Prozent geschrumpft, bei Tieren in Flüssen und Seen über 80 Prozent und eben besagte 70 Prozent bei den „Krefelder Insekten“. Also nicht nur Klasse stirbt, sondern auch Masse. Außer beim Homo Sapiens. Lag dessen Population um 1900 deutlich unter zwei Milliarden, so hat sie sich in etwas mehr als 100 Jahren fast vervierfacht. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt?
Über den Zeitpunkt des Beginns des derzeitigen und sechsten Massensterbens wird ebenfalls noch debattiert. Möglicherweise startete es schon latent vor 12.000 Jahren mit dem sesshaft Werden des Menschen und dessen damit verbundener Überpopulation. Ackerbau und Viehzucht begannen das Spektrum der Arten leicht zu verschieben. Wenige Nutzpflanzen bekamen damals den Vorzug. Viele andere heimischen Pflanzen und Kräuter erhielten im Gegenzug einen neuen gemeinsamen Familiennamen: Unkraut. Und genauso erging es der Tierwelt: Schaf gut – Wolf böse.
Richtig Fahrt nahm das Artensterben aber erst mit dem Beginn der Industrialisierung auf. Da halfen plötzlich gigantische Energiemengen aus Kohle, Erdöl, Erdgas die letzten oberen Meter der Erdkruste umzubuddeln - mit bloßer Menschenkraft vorher unmöglich. Seit 250 Jahren geht es mittlerweile so richtig zur Sache und seit Ende des 19. Jahrhunderts um die Wurst. Da wuchsen die Verluste bei Wirbeltieren immens und seit Mitte des letzten Jahrhunderts erleben wir so richtig Kahlschlag. Die moderne Landwirtschaft als sogenannte grüne Revolution mit gewaltiger Fleischproduktion für immer mehr Erdenbürger krempelt natürliche Lebensräume und Ressourcen gründlich um. Was früher Großwildjäger erledigten, übernimmt heute Kevin-Normalverbraucher. Früher mit Speer und Gewehr – heute mit Konsum: egal, ob Lebensmittel, Genussmittel, Erlebnisse oder haufenweise Krempel daheim. Bei diesem Massenaussterben sind keine interstellaren Kräfte aus dem All mit Impactfolgen à la Yucatan am Werk, sondern nur ein vergleichsweise winziges Lebewesen mit etwas zu groß geratenem Kopf, dafür aber zu klein geratenem Respekt. Dieses Lebewesen hat sich zur Aufgabe gestellt, alle natürlichen Hindernisse zu beseitigen und natürliche Ressourcen in technische und künstliche Äquivalente umzutauschen. Dabei verarbeitet er die unermessliche Vielfalt der Naturschätze in gleichförmige und stets verfügbare Industrieprodukte. Deshalb kann man heute das neueste Sneakermodell auch gleichzeitig in New York, Neu-Delhi und Neuendettelsau kaufen – zu Homo Neanderthalensis-Zeiten völlig undenkbar.
Wagen wir uns in eine weitere Dimension - in die der Zeit. Betrachtet man die Zeitspanne der aktuellen Ereignisse sowohl beim Artensterben als auch beim Klimawandel, ergibt sich eine interessante Parallele. Klimaänderungen wie Artensterben gab es schon immer auf der Erde. Nur haben beide im aktuellen Geschehen massiv an Tempo zugelegt. Und hier sind wir an einem entscheidenden Punkt angelangt: Dass sich ein Klima ändert, dass mal Arten aussterben, sind völlig normale und natürliche Vorgänge. Der echte Hund ist in deren Beschleunigung begraben. Da kommt eine Evolution nicht mehr mit, um Vielfalt wieder nachzuliefern. Evolution braucht nämlich eine Ressource am dringendsten: Zeit. Also her mit der Entschleunigung!
Nature first! Das Vorrangmodell der Nachhaltigkeit
Die gängigen Modelle zur Nachhaltigkeit weisen die drei Elemente Ökologie, Soziales und Ökonomie oft isoliert auf. So stehen beim Säulenmodell einfach alle drei Bereiche schön brav nebeneinander, so als hätten sie nichts miteinander zu schaffen. Beim Dreiecksmodell, in dessen Ecke sich jeweils eine der genannten Fraktionen aufhält, gibt es zwar in der Mitte erste Überschneidungen, aber dennoch viel Isolation. In der alltäglichen Realität aber spielt Naturschutz und Ökologie in diesem Dreiklang, oftmals die letzte, schräg klingende Tuba in der hintersten Ecke des Orchesters. Ganz im Gegensatz zur Knete. Ganz banal zu sehen an so mancher Kaufentscheidung: Statt zur Biomilch zu greifen, kauft man dann doch lieber die vom konventionellen Billigheimer, um ein paar Cent zu sparen. In der Anonymität der Supermarktkasse fällt das schließlich keinem auf. Anders ist es nicht zu erklären, warum viel mehr Bürger Nachhaltigkeit gut finden, als dass sie sie kaufen. Natur wird oft nur genutzt, benutzt, ausgenutzt, totgenutzt – bis zur totalen Vernichtung. Bei der Ökonomie und selbst im sozialen Bereich passen wir da viel besser auf.
Nach der Logik des von Felix Müller visualisierten Vorrangmodells der Nachhaltigkeit sollte dies jedoch genau andersherum laufen: Ökologie spielt hier die erste Geige. Sie ist das Reservoir, aus dem sich alles - sowohl eine Gesellschaft als auch eine Wirtschaft - speist. Um im Tortenbild zu bleiben, stellen wir uns einfach mal eine dreistöckige Hochzeitstorte vor: Die unterste Etage und damit das Fundament der weiteren Stockwerke bildet die Natur. Die darauffolgende entspricht der Gesellschaft und die dritte Etage der Wirtschaft. Die oberen beiden bedienen sich an der Natur ohne Gegenleistungen. Aber ohne funktionierendes Fundament der Ökosysteme stürzen sowohl Gesellschaft als auch Wirtschaft irgendwann ab. Ehemalige Hochkulturen haben das am eigenen Leib schmerzhaft erfahren. Wie die bereits erwähnten Mayas.
Zusätzlich bedient sich eine Wirtschaft an der Gesellschaft. An ihren Grundwerten, an ihrer Bildung. Bildung wird oftmals bezahlt, Grundwerte eher selten. Oder sind Sie schon mal in einem Gespräch zur Gehaltserhöhung gefragt worden, wie oft Sie im letzten Jahr gelogen oder betrogen haben? Ganz im Gegenteil, moralische Grundfeste werden in wirtschaftlichem Zusammenhang oft in Frage gestellt und damit erodiert. Obwohl ein „Du sollst nicht lügen“ gesellschaftlich verbrieft ist, lügen viele für ihr Unternehmen in großem Stil. Verankerte Moralvorstellungen werden beim Betreten des Büros an den Kleiderständer gehängt. Denn wer würde schwerste Kinderarbeit auf Kakaoplantagen persönlich schon gut finden? Der Broker an der Kakaobörse, der im Auftrag seines Schoko-Unternehmens handelt, tut dies in seiner Rolle durchaus. Er wettet auf den größten Vorteil seines Arbeitgebers und damit auf den billigsten Preis. Der ist oft nur mit der billigen Arbeitskraft der Kinder, die 60 Kilogramm schwere Säcke schleppen müssen, und mit einer Übernutzung der Ökosysteme zu erzielen. Ökonomie sticht Soziales sticht Ökologie. Immer noch.
Neue Begriffe braucht das Land – auch der Naturschutz
Naturschutz ist immens wichtig und liefert das Konkrete. Das, was wir hinterher sehen und anfassen können. Das ist auch gut so, denn dadurch wird er begreifbar und wirksam. Trotzdem steckt Naturschutz in einem weiteren Dilemma. Weil die Zusammenhänge der Natur so dicht gewebt sind, passiert es durchaus, dass man mit einer Maßnahme zwar eine Art fördert, jedoch eine andere Art genau dadurch aber schädigen könnte. Deshalb ist Naturschutzarbeit immer multidisziplinäre Weitwinkelarbeit, die ganz viel systemisches Verständnis und Abwägung abverlangt. Und deshalb weiß keiner so richtig welches das gemeinsame Ziel ist, außer eben Natur im Allgemeinen zu schützen oder wiederherzustellen. Aber von welcher Natur spricht man beispielsweise bei einer Renaturierung? Von der vor fünfzig, vor fünfhundert Jahren oder doch besser von der zum Status ante vor fünftausend Jahren? Was bringt mehr für die Biodiversität? Was ist mehr wert, was wichtiger?
Oder mal schwarzweiß gemalt: Rodet man für Vögel wertvolle Hecken, um einem wertvollen Magerrasen mit vielen Blüten, Insekten und Hummeln den Vorrang zu geben? Oder entfernt man nun besser oder besser nicht das indische Springkraut, das als invasive Art in Europa gilt und heimischer Flora Platz wegnimmt, gleichzeitig aber eine gute, von Imkern eingeführte Bienenpflanze ist? Schwer zu entscheiden und mitunter schwer zu vermitteln.
Noch hinderlicher aber für die Akzeptanz des Naturschutzes auf breiter Basis ist sein Image und nicht nur selbstgestrickte Schafwollsocken machen ihm da zu schaffen. Ödland, Badland, Brache, Rohboden, Magerrasen, Totholz. So heißen immens lebenswichtige Elemente von Ökosystemen. Deren Namen sind aber damals aus der Sicht einer unmittelbaren „Unnützlichkeit“ für uns Menschen vergeben worden. Denn wer bezahlt schon für öde, mager oder tot sein? Was kann daran schon wertvoll sein? Hier sieht man direkt: Naturschutz hat ein echtes PR-Problem. In Zeiten wo Kommunikation zu den Dreh- und Angelpunkten der Gesellschaft wird, wo überall nur noch Wörter wie smart, mega, geil und eine künstliche Intelligenz in einer immer jugendlicheren und perfekt retuschierten Bilderwelt überstrapaziert werden, verharrt Naturschutz-PR in negativen, in sterbenden Begriffen. Begriffe wecken schließlich Bilder, Emotionen. Schokolade mit zartem Schmelz klingt schließlich auch leckerer als klebriger Batz.
Zum Beispiel Ödland: natürliches Ödland ist für Biodiversität enorm wichtig. Endlich mal ein Fleck ohne Bebauung und Kultivierung, pure, karge Natur. Hier herrscht Ruhe vor dem Menschen, hierhin können sich Arten zurückziehen, die sich eben genau auf diese Kargheit eingestimmt haben. Zugegeben: Ödlandboden signalisierte den Augen unserer Ahnen lediglich eins, und das war Hunger. Sein Bewuchs ist weder saftig und einladend grün, also angenehm für unser Auge, sondern eben karg, trocken, dornig. Aber diese Assoziation ist für den Gesamtzusammenhang weder clever noch richtig. Hier könnte eine Namensgebung den Perspektivenwechsel wagen und aus ökologisch wertvollem Ödland schlichtweg mal Rückzugsland, Refugium oder stilles Kämmerlein machen. Schon sind wir im Positiven. Und selbst von sogenanntem „Badland“, das noch zerklüfteter, karger und unzugänglicher ist als Ödland und das rein materiell zu gar nichts mehr nütze ist, gibt es atemberaubend schöne Bilder, nach denen sich jede strapazierte Menschenseele sehnt.
Brachen werden oft in die gleiche Schublade gesteckt wie Ödland, sind aber tatsächlich ein klein wenig anders. Als Brachen werden solche Flächen bezeichnet, die sich ins Sabbatical gewagt haben. Einfach mal nicht bewirtschaftet werden, sich ausruhen und Kraft schöpfen, um dann in vollem Saft und guter Laune wieder produktiv zu werden. Warum also nicht Sabbatland?
Rohboden klingt nach Rohkost, schwer im Magen liegend, unverdaulich. Rohböden entstehen durch Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Erdrutsche und auch schon mal auf Müllkippen. Pionierboden wäre dafür eine echte Alternative. Hier können die nicht so fest gefahrenen Typen allerhand ausprobieren und die Flächen zum Silicon Valley der Natur machen. Es sammelt sich ein kleiner Haufen mutiger Arten, der sich auf neues Terrain wagt. Ja geradezu diese Herausforderung braucht, das Land, den Rohboden neu besiedelt und für andere, eher ängstlichere Arten den Weg ebnet.
Als weitere Stufe nach dem Ödland wäre der Magerrasen mit einem Image verhungernder Pariser Magermodells zu nennen. Warum nicht besser ein „Spezialistenrasen“, der von eben diesen bestens an magere Bedingungen angepassten Arten besiedelt ist? Die Magerwiese könnte „Buntwiese“ heißen, da auf einer Magerwiese besonders viele Arten leben und auch zum Blühen kommen. Und für den mageren Boden als Grundbedingung für üppige Artenvielfalt - nicht für üppige Landwirtschaft – da wäre doch „schlanker Boden“ ganz hübsch.
Ein weiterer Begriff eines äußert wichtigen Bausteines des Naturschutzes hört sich noch weniger charmant an: Totholz. Verständlich, wer möchte schon seinen Wald voll mit totem Holz liegen haben? Das ist kein Kompliment. Besser machen wir da mal aus diesem lebenswichtigen und unbezahlbaren Lebensraum „Second-Life-Holz“ daraus. Das trägt den Aufdruck „Prädikat: Besonders wertvoll“. Aus Sicht des Baumes ist zu sterben zwar nicht schön. Aber nur weil er tot ist, wimmelt es in ihm so von Leben. In diesem Zusammenhang macht Sterben auch mal Sinn. Viele Arten, von Insekten bis Pilze, brauchen für ihre Entwicklung zwingend Second-Life-Holz. Hier den Perspektivenwechsel wagen, hin zu den Insekten und anderen Lebewesen, für die das Holz Kinderstube, Kindergarten, Nährstoffquelle, Delikatesse, Schlaraffenland - also schlichtweg das gelobte Land ist. Natur funktioniert nur im Kreis. Es existiert kein Abfall, der einfach nur ungenutzt rumliegt, sondern der Abfall des einen ist die Lebensquelle, die Nahrung, der Lebensraum für den anderen – jedes Lebewesen hat seinen Platz und jedes Material auch. Mensch, schau dir das mal ab!