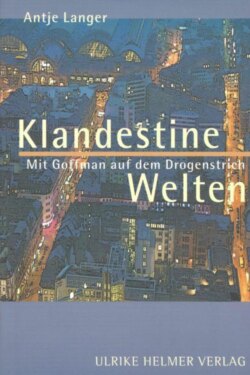Читать книгу Klandestine Welten. Mit Goffman auf dem Drogenstrich. - Antje Langer - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinleitung
Spezifika der Drogenprostitution
Prostitution betrachte ich als sexuelle Dienstleistung gegen Geld oder andere materielle Güter, die als soziale Institution3 gesellschaftlich und historisch fest verankert ist. Innerhalb dieser gibt es verschiedene Formen und Branchen, die sich historisch verändern und die damit verbunden auch unterschiedliche gesellschaftliche Bewertungen erfahren. Diese wirken sich teilweise auf die Nachfrage, zumindest aber auf die Handlungsbedingungen der Prostituierten aus, denn Prostitution kann nicht unabhängig vom gesellschaftlichen Normen- und Wertesystemen bezüglich der Regelungen von Geschlechterbeziehungen und vorherrschender Sexualmoral betrachtet werden. Obwohl sie in jeder Gesellschaft gefragt ist und man deshalb annehmen kann, dass sie ein soziales Bedürfnis erfüllt, wird sie tabuisiert und stigmatisiert. Ihr haftet etwas Anrüchiges und Verwerfliches an. Sexuelle Käuflichkeit und professionelle Promiskuität werden als unmoralisch und unzüchtig verurteilt und als sozial abweichendes Verhalten eingeordnet. Gleichzeitig zeigt sich gesellschaftliche Zustimmung in stillschweigender Duldung.
Der öffentliche Umgang scheint auf den ersten Blick unkomplizierter geworden zu sein, an der prinzipiellen Tabuisierung hat sich jedoch nicht viel geändert. Dabei werden unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe von Prostitution als einer sozialen Institution auf der einen Seite und der Prostituierten als Person auf der anderen Seite angelegt (vgl. Uta Holter u.a. 1994, 13). Die öffentliche moralische Verurteilung gilt dabei den sich prostituierenden Frauen und Männern. Mit dem Stempel, Prostituierte zu sein, wird suggeriert, dass sexuelle Dienstleistungen anzubieten ein die Gesamtpersönlichkeit definierendes Merkmal und nicht Tätigkeitsbeschreibung ist (vgl. HWG 1994, 155). Von der zwangsläufig dazugehörigen „anderen Seite“ wird selten oder gar nicht gesprochen. Zu einer oder einem Prostituierten zu gehen, wird als ein privates und damit intimes Problem angesehen, was besser nicht thematisiert wird.
Rechtlich gesehen ist es zwar nicht verboten, sich zu prostituieren, es galt aber bis vor kurzem und im Forschungszeitraum als „sittenwidrige Tätigkeit“ und konnte somit sanktioniert werden (vgl. Beate Leopold/Elfriede Steffan, 1996, 124; HWG 1994, 86). In dieser Grauzone zwischen Legalität und Illegalität entstand für die Prostituierten ein Status als Randgruppe. Dieser wird eine Milieuzugehörigkeit und eine direkte oder mindestens indirekte Verbindung zur Kriminalität unterstellt. Gleichzeitig wird durch Reglementierungen und Verbote, wie z.B. Sperrgebietsverordnungen, die Tätigkeit der Prostitution kriminalisiert (vgl. HWG 1994, 70-81).
Die dargestellten Punkte gelten ebenso für den Bereich der Drogenprostitution. Was macht nun ihre Besonderheit aus? Die meisten Autorinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen (bspw. Gersch et al. (1988), Dagmar Hedrich (1989), Leopold/Steffan (1996) und Heike Zurhold (1998)), betrachten Prostitution als die gängigste Art, mit der Frauen ihren kompulsiven Konsum illegaler Drogen (im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes BtMG), vorwiegend von Heroin, Kokain und Crack, finanzieren4. Der Handel mit Drogen als Finanzierungsquelle scheint dagegen eine Männerdomäne zu sein (vgl. Christine Spreyermann 1997, Heike Zurhold 1998, Bettina Paul 1998). Natürlich gibt es auch männliche Drogenprostituierte. Im Weiteren wird es jedoch ausschließlich um weibliche Prostituierte gehen, da die Situation der „(Drogen-)Stricher“ nur teilweise gleiche Strukturen, Merkmale und Hintergründe aufweist, was sich auch in einer räumlichen Trennung der beiden „Anschaffungsgebiete“ zeigt.
Hauptsächlicher Beweggrund vieler Drogenkonsumentinnen, sich zu prostituieren, ist also die Finanzierung der Drogen, während das durch die Prostitution erworbene Geld nur Zwischenziel ist. Wie unmittelbar die Prostitution mit dem Drogenerwerb zusammenhängt, zeigt sich darin, dass selten in drogenfreien Zeiten angeschafft wird und auch sonst nicht mehr, als für den Bedarf nötig ist. Die Prostitutionstätigkeit erfolgt ebenso im unmittelbaren Austausch gegen Drogen, ein Dach über dem Kopf oder eine warme Mahlzeit, um existenzielle Bedürfnisse befriedigen zu können. Das ist vor allem für die Frauen wichtig, die vorwiegend auf der Straße leben (vgl. Zurhold 1995, 76). So banal dieser Hinweis erscheinen mag, zeigt das doch, dass das Leben einer drogenabhängigen Frau nicht nur aus Drogen und ihrer Beschaffung besteht, auch wenn Drogen den primären Antrieb für diese Arbeit darstellen. Der weit verbreiteten (Klischee)vorstellung, Drogenprostituierte wären 24 Stunden am Tag mit Anschaffen und Konsumieren beschäftigt, ist also zu widersprechen.
Neben der direkten, öffentlichen Prostitution, die im Folgenden im Mittelpunkt stehen wird, gibt es häufig längere Beziehungen mit Dealern oder anderen männlichen Szeneangehörigen, die den Drogenbedarf zum Preis sexueller Verfügbarkeit abdecken (vgl. Hedrich 1989, Gersch et al. 1988). Diese Zweckbeziehungen werden von den Frauen auch zum Schutz vor Gewalt innerhalb der Drogenszene eingegangen.
Wesentliche Besonderheit von Drogenprostitution ist also der spezifische Beweggrund der anschaffenden Frauen. Meist wird in diesem Zusammenhang sowohl von den Prostituierten selbst als auch in der Literatur zwischen „Professionellen“ (Berufsprostituierten) und „Nicht-professionellen“ Prostituierten unterschieden (vgl. Leopold/Steffan 1996, Heinrich W. Ahlemeyer 1996, HWG 1994, Meier/Geiger 1993, Gersch et al. 1988). Mit dieser Unterscheidung ist eine angenommene oder auch abgesprochene Handlungskompetenz, also eine bestimmte Wertung, verbunden. Es werden zwei relativ homogene Gruppen vorgeführt, denen unterstellt wird, dass sie sich gegenseitig ausschließen. Damit wird ein komplexer Sachverhalt stark vereinfacht. Ich halte diese Unterscheidung nicht für sinnvoll, um das Spezifische der Prostitution mit dem Ziel Drogenfinanzierung zu beschreiben, selbst wenn sie durchaus eine konstitutive Wirkung auf die Vorstellungen und das Verhalten der Prostituierten und Freier haben kann.
Allerdings verweisen die verschiedenen Prostitutionsformen auf unterschiedliche Interaktionskontexte und Milieus mit einer eben mehr oder minder organisierten Einbindung darin. So findet Drogenprostitution nicht in einem wie auch immer gearteten Prostitutionsmilieu, sondern innerhalb einer spezifischen Drogensubkultur statt. Sicher überschneiden und durchdringen sich beide Bereiche, z.B. durch die räumliche Nähe der Drogenszene zu den Bordellen oder durch Prostitutionserfahrungen der Drogenkonsumentinnen in den Etablissements.
Bezüglich der Straßenprostitution, der laut Gersch et al. (vgl. 1988, 15) die meisten Drogenprostituierten nachgehen5, zeigt sich diese Abgrenzung auch in räumlich voneinander getrennten Arbeitsgebieten: Es gibt in Frankfurt (und in anderen Städten) zwei von einander unabhängige Straßenstriche. Das ist einmal der legale Straßenstrich in der Theodor-Heuss-Allee, wo vor allem die Frauen stehen, die sich als „professionelle“ Prostituierte bezeichnen bzw. als solche bezeichnet werden. Zum anderen ist das der im „Sperrgebiet“ gelegene „Drogenstrich“ im Bahnhofsviertel, wo überwiegend drogenkonsumierende Frauen arbeiten. Im Sperrgebiet heißt, dass die Frauen, die im Bahnhofsviertel auf der Straße anschaffen gehen, in jedem Fall illegal dort arbeiten und ordnungswidrig handeln, da sich die in der Verordnung ausgewiesene Toleranzzone auf die dort ansässigen Bordelle beschränkt (vgl. Information zur Sperrgebietsverordnung für Frankfurt am Main, 1987; HWG, 1994, 157).
Die Sperrgebietsverordnung ist für die Beschaffungsprostituierten nur schwer einhaltbar, da die legalen Möglichkeiten begrenzt und von „Profi“-Frauen und Zuhältern6 aufgeteilt sind (vgl. Leopold/Steffan 1996, 123). Unabhängig davon sind die auf dem Straßenstrich arbeitenden Drogenkonsumentinnen in der Regel nicht als Prostituierte7 gemeldet. Unter diesen Bedingungen müssen die Frauen ihrer Arbeit möglichst unauffällig nachgehen, um den Ordnungsbehörden zu entgehen. Das wirkt sich wiederum auf die Interaktionen mit den Kunden aus.
Daneben verstoßen die Drogenkonsumentinnen zwangsläufig immer wieder gegen das Betäubungsmittelgesetz, denn jeglicher Umgang mit illegalen Drogen (mit Ausnahme des Konsums) ist strafbar. Die oftmals vorausgesetzte Verbindung von Prostitution, Kriminalität und Illegalität wird so in der Beschaffungsprostitution besonders wirksam. Hurenstigma und Kriminalisierung bedingen sich gegenseitig.
Der Drogenstrich befindet sich also unmittelbar auf der offenen Drogenszene und unterliegt damit eigenen Rahmenbedingungen und Gesetzmäßigkeiten. Die Szene stellt für die meisten anschaffenden Frauen den primären Lebensraum dar und ist eng mit ihrer Arbeit verbunden. Handel (Deckung des Bedarfs) und Beschaffung der nötigen finanziellen Mittel liegen eng beieinander. So kommen auch die Freier mehr oder weniger mit den Szenestrukturen und -bewegungen in Berührung. Das hat bestimmte Umgangsweisen mit der Situation und spezifische lokale Praktiken aller in irgendeiner Hinsicht Beteiligten zur Folge. Dies wird Ausgangspunkt meiner Betrachtungen sein.
Was geschieht hinter den Kulissen?
Aus der allgemeinen Einführung ergeben sich verschiedene Ansätze, sich dem Thema zu nähern sowie Fragen, die noch unbeantwortet sind. Wie gehen die Frauen, die sich prostituieren, und deren Kunden mit der beschriebenen Situation um? Wie verhalten sie sich unter den Bedingungen von Stigmatisierung, Marginalisierung und Illegalität? Welches Wissen und welche Kompetenzen benötigen sie dafür? Welche Bedeutung haben Prostitution und die gesellschaftlichen Diskurse darüber für die Selbstattributionen der Frauen? Mehr als die geschilderten Rahmenbedingungen, innerhalb derer Drogenprostituierte leben und arbeiten, und als die Vorstellungen anderer Autorinnen und Autoren über diese Frauen zu erfahren, erfordert Fragen dieser Art und einen differenzierten Zugang: Man muss sich ins Feld, in die Drogenszene im Bahnhofsviertel begeben und sich die spezifischen lokalen Praktiken auf dem dortigen Straßenstrich ansehen.
Im Laufe meiner Feldbeobachtungen auf dem Frankfurter „Drogenstrich“ interessierte ich mich besonders für die Interaktionen zwischen Prostituierten und Freiern. Mittels der Analyse dieser Interaktionsprozesse etwas Spezifisches über das Thema Drogenprostitution zu erfahren, ist in mehrerer Hinsicht sinnvoll. Eine solche Herangehensweise nimmt das Handeln von Prostituierten und Freiern in den Blick. Sie setzt ihren Fokus auf einen elementaren Aspekt der Prostitution: die soziale Interaktion der beteiligten Akteure. So kritisiert Ahlemeyer in seiner Studie zur „Prostitutiven Intimkommunikation“, (in der das Thema Drogenprostitution an sich allerdings auch nur sehr geringen Raum einnimmt), an der bisherigen Prostitutionsforschung, dass die beteiligten Akteure überwiegend losgelöst voneinander betrachtet werden:
„Als hätten beide nichts miteinander zu tun, als handelten hier losgelöste Einzelindividuen völlig unabhängig voneinander, verläuft zwischen beiden wie auf einem geteilten Bildschirm ein dicker Balken, der die Einheit und Dynamik der interaktiven Beziehung zwischen Prostituierter und Prostitutionskunden verdeckt. Muster der Kommunikation und der Interaktion zwischen beiden Beteiligten sind in der Forschung bisher weitgehend ausgespart“ (Ahlemeyer 1996, 23).
So kann nur ein sehr grobes, holzschnittartiges Bild gewonnen werden.
Der Blick auf die Interaktionsprozesse in einem bestimmten exklusiven Raum ermöglicht detaillierte und breit gefächerte Ergebnisse zugleich. Beobachtbare Interaktionen sind nicht immer sofort durchschaubar und nötigen, konkrete Fragen zu stellen – vor allem aber genau hinzusehen. Mit der Zeit zeigen sich in den Interaktionen Selbstverständlichkeiten, Regelmäßigkeiten und Muster, die speziell an diesem Ort gelten. Diese Praktiken zu beschreiben, die lokale Ordnung zu rekonstruieren und die (Selbst-)Verständnisse der Akteure ein wenig aufzudecken, ist mein Ziel. Welche Abläufe gibt es? Wer sind die Beteiligten? Gibt es bestimmte Rituale? Welche Rolle spielt dabei die Tabuisierung von Sexualität und Prostitution? Welche (nicht ausgesprochenen) „Arbeitsbündnisse“ im Sinne eines gemeinsamen Vorverständnisses von bzw. einer gemeinsamen Verständigung über die jeweiligen Rollen werden dadurch initiiert bzw. bestätigt? Der Blick auf das Detail schärft auch den Blick für andere, vielleicht verborgenere Themen, z.B. einen verbreiteten Voyeurismus von Männern auf dem Drogenstrich. Die Einbettung der Details in ihren Kontext verweist außerdem auf weitere, vielleicht noch unbeachtete Zusammenhänge, wenn z.B. bestimmte Freier mehr an der Vermittlung von Drogen als am sexuellen Akt interessiert sind. Ich werde also nicht nur Fragen beantworten, sondern auch neue aufwerfen.
Um diesen Interessen zu folgen, muss man ebenso wie die Akteurinnen und Akteure im Feld einiges von seinem Gegenüber, vom Feld, in dem man sich bewegt, wissen. Um das Wissen und die Erfahrungen, welche selten bewusst sind, sondern als „Selbstverständlichkeiten“ bestehen, wird es gehen. Mit diesen Selbstverständlichkeiten wird man konfrontiert, wenn man das Feld betritt. Wenn man z.B. nicht weiß, wie man sich zu verhalten hat und auf unverständliche oder verständnislose Reaktionen anderer stößt.
Indem man die Abläufe und Praktiken auf dem Drogenstrich sowie die Selbstverständnisse der Akteure offen legt, erfährt man auch etwas über die Kompetenzen der Prostituierten. Diese sind für eine gelungene Interaktion und ein ebensolches Geschäft notwendig. Welche Kompetenzen brauchen und entwickeln die Frauen im Umgang mit den Freiern oder der Polizei? Welche Strategien haben sie, mit der Situation, in der sie anschaffen, umzugehen? Wie kommen sie zu ihren Fähigkeiten und dem nötigen Wissen? Dies herauszuarbeiten ist ein weiteres Ziel der Studie. Dazu nutze ich die Gespräche mit den Frauen, in denen sie ihre Prinzipien bei der Arbeit darstellen. Diese Prinzipien sind Grundlage der Interaktionen mit den Freiern, auch wenn sie nicht immer eingehalten werden (können).
Die dargestellten Forschungsfragen markieren verschiedene Ebenen, die allerdings miteinander in Beziehung stehen. Über die beobachtbaren Interaktionsprozesse lassen sich Abläufe und Strukturen des Alltagshandelns rekonstruieren, die gleichzeitig etwas über die Selbstverständnisse und Kompetenzen der Beteiligten verraten und letztlich immer wieder auf den Kontext und die Bedingungen, innerhalb derer sie stattfinden, verweisen.
Zum Aufbau des Buches:
Forschung in einem tabuisierten und kriminalisierten Milieu erfordert eigene Zugangsformen, erst recht dann, wenn dieses Feld von einer Frau erforscht wird. Die Beschreibung meiner Vorgehensweise soll den Forschungsprozess transparent machen und die spezifischen Probleme aufzeigen, entwickeln sich doch daraus die folgenden Ergebnisse. Das Kapitel Annäherung an das Geheime soll aber nicht nur mein Herantasten an den Forschungsgegenstand verdeutlichen, sondern gleichzeitig der Leserin und dem Leser eine Annäherung an den Prostitutions-Kontext „Drogenszene“ und den diese „beherbergenden“ sozialen Raum ermöglichen. Zum Einstieg beginne ich deshalb mit einer virtuellen Führung durch den für diese Untersuchung wichtigen Teil des Frankfurter Bahnhofsviertels.
Im Kapitel Die Akteurinnen und Akteure auf der Drogenszene stelle ich den räumlichen, personellen und institutionellen Kontext, in dem sich das Geschehen abspielt, genauer vor. Der Ereignisraum „Offene Drogenszene“ beeinflusst mit den darin agierenden Personen und Institutionen sowie seiner Dynamik die Handlungen und Interaktionsprozesse auf dem Drogenstrich. Ich beschreibe die Beteiligten und das Verhältnis der Drogenprostituierten untereinander bzw. lasse die interviewten Frauen selbst zu Wort kommen. Zu den Akteuren gehören auch die Kunden der Prostituierten, von ihnen wird ebenfalls die Rede sein. Zur Einstimmung auf den Hauptteil der Studie gebe ich einen ersten Einblick in das Geschehen auf dem Drogenstrich.
Unter der Fragestellung Was geht hier eigentlich vor? widme ich mich im Hauptteil den Interaktionsprozessen zwischen Prostituierten und Freiern sowie deren Einflussfaktoren. Um die Offenheit des Themas nicht völliger Beliebigkeit stattzugeben, bette ich die empirischen Ergebnisse in soziologische Interaktionstheorien – in erster Linie der Modelle von Erving Goffman – ein bzw. verknüpfe sie zur Verdeutlichung und Abstrahierung mit interaktionstheoretischen Elementen. Den Ablauf des Geschehens habe ich in sechs Phasen unterteilt, die ich im Einzelnen mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten und Fragestellungen bearbeite. Die Theorien über zwischenmenschliche Interaktionen erhalten dabei unterschiedliche Gewichtung. Zwei weitere Kapitel über Besonderheiten bzw. besonders hervorzuhebende Punkte innerhalb der Drogenprostitution lassen sich nicht ohne weiteres in das Phasenmodell integrieren: Viele Frauen auf dem Drogenstrich haben Erfahrungen mit gewalttätigen Freiern. Wesentlich ist daher das Sicherheitsmanagement der Prostituierten, um solche Risiken so gering wie möglich zu halten. Dazu gehört u.a. sich einen verlässlichen Kundenstamm zu schaffen. Um die Beziehungen zu Stammfreiern geht es am Ende des Hauptteils.
Im Kapitel Mosaikstücke fasse ich die Ergebnisse noch einmal zusammen und weise auf Veränderungen sowie immer wiederkehrende, spezifische Themen innerhalb der geschilderten Inhalte hin. Ich komme auf nach wie vor offene Fragen oder solche, die sich im Laufe der Untersuchung ergeben haben, zurück und gebe einen Ausblick auf Forschungsprojekte, die an diese Studie anknüpfen könnten.
3 Verstanden im Sinne eines gesellschaftlich fest installierten sozialen Systems mit spezifischen Ordnungsstrukturen zur Regelung von Aktivitäten.
4 Die Schätzungen, wie viele Frauen sich auf diese Weise ihren „Stoff“ finanzieren, fallen allerdings sehr unterschiedlich aus. Die Angaben bewegen sich zwischen 30 und 80 Prozent der Frauen, die sich auch auf der offenen Drogenszene aufhalten. Beispielsweise schreibt Hedrich (1989) in einem Zwischenbericht der Längsschnittstudie „Amsel“, bei der von 1985 – 1990 324 männliche und weibliche Drogenabhängige befragt wurden, von 46% der weiblichen Teilnehmerinnen, die vorwiegend diese Form der Finanzierung wählten. Dieter Kleiber/Doris Velten (1994) beziehen sich auf eine Schätzung von Intersofia (1991), bei der von etwa 5000 – 8000 weiblichen Drogenprostituierten in der BRD ausgegangen wird. Das sind 40% der Frauen, die als drogenabhängig gelten. Beschaffungsprostitution soll 8% der Prostitution allgemein ausmachen. In der schon erwähnten Studie des Sozialpädagogischen Instituts Berlin von Gersch et al. (1988) wird von bis zu 80% der drogenkonsumierenden Frauen, die zumindest zeitweise auf dem Drogenstrich anschaffen gehen, ausgegangen.
5 Ich kann mir vorstellen, dass die Zahl der Frauen, die ihren Drogenkonsum sozusagen „ungesehen“ in anderen Bereichen der Prostitution finanzieren, weit höher ist als bisher angenommen. Sie sind schlichtweg nicht so offensichtlich wie die auf dem Drogenstrich in aller Öffentlichkeit (genauso wie Konsumentinnen illegaler Drogen, die sich nicht auf der Szene bewegen). Teilweise zeigt sich das im Kapitel über die Beziehungen zu Stammfreiern (), wenn die Frauen erwähnt werden, die andere Praktiken finden, mit den Kunden Kontakt aufzunehmen, als sich an die Straße zu stellen. Für möglich halten auch Gersch et al., dass „in entsprechenden Etablissements … mehr drogenabhängige Frauen anzutreffen (sind A.L.) als bisher vermutet“ (1988, 15).
6 Für Zuhälter scheint der Drogenstrich relativ uninteressant zu sein, da die Beschaffungsprostituierten einen zu hohen Finanzierungsbedarf haben und ihnen Unzuverlässigkeit unterstellt wird (vgl. Leopold/Steffan 1996, 121). Eine zuhälterähnliche Rolle sollen aber häufig drogenkonsumierende Partner spielen (vgl. Hedrich 1989, 98).
7 Prostituierte gelten steuerrechtlich als selbständige Erwerbstätige.