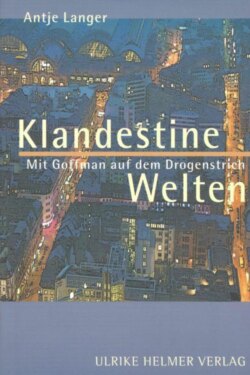Читать книгу Klandestine Welten. Mit Goffman auf dem Drogenstrich. - Antje Langer - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAnnäherung an das Geheime
Der Drogenstrich ist eine kleine, wenig erforschte Szenerie, der etwas Randständiges, Abweichendes und Kriminelles anhaftet, die es aber in allen größeren Städten gibt. Ein Feld, das durch eine gewisse Verruchtheit etwas Geheimes an sich hat und „offiziell“ nicht ohne weiteres zugänglich ist. Und vor allem ein in mehrfacher Hinsicht tabuisiertes Feld: bezüglich Drogenabhängigkeit, öffentlich inszenierter Sexualität und Prostitution - drei verschiedene „klandestine Welten“, die sich hier vermischen. Viele Menschen kommen in ihrem Leben mit keiner einzigen solchen Subkultur in Kontakt, geschweige denn mit allen drei Dimensionen auf einmal. Das Besondere liegt dabei nicht in einer „Exotik an sich“, sondern wird bestimmt durch Stigmatisierung, Marginalisierung und Illegalität. Daraus ergeben sich dem Untersuchungsfeld eigene Zugangsschwierigkeiten und Hindernisse, die teilweise erst im Laufe der Zeit bei der schrittweisen „Annäherung an das Geheime” (Stephan Palmié 1988) sichtbar wurden. Im Folgenden lade ich dazu ein, mit mir die ersten vorsichtigen Schritte in das Frankfurter Drogen- und Prostitutionsmilieu zu starten, um erste Eindrücke von der Szenerie zu sammeln.8
Kleiner Rundgang durch das Frankfurter Bahnhofsviertel
Bahnhofsgegenden, vor allem in größeren Städten, gelten häufig als verruchte Orte, an denen sich Leute aufhalten, die nicht ohne weiteres mit einem sauberen, gepflegten Stadtbild in Einklang zu bringen sind. Vielleicht sollte man sich ganz und gar vor ihnen in Acht nehmen? Neugierig, aber auch etwas unsicher machen wir uns auf den Weg. Ausgangspunkt der Erkundung soll der Hauptbahnhof sein, auf dessen Vorplatz sich im Vergleich zu anderen Städten relativ wenig Menschen aufhalten. Wie Reisende in einer bisher unbekannten Stadt müssen wir uns zunächst einmal orientieren. Alles ist in Bewegung. Erst einmal drauf loslaufen – die große Straße Richtung Stadt: die Kaiserstraße. Die vielen Leute, die uns auf dem Weg entgegenkommen, nehmen wir nur schemenhaft war. Es ist ein „buntes“ Gemisch. Viele scheinen von der Arbeit zu kommen, vielleicht aus einer der verspiegelten, fast „himmelhohen“ Banken, und eilen gerade zum Zug. Andere haben genügend Zeit, herumzuschlendern, sich in ein Café zu setzen, einkaufen zu gehen, Bekannte oder Geschäftspartner zu treffen. Im Kaisersack, direkt gegenüber dem Haupteingang des Bahnhofs, steht ein Fahrzeug der Polizei. Ein paar Reisende blicken sich suchend um, nehmen vorsichtshalber Abstand von der Gruppe Männer und Frauen, die mit Bierdosen in der Hand laut und ausladend gestikulierend diskutieren. Insgesamt wirkt alles sehr geschäftig. Großstadtleben eben, aber doch sehr fremd.
Wir versuchen, die Gesichter auszublenden und uns Gebäude, Läden und Einrichtungen näher anzusehen. Hier soll sich also das spektakuläre „Rotlichtviertel“ befinden und die über die Grenzen Frankfurts hinaus bekannte Drogenszene? Im Moment können wir uns das noch gar nicht vorstellen. Ein paar vereinzelte Videoshows, ansonsten Geschäfte, Banken, Cafés, Imbisse, große, beeindruckende Altbau-Villen – bei näherem Hinsehen stellen wir fest, dass sie teilweise leer stehen.
Wir biegen in die Moselstraße nach links ein. Hier kommen wir der Sache schon näher. Es gibt etliche Bars, Live-Shows und Bordelle. Wahrscheinlich wirkt das Ambiente bei Nacht anders, tagsüber macht es einen etwas verschlafenen, unbelebten und schmuddeligen Eindruck. Es ist, als betritt man eine eigene kleine Welt.
An der Ecke zur Taunusstraße drängt sich das großflächig angeschlagene „Supervideo“ ganz in Pink auf. Zwischen weiteren Videokabinen, Shows und Spielotheken befinden sich Kneipen, Fast-Food-Läden, Geschäfte, ein Supermarkt und die Zentrale der Deutschen Bahn AG. Eine Peepshow hat einen integrierten Döner-Imbiss. „Heidis Bierstube“, vor der sich einige Leute versammelt haben, ist mit drei großen Vorhängeschlössern gesichert.
In der Elbestraße, die wir nun entlang gehen, sieht es schon mehr nach „Drogenszene“ aus. Die Hauswände und Gehwege sind ziemlich verdreckt; ab und zu weht ein „Duft“ wie von der Bahnhofstoilette vorüber. Vor einer Eingangstür sammeln sich mehrere Leute: Das ist der Konsumraum des Drogennotdienstes (DND). Er ist leicht zu übersehen, würden nicht so viele Menschen davor stehen. Auch vor anderen Hauseingängen und am Straßenrand sitzen oder stehen kleinere Gruppen von Frauen und Männern herum. Auf der rechten Straßenseite gegenüber dem Druckraum reihen sich die Sex-Shows nebeneinander. Ob das alles auch Bordelle sind, wird zumindest am Nachmittag nicht ersichtlich.
Wieder in der Kaiserstraße atmen wir erst einmal durch. Hier wirkt alles etwas „normaler“. Die Videokabinen fallen neben den Geschäften und der Kaufhalle nicht so sehr auf. Die Straße wirkt nicht so „verrucht“, sie ist größer und weiter. Vor einer Bank sitzen ein paar Obdachlose mit ihren Hunden, die von den meisten Vorübergehenden geflissentlich übersehen werden.
Jetzt nähern wir uns dem eigentlichen Drogen-Straßenstrich in der Weserstraße. Wir sind etwas enttäuscht – wo sind die vielen Frauen, die wir hier erwartet haben? Zwei Frauen, die möglicherweise Prostituierte sein könnten und aussehen, als würden sie auf Kundschaft warten, stehen etwas gelangweilt am Straßenrand. Sonst sitzen am Brunnen auf dem Vorplatz eines Bankhochhauses ein paar Leute. Einige kommen gerade von der Arbeit aus der Bank. Auffällig ist, dass es in dieser Straße überhaupt keine Läden, Bars, Bordelle oder ähnliches gibt. Außer der Bank und anderen Büros ist nichts zu sehen. Auch Wohnungen scheint es hier kaum zu geben. Die Straße wirkt deshalb weniger lebhaft. Was diese Ruhe stört, sind die vielen Autos, die die Straße entlang schleichen. Wir setzen uns einen Moment auf den Brunnenrand. Das soll also der Straßenstrich sein? Wohl schon, denn viele der Autos fahren jetzt schon das dritte Mal an uns vorbei. Die Fahrer blicken suchend umher.
Wir setzen uns wieder in Bewegung. Fühlen uns irgendwie unwohl, von den Männern begafft und dauernd beobachtet.9 Nun wieder in der Taunusstraße gehen wir im Getümmel etwas unter. Es ist schwierig, sich hier zu orientieren. Die Autos, die schon mehrfach an uns vorbeigefahren sind, scheinen Runde für Runde zu drehen und biegen an der nächsten Ecke wieder links in die Elbestraße ein. Bei genauerem Hinsehen bemerken wir auch hier immer wieder Frauen, die leicht (es ist Sommer) aber unauffällig gekleidet, in den Haus- und Videokabinen-Eingängen stehen und warten. Eben steigt eine Frau, die gerade noch in einer Clique von Szeneleuten stand, in ein Auto. Der Fahrer und sie scheinen sich zu kennen.
Rechts in der Elbestraße fahren nicht mehr so viele Autos. An der Ecke, vor einem leerstehenden Haus „hängen“ etliche wohl der Drogenszene zugehörige Männer und ein paar vereinzelte Frauen „ab“. Sie wirken teilweise fertig und runtergekommen. Wahrscheinlich werden sie an dieser Stelle am ehesten in Ruhe gelassen, da sich kein Geschäftsbesitzer beschweren kann, dass sie den Eingang belagern. Es stinkt fürchterlich nach Urin. Bis auf den Geruch wirkt die Straße irgendwie anders – einladender. Es scheint nicht mehr so viele Bordelle zu geben, dafür mehr Kneipen und schöne alte Häuser. ‚Fast wie im Urlaub irgendwo im Süden‘ könnte man denken.
In der Niddastraße scheinen wir uns vom Zentrum des Geschehens etwas zu entfernen. Hier ist nicht mehr so viel Treiben auf der Straße. Viele große, teilweise sehr hässliche Bürohäuser, das Institut für Wirtschafts- und Sozialethik und daneben die Geschäftsstelle der Integrativen Drogenhilfe (IDH) mit einigen Büros. Dort ist auch ein weiterer Konsumraum, vor dem sich einige Menschen sammeln. Sie scheinen zu warten, hereingelassen zu werden.
Nun wieder in der Moselstraße: Auf der rechten Straßenseite befindet sich das Café Fix, auch ein Kontaktladen, in dem die Drogenkonsumentinnen und -konsumenten sich aufhalten, beraten lassen, etwas essen, waschen und schlafen können. Hier ist auch das Frauencafé, allerdings nicht nur für drogengebrauchende Frauen. Ansonsten gibt es wieder einige Shows und Bars, nicht gerade einladend, sondern dreckig und düster. Viele Läden und ehemalige Kneipen stehen wohl schon längere Zeit leer.
Nach diesem Rundgang begeben wir uns wieder zum Bahnhof und verlassen das Viertel. Die vielen Eindrücke müssen erst einmal sortiert werden. Um sich wirklich zurechtzufinden und wahrnehmen zu können, was dort vor sich geht, muss man diese „kleine Welt“ wohl noch oft begehen.
Vor allem interessiert uns die Frage: Wie sieht das Ganze nachts aus?
Es ist eine laue Sommernacht mitten in der Woche. Wahrscheinlich sind nirgendwo in Frankfurt um diese Uhrzeit so viele Menschen auf der Straße wie hier, auch wenn es im Vergleich zum hiesigen Wochenend-Treiben wenig erscheint. Wir laufen, vorsichtshalber in männlicher Begleitung – was Begutachtung und Anmachen von Seiten der sich dort aufhaltenden Männer allerdings nicht ausschließt –, die gleiche beschriebene Strecke ab. An einigen Stellen wirkt das Viertel um diese Zeit ganz anders. Überall bunte Lichter, die Bordelle sind nun eindeutig zu erkennen. So verwandeln sich die „Urlaubsatmosphäre-Häuser“ in Etablissements, was sich tagsüber kaum erahnen ließ. Das auffällige pinkfarbene „Super-Video“ wirkt dagegen im Schein der Leuchtreklamen und der rot bzw. blau beleuchteten Fenster viel blasser und unscheinbarer.
Während in der Kaiserstraße gerade aufgeräumt wird und kaum noch etwas los ist, sind die Schwerpunkte des nächtlichen Treibens die Taunus-, Elbe- und Moselstraße. Besonders konzentriert es sich an den Straßenkreuzungen, vor einigen Bordelleingängen oder Kneipen. Vor dem Druckraum des DND sind viele Menschen versammelt. Etwas weiter abseits stehen Türsteher oder Prostituierte etwas gelangweilt in den Eingängen. Vor dem Café Fix liegen bergeweise Reste von Spritzenpackungen. An vielen Stellen wird unser Schritt wegen des aufdringlichen Uringestanks unweigerlich schneller. Einige Polizisten beschäftigen sich gerade intensiv mit einem Mann, zwischendurch fährt das eine oder andere Polizeifahrzeug durch die Straßen oder steht auf Beobachtungsposten. Die Mitarbeiter einer sozialen Einrichtung, die sich in einem Industriegebiet abseits des Bahnhofsviertels befindet, sammeln in ihrem Bus Leute für das Nachtquartier ein.
Auf dem Straßenstrich in der Weserstraße ist außer einer Frau und den immer wieder Runde für Runde fahrenden sowie scheinbar ziellos herumschlendernden Männern niemand zu sehen. Dagegen stehen in der Elbe- und Taunusstraße einige Frauen, die wohl gerade anschaffen sind. Eine verhandelt mit einem Freier, der vorher schon etliche Runden auf seinem Motorrad gedreht hat. Fünfzig Mark, wie wir im Vorbeigehen mitbekommen, scheinen ihm zu viel zu sein. Auffallend ist, dass im Gegensatz zum Tagesgeschehen keine Prostituierten in den Eingängen der Videokabinen stehen. Vielleicht liegt das aber auch an den sommerlichen Temperaturen.
Frauen, die sich um diese Zeit im Viertel aufhalten, gibt es im Vergleich zur Anzahl der vorbeifahrenden oder -gehenden Männer, auffallend wenige. Sie sind bis auf einige Ausnahmen für die Anwesenden klar entweder der Drogenszene oder den Sex-Shows und Bordellen zuzuordnen. Und warum sollten sie sich sonst dort „herumtreiben“? Die Verhältnisse scheinen also für die meisten Männer klar, was man ihren Blicken und Worten entnehmen kann. Deswegen trollen wir uns, es reicht für heute.
Die beschriebenen örtlichen Gegebenheiten bilden den geographischen Rahmen des Geschehens, das ich genauer untersuchen möchte. Sie bilden nicht nur die Kulisse für Prostituierte und Freier auf dem Drogenstrich und vermitteln zusammen mit den dort Anwesenden eine besondere Atmosphäre, sondern markieren den Rahmen bestimmter lokaler Praktiken, die eine eigene „kulturelle Ordentlichkeit“ konstituieren (Klaus Amann/Stefan Hirschauer 1997, 20).
Wie nun lässt sich dieser Forschungsgegenstand in seiner Besonderheit und seinen eigenen Strukturen entdecken? Wie lassen sich die Mechanismen und Routinen, mittels derer die Handelnden dort zusammenfinden und kommunizieren, herausfinden und rekonstruieren? Statt das Für und Wider verschiedener Forschungsmethoden und methodologische Zusammenhänge zu diskutieren (vgl. dazu Uwe Flick (1995, 1998), Barbara Friebertshäuser/Annedore Prengel (1997), Anne Honer (1989) oder Amseln L. Strauss (1991)), möchte ich mein Vorgehen sowie die spezifischen Merkmale und Schwierigkeiten in einem solchen Milieu zu forschen, schildern, um den Forschungsprozess und die Ergebnisse nachvollziehbar zu machen.
Als Forscherin im Milieu
Relativ unvoreingenommen, aber doch mit Bildern der verschiedenen Medien im Kopf, habe ich ein mir unbekanntes Terrain betreten, ein „Spielfeld”, dessen Regeln ich noch nicht kannte. Die ersten Eindrücke waren ambivalent: eine Mischung aus Befremdung, Unsicherheit, Angst aber auch Neugier und dem Reiz des Ungewissen verbunden mit der Frage, ist das in Ordnung, also moralisch und forschungsethisch korrekt, was ich hier tue. Darüber nachzudenken blieb nicht viel Zeit. Als weibliche Beobachterin wurde ich zumindest von den Freiern, teilweise auch von den Dealern, sehr schnell in deren Sinnkonstruktionen einbezogen, weshalb sich meine Wahrnehmung anfangs besonders auf diese Beteiligten richtete. Ich war vorwiegend mit mir beschäftigt und damit, die Annäherung der Männer abzuwehren und mich dennoch aufmerksam im Feld zu bewegen.
Ich beobachtete das Geschehen auf den öffentlichen Plätzen aus der Außenperspektive. Doch die sofortige Einbeziehung (und dadurch sehr gute Verdeutlichung meines Einflusses auf das Feld) machte es bald unmöglich, einfach nur „Zaungast“ zu sein. Die Rollen im Feld sind, sobald man sich längere Zeit dort aufhält, relativ klar verteilt bzw. werden von den Teilnehmenden entsprechend zugeschrieben. So ist es für männliche Forscher recht unauffällig, das Geschehen zu beobachten, da eine wesentliche Aktivität im Feld, vor allem seitens der Freier, das Beobachten selbst ist.10 Spezifisch für dieses Milieu ist es also, dass man als Beobachterin von einem Großteil der Beteiligten ebenfalls sehr genau beobachtet wird.
Zentrales Thema war somit der Umgang mit den teils offensichtlichen, teils vermuteten Attributionen seitens der männlichen Akteure im Feld. Kann und will ich mich dem „Beglotztwerden” und den Anmachen der Freier aussetzen? Wie zeige ich, dass ich nicht „dazugehöre”? Wie reagiere ich, wenn mich ein Freier anspricht, um einerseits etwas zu erfahren, aber gleichzeitig auch ganz klare Grenzen zu ziehen? Es zeigt sich also eine gewisse Ambivalenz zwischen der notwendigen Nähe, um Informationen und Einblicke erhalten zu können, und den beständigen Versuchen aufgrund von Ängsten, beispielsweise vor Überschreitungen der persönlichen Distanz, körperlichen Übergriffen und bezogen auf eigene Tabuthemen sowie daraus resultierendem Unbehagen, Unsicherheit und (teilweise unbewusster) Abwehrhaltung, Distanz zu halten.
Deshalb beobachtete ich nicht nur offen11, sondern auch verdeckt aus einem weitgehend geschlossenen Kastenwagen mit getönten Scheiben, um Eindrücke tatsächlich einmal distanziert gewinnen zu können, aber auch um nicht selbst immer nur damit beschäftigt zu sein, irgendwie reagieren zu müssen. Dies hatte allerdings den Nachteil, dass die Akteurinnen und Akteure, sobald sie außer Sichtweite waren, tatsächlich von der Bildfläche verschwanden. Insofern passte ich letztendlich die Beobachtungsformen wieder den Bewegungen des Feldes an, um mehr über die dortigen Praktiken zu erfahren. Um meinen Einfluss auf die Handlungen der Akteurinnen und Akteure genauer reflektieren zu können, ließ ich mich bei der Beobachtung wiederum von anderen beobachten.
Während meines Aufenthalts im Bahnhofsviertel kam ich mit einigen Freiern ins Gespräch, die mich für eine Prostituierte hielten und ansprachen. Es war ausgesprochen schwierig, bei diesen Gelegenheiten mein eigentliches Anliegen und meine Rolle an diesem Ort zu erklären. So wurden aus diesen Sequenzen eher Garfinkelsche Experimente (vgl. Harold Garfinkel 1973). Über Störungen der „gängigen” Kommunikation fand ich zumindest einige Anhaltspunkte heraus, wie Freier mit einer solchen Störung umgehen, von welchen Selbstverständlichkeiten sie ausgehen und wie sie die Prostituierten ansprechen. Besonders deutlich wurde dabei der von den Freiern angenommene Konsens, Frauen, die sich an diesem Ort längere Zeit aufhalten, bieten auch ihre sexuellen Dienste an. Mussten sie feststellen, dass sie sich irrten, reagierten sie teilweise ungehalten. Eine Klärung der Angelegenheit war allerdings kaum möglich, da in den Gesprächen i.d.R. nur mit „Andeutungs-Vokabular” (s. Kap. ) kommuniziert wurde.
Trotz der geschilderten Berührungsängste fand ich es erstaunlich einfach, den Freiern ins Gesicht zu sehen. Dazu verhalf mir auch das Wissen über meine Rolle und mein Anliegen sowie das Nicht-Wissen der Freier. Nach ersten Erfahrungen und mit zunehmender Vertrautheit bewegte ich mich selbstsicherer im Bahnhofsviertel. Dazu trugen auch ein Rundgang mit einer Streetworkerin und die Besuche der Druckräume bei. Über deren Mitarbeiterinnen konnte ich Kontakte zu Frauen knüpfen. Das erleichterte auch die Beobachtung der Drogenprostituierten, bei denen ich anfangs viel Skrupel hatte, ihren Tagesablauf, der immer etwas Verbotenes und Geheimes beinhaltet, „auszuspionieren”. Außerdem konnte ich den Frauen damit vermitteln, dass ich keine „Neue” – also keine Konkurrentin – war. Meine Befürchtung, als solche gesehen zu werden, bestätigte sich allerdings nicht.
Grenzen der Beobachtung und Berichte der Akteure
Teilnehmende Beobachtung ist gut geeignet, um einen Einblick in Abläufe, Verhaltensweisen, Einflussfaktoren und die Dynamik des Untersuchungsgegenstandes zu bekommen. Gerade die Analyse des Einstiegsprozesses und das mögliche „Befremdet-Sein“ können Selbstverständlichkeiten, Aushandlungs- sowie Routineprozesse offen legen (vgl. Flick 1995, 154). Auch die nonverbale Kommunikation, die gerade auf dem Drogenstrich ganz entscheidend ist, lässt sich nur durch genaues Beobachten untersuchen. Jedoch lassen sich nicht alle Phänomene beobachten. Allein räumlich und zeitlich können nur Ausschnitte der sozialen Realität erfasst werden. Beispielsweise konnte ich häufig kurze Kontakte zwischen Drogenprostituierten und Freiern verfolgen, die dann wieder auseinander gingen. Die konkrete Interaktion lässt sich nur vermuten aber nicht genauer beobachten. Deshalb war es nötig, die Hintergründe und die konkrete sprachliche Kommunikation in Interviews zu erfragen.
Interviews sind Berichte über das Geschehen, mit ihnen lassen sich „die Konzepte der Teilnehmer über ihre Kultur, aber nicht der alltagskulturelle Vollzug selbst erleben“ (Helga Kelle 1997, 203). So ist Alltagshandeln zu beobachten, das häufig unbewusst und auf Nachfragen hin von den Beteiligten sprachlich nicht verfügbar ist, „weil sie es im Modus des Selbstverständlichen und der eingekörperten Routine haben“ (Amann/Hirschauer 1997, 24). Die Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster sowie die dahinter verborgenen Sinnebenen sind in der Regel nicht vollständig zugänglich, sodass sie weder befriedigend beschrieben noch erklärt werden können.
Die Kontakte zu den Frauen, die ihren Drogenkonsum vorwiegend durch Prostitution finanzieren, knüpfte ich über Mitarbeiterinnen der Druckräume. Dadurch wurde natürlich eine gewisse Vorauswahl getroffen: Welche Frauen könnten etwas zum Thema sagen? Wie gesprächsbereit sind sie und können sie die Zeit des Gesprächs durchhalten? Sicher wurde mit dieser Vorgehensweise eine bestimmte Gruppe Frauen ausgewählt: meist schon etwas ältere Frauen mit jahrelanger (mehr oder weniger phasenweiser) Drogen-, Szene- und Prostitutionserfahrung, die die Angebote der sozialen Einrichtungen wahrnehmen. Diese Frauen entsprachen in der Regel nicht dem oft in verschiedenen Medien zu findenden Bild der „fertigen Junkiehure“.
Insgesamt standen mir 15 Interviews mit Prostituierten zur Verfügung. Außerdem führte ich Experten-Interviews mit einer Streetworkerin und zwei leitenden Polizeibeamten, um einen Einblick in die Positionen der Verwaltungsinstitutionen zu bekommen, die wesentlich am Alltag der Drogenprostituierten beteiligt sind. Die befragten Drogenprostituierten waren zwischen 20 und 40 Jahren alt, die meisten Ende 20/Anfang 30. Dementsprechend bewegen sich auch die Zeiten ihrer Drogen- bzw. Szeneerfahrungen zwischen drei und 20 Jahren. Mit der Prostitution haben die meisten erst zu einem späteren Zeitpunkt begonnen, es sei denn, sie arbeiteten bereits vor ihrem kompulsiven Drogengebrauch oder unabhängig davon als Prostituierte in einem Bordell oder einer Bar. Bis auf vier Frauen, die eine eigene Wohnung hatten bzw. bei ihren Eltern lebten, waren zum Interviewzeitpunkt alle wohnungslos oder in einer sozialen Einrichtung untergebracht.
Sicherlich gibt es auch andere Formen von Drogenprostitution: Frauen, die sozial eingebunden sind, eine eigene Wohnung haben, kontrolliert konsumieren, arbeiten gehen und sich mit Prostitution zusätzliches Geld für Drogen verdienen oder als „Professionelle“ in Bordellen arbeiten, müssen sich anders organisieren und sind anderen Einflussfaktoren ausgesetzt als den hier beschriebenen. Insofern stellen die interviewten Frauen möglicherweise eine spezielle Gruppe Drogenprostituierter dar – nämlich die öffentlich sichtbaren.
In der Interviewsituation mit den Drogenprostituierten war es sicherlich von Vorteil, ihnen als Frau gegenüber zu sitzen. Männliche Interviewer konnten doch immer als potentielle Freier erscheinen. Meine Beobachtungserfahrungen trugen zu einem immerhin möglichen gemeinsamen Blickwinkel bei. Gleichzeitig konnte ich meine eigenen Wahrnehmungen im Feld überprüfen. Beobachtung und Interviews ergänzten sich also, so dass beide Methoden ein zunehmend differenziertes Bild über das Geschehen auf dem Drogenstrich ermöglichten.
Teilweise wurden die Frauen sehr nachdenklich, Erinnerungen kamen auf. Das war manchmal auch mit Tränen verbunden. Meine Interviewpartnerinnen erwiesen sich gleichwohl als kompetente „Situationsgestalterinnen“. Sie sprachen von dem, was sie glaubten, mir anvertrauen zu können. Die Bedenken, die Gersch et al. (1988, 6) zu Beginn ihrer Studie äußern, dass man nicht davon ausgehen könnte, die Frauen seien bezüglich ihrer Prostitutionserfahrungen so reflektiert, dass man sie ohne weiteres befragen könne, kann ich nicht bestätigen. Es hing von der konkreten Situation und der Person ab, was und wie die Frauen erzählten. Sie konnten ohne weiteres bestimmen, wie weit sie das Thema an sich heranließen.
Die Basis für die Beschreibung der Interaktionsprozesse auf dem Drogenstrich bilden demnach die Interviews und die Beobachtungsprotokolle. Mein eigenes Vorwissen und bestimmte im Gedächtnis verhaftete Szenen und Erlebnisse spielen bei der Interpretation ebenfalls eine wichtige Rolle. Was die Prostitutionskunden betrifft, kann ich nur auf die eher zufälligen Zusammentreffen zurückkommen. Einige Gesprächssequenzen habe ich aufgenommen. Die Versuche, über die Interviewpartnerinnen zumindest an deren Stammfreier heranzukommen, scheiterten. Zwar sahen die Frauen in meinem Anliegen kein Problem, zur Umsetzung kam es aber nicht.
Bei der Auswertung des Materials orientiere ich mich an den beobachtbaren Vorgängen und dem daraus abzuleitenden Prozess, der sich nach einiger Zeit abzeichnete. Ein sechsstufiges Phasenmodell soll die Erfassung der Vorgänge und die Darstellung der Interaktionsprozesse erleichtern. Die verwendeten Interviewpassagen dienen vorwiegend der Vergegenständlichung und Illustration der geschilderten Vorgänge. An einigen Stellen lasse ich die Frauen selbst sprechen, da sie in bestimmten Momenten aus ihrer subjektiven Sicht die Lebenswelt „Drogenprostitution“ am besten beschreiben können. Auf Interviewausschnitte, an denen sich Prozesse und Hintergründe besonders gut aufzeigen lassen, gehe ich ausführlicher ein. Die jeweilige Verwendung dürfte aber beim Lesen erkennbar werden. Die Namen der Interviewpartnerinnen habe ich geändert.
8 Die anschließende Führung lässt sich auf dem Lageplan im Anhang verfolgen.
9 Das dürfte insbesondere den Frauen so ergehen.
10 Für sie können sich allerdings andere Probleme ergeben, wie z.B. die Abgrenzung von Freiern bzw. von der Zuschreibung, ein solcher zu sein.
11 Offene Beobachtung im Sinne von sich sichtbar im Forschungsfeld zu bewegen, aber nicht als eine für alle Teilnehmenden klare und offensichtliche Tätigkeit.