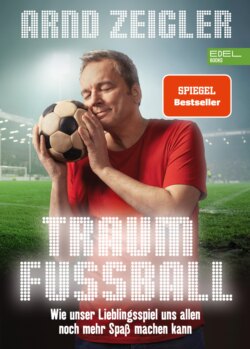Читать книгу Traumfußball - Arnd Zeigler - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
oder: Doch, manchmal schon
ОглавлениеDie Art und Weise, in der wir uns über Tore unseres Vereins freuen, hat sich in den letzten Jahrzehnten wenig verändert. Das bevorzugt gerufene Wort dabei ist immer noch »Ja«. Motorisch hat sich unser Jubelverhalten etwas weiterentwickelt. Unsere Großväter warfen einfach die Arme in die Luft. Bei unseren Vätern kam irgendwann die geballte Faust dazu. Seitdem ist wenig Neues entstanden auf dem Jubelmarkt. Was sich hingegen durch die vergangenen 40 Jahre massiv gewandelt hat, ist die Art und Weise, die Menge und die Art der Informationen, die wir über unser Hobby inhalieren. Als ich klein war, und ich war sogar SEHR klein, gab es samstags die Sportschau und das Aktuelle Sportstudio, und das auch nur dann, wenn ich brav war.
Am Montag kaufte ich mir die Fußball-Woche oder den Kicker, je nach enthaltenem farbigen Mannschaftsbild, und dann wartete ich auf den nächsten Samstag und das nächste Spiel. In der Tagespresse gab es alle zwei oder drei Tage einen staubtrockenen, unaufgeregten Lagebericht zur Situation des Lieblingsvereins, meistens kurz und knapp über den Stand bei verletzten Spielern und die zu erwartende Aufstellung. Europacup-Abende waren so selten und besonders, dass man sich auch als Kind schon wie ein Kind darauf freuen konnte. Als ich zehn war, spielten die Bayern gegen Real Madrid! Real Madrid!!! REAL!!! MADRID!!! Ich weiß, das ist nichts Besonderes mehr. Aber damals war es das. Damals hat man sich wochenlang auf dieses Spiel gefreut, weil es ein Spektakel war, das sich da anbahnte. Wisst ihr, wie oft die Bayern vor diesen Spielen 1976 gegen Real Madrid gespielt hatten? Nie. Null mal. Wisst ihr, wie viele Aufeinandertreffen von Bayern und Real Madrid es in den 70ern gab? Eines. Das Erwähnte. Ein Hinspiel, ein Rückspiel. In den 80ern waren es vier Spiele, in den 90ern kein einziges. Dann kam das neue Jahrtausend. Seit 2000 gab es das Spiel Bayern gegen Real 20 Mal, stand Juli 2020. Wenn die jetzt gegeneinander spielen, ist es immer ungefähr so wie beim letzten Mal, das Mal davor, oder das Mal davor. Bayern gegen Real gibt es jetzt viel öfter als Bayern gegen Fortuna Düsseldorf. Diejenigen, die sich diese Topspiel-Übersättigung irgendwann mal ausgedacht haben, haben an beinahe alles gedacht. Sie haben sich aber nur unzureichend dafür interessiert, wie man einem Fan ein Spiel immer und immer wieder auftischt, ohne dass es sich irgendwann so anfühlt wie eine zu oft geschaute Fernsehserie.
In den 80er-Jahren traten Computer in unser aller Leben, und gut zehn Jahre nach dem Einzug der ersten PC-Fußballspiele in unsere Jugendzimmer erwachte das Internet. Und mit diesen beiden Neuerungen lernten wir Managerspiele, Live-Ticker, Datenbanken, Transfergerüchtseiten, FIFA Soccer, jedermann zugängliche Statistikwüsten und Fanforen kennen. Vieles davon war sehr schön, das meiste aber nur sehr kurz. Die erwähnten Managerspiele, die man am PC nächtelang zockte, meist einhergehend mit einer schlimmen Niederlagenserie für die eigene Körperhygiene, haben unsere gesamte Fußballwelt auf links gezogen, ohne dass uns dies in der Regel bewusst geworden ist. Die Erkenntnis, die wir aus den Managerspielen in die reale Fußballwelt getragen haben, ist: Man braucht möglichst viel Geld. Man muss Spieler so kaufen, dass man sie möglichst schnell möglichst teuer weiterverticken kann. Junge Talente muss man einfach nur ganz oft einsetzen, damit sie von ganz alleine zu Superstars werden. Wenn man einen Superstar hat, muss man ihn möglichst lukrativ veräußern, damit man vom Erlös drei kleineren Vereinen drei ihrer Leistungsträger wegschnappen kann, die man dann wiederum zu Stars machen und teuer weiterverkaufen kann. Und immer so weiter.
PC-Fußballmanagerspiele haben uns in vielen Dingen versaut. In meiner Fußball-Pubertät habe ich den Atem angehalten, wenn mein Verein einen neuen Spieler gekauft hat. Ich wollte nicht, dass der irgendwann teuer weiterverhökert wird. Ich wollte, dass der einfach nur bei meinem Verein spielt. So lange wie möglich. Meine fünf gemeinsamen Jahre mit Rudi Völler in Bremen werde ich immer in meinem Herzen tragen. Er ahnt das nicht einmal. Und NIE in diesen fünf Jahren habe ich auch nur eine Sekunde lang gedacht: »Mensch, vielleicht kriegen wir für den ja mal richtig viel Asche!« Heute ist das anders. Ein Spieler kann sportlich noch so vielversprechend sein – wenn seine Marktwertentwicklung keine großen Sprünge verheißt, werden ihn nicht wenige Fans nur sehr zurückhaltend ins Herz schließen. Auch Leihtransfers ohne Kaufoption sind nicht wirklich beliebt, weil der geliehene Spieler dann noch so gut sein darf, er aber nicht zu Geld gemacht werden kann. Solche Befindlichkeiten sorgen dafür, dass selbst ein Spieler wie Kevin de Bruyne, der heute zu den besten Mittelfeldstrategen der Welt zählt, in seiner einzigen Saison bei Werder Bremen in den Fanforen nicht mit allzu viel Euphorie begrüßt wurde: »Ohne Kaufoption? Was soll das bringen?«
Die Managerspielkultur hat in vielen von uns das Bewusstsein verankert, als Verein müsse man im besten Fall immer genug Asche besitzen, um notfalls die ganze Mannschaft wegschicken und durch frische Spieler ersetzen zu können. Und wenn das nicht zum Erfolg führt, dann gleich nochmal. Daraus resultiert bei vielen auch der Wunsch nach einem Investor für ihren Lieblingsklub. Was Fans in einem Investor sehen wollen: Jemanden, der kommt und dem Verein Geld schenkt, damit der Verein endlich viel mehr richtig machen und viel tolleren Fußball mit viel tolleren Spielern spielen kann, nachdem die ewigen Nulpen auf dem Rasen endlich aussortiert werden konnten. Was Investoren wirklich tun: In den meisten bekannten Fällen erhöhen sie das Finanzvolumen eines Vereins kurzfristig, damit aber auch die Verbindlichkeiten, und für ihr Geld wollen sie meistens auch einen Gegenwert. Das ist oft ganz doof. Wenn ihnen der Gegenwert vorenthalten wird, geben sie fiese Interviews, in denen sie erklären, wer alles im Weg steht und wegmüsse, damit sie mit ihrem vielen Geld dem Verein endlich mehr Erfolge kaufen können. Würden sie dem Verein Geld schenken wollen, wären sie keine Investoren. Im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist das Wort »Investor« aber besetzt als »Menschen, die in der größten Not kommen, um uns viel Geld zu geben«.
Die Spieler selbst tun ihr Übriges, indem sie einen Vereinswechsel nur allzu oft als »nächsten Schritt« sehen (und fühlen). Als Kind hatte man noch die Illusion, dass ein toller Spieler vor allem deshalb kommt, um in Deiner Stadt dauerhaft Fußball zu spielen und Teil Deines Vereins zu sein. Der Spieler selbst dachte das übrigens als Kind auch noch. Heute ist klar, dass beinahe alle Vereine für die meisten teuer eingekauften Spieler eine Umsteigeplattform sind. Ich gehe aus Österreich nach Holland, um danach in Deutschland spielen zu können. Oder aus Sambia nach Dänemark, um mich für England interessant zu machen. Das ist heute normal und auch verständlich, aber es ist schade.
Managerspiele haben noch einen weiteren relativ neuartigen Nebeneffekt, der für Vereine und ihre Protagonisten gelegentlich lästige Auswirkungen mit sich bringt. Schon vor 50 Jahren schrieb und redete man immer wieder süffisant von »50 Millionen Bundestrainern, die alles besser wissen«, wenn zum Beispiel im Vorfeld einer WM die Kompetenz des tatsächlichen Amtsinhabers in Leserbriefen oder Kneipen vehement in Frage gestellt wurde. Der große Unterschied zu heute: Damals hatten die Kritiker eine vage Ahnung davon, dass sie zwar eine laute Meinung, aber letztlich keine besseren Fachkenntnisse als die Verantwortlichen besitzen. Heute ist das anders. Jahrelanges Managerspielen erreicht irgendwann den gefühlten Status eines Fernstudiums. Besser noch: eines mit Bravour bestandenen Fernstudiums. Als Folge ist das Internet voll von übellaunigen Forenschrei-bern, die jeden Transfer besser beurteilen, jede Mannschaftsaufstellung madig machen und jede Taktik vernichten können. Meistens erst im Nachhinein, aber oft auch schon vorher. Das kann sehr viel Erfüllung bringen. Jedoch nur, solange man nicht wirklich Verantwortung übernehmen und sich an seinen Theorien messen lassen muss.
Was zumindest in den schon erwähnten Parallelwelten im Internet erstaunlich weit in den Hintergrund getreten ist, ist das Wissen um die eigene Fehlbarkeit. Es wird nicht vermutet und hinterfragt, ob ein Trainer, ein Manager, ein Reporter oder ein Fan unrecht haben oder etwas zu wenig nachgedacht haben könnte. Es wird vorausgesetzt, brüllend. Die Position »Ich habe vielleicht selbst zu wenig Einblicke und Ahnung, also kann ich mich auch täuschen, aber könnte es nicht sein, dass…?« gilt in unserer Zeit als nahezu ausgestorben. Sie wurde unbarmherzig verdrängt von einem bei jeder noch so harmlosen Fußballrandnotiz sofort spür- und lesbaren »WIE KANN MAN NUR SO BEHÄMMERT SEIN?!«.
Jogi Löw zum Beispiel ist sehr oft behämmert. Er hat zur WM 2014 keinen echten Mittelstürmer mitgenommen, obwohl sehr viele Kritiker notfalls selbst den damals 63-jährigen Horst Hrubesch lieber in der deutschen Elf gesehen hätten als eine »falsche Neun« im Kader. Bei der Benennung des WM-Aufgebots durch den Bundestrainer war der am häufigsten geäußerte Satz: »Nach der Vorrunde ist sowieso Schluss!« Der Verlauf der WM gab allen Unkenrufern recht: Das WM-Finale gewann Deutschland nur sehr knapp.
Kritik und gegensätzliche Meinungen sind wichtig und können erfrischend sein. Für Fußballfans ist es aber ganz grundsätzlich ein Gewinn, sich bei aller Echauffiertheit zur gegebenen Zeit auch etwas Demut, Gelassenheit und Bereitschaft zum Zuhören zu bewahren. Und die eigene Faszination und Unbefangenheit so oft es geht zu spüren. Fußballfan werden ist ja wirklich nicht schwer, wie wir auf den letzten Seiten gemeinsam erarbeitet haben. Fußballfan sein dagegen sehr. Und jetzt haben wir den Salat: Wir sind Fußballfans geworden und werden es in den meisten Fällen auch bleiben.
Die Parallelen zu Lebensgemeinschaften und Beziehungsthemen drängen sich auf. Anziehung und Leidenschaft verleihen uns anfangs sehr viel Leichtigkeit, aber dann kommt irgendwann der Alltag. Und die Erkenntnis, dass es viel schöner ist, in Lissabon den AS Monaco zu schlagen als in Pirmasens aus dem DFB-Pokal auszuscheiden. Oder analog dazu: In der Beziehung ist es viel schöner, gemeinsam ein Eis am Gardasee zu essen als den Partner zur Darmspiegelung zu fahren. Wenn man viel Glück hat, passiert das Erste öfter als das Zweite. Oft ist es aber umgekehrt. Lissabon ist nur einmal im Fanleben, fußballerische Darmspiegelungen erleben wir hingegen öfter. Und der ganz große Rest des Fußballalltags spielt sich irgendwo dazwischen ab, also auf der endlosen Wiese zwischen triumphal und blamabel. Das muss man immer wissen, und damit muss man sich arrangieren. Ein Leben lang auf das nächste Lissabon warten hilft ebenso wenig weiter wie die ständige Furcht vor dem nächsten Pirmasens. Alles dazwischen will auch gespielt werden.
Wenn die Begeisterung für Fußball nicht mit großen Emotionen einhergehen würde, wäre es eine lausige Begeisterung. Dass das Leben als Fußball-Nerd vergleichsweise wenig mit Rationalität zu tun hat, kam hier auch schon zur Sprache. Das bedeutet für uns Fans: Wir müssen das Ausleben unserer Leidenschaft für unseren Verein so gestalten, dass wir damit gut klarkommen. Das klappt nicht, wenn wir als Fan von Sonnenhof Großaspach jedes Jahr auf einen Champions-League-Sieg hoffen oder als Schalke-Fan auf die Meisterschaft. Die Ansprüche müssen realistisch sein, damit sie nicht zum permanenten Frustspender werden. Ebenso wenig erfüllt es dich, wenn du aus Gewohnheit immer nur mit dem Schlimmsten rechnest, auch wenn derartige Dauerpanik bei manchen Vereinen ja durchaus naheliegend sein kann.
Das höchste Gut eines glücklichen Fußballfans ist der Glaube an den eigenen Verein. Glaube nicht im Sinne von blinder Gefolgschaft. Glaube im Sinne von Empathie, Positivität, Loyalität, Geduld. Ich muss nicht glauben, dass meine Helden auf dem Rasen durchweg fantastische Menschen sind, dass mein Verein objektiv betrachtet allen Ligakonkurrenten zwar nicht sportlich, aber mindestens moralisch weit voraus ist und dass wir Fans für die Spieler wichtiger sind als alles andere auf der Welt. Aber ebenso muss ich nicht zwingend glauben, dass mich mein Verein grundsätzlich ärgern will, dass an den entscheidenden Positionen nur Trottel sitzen, dass die Spieler eh bald alle weg sind und dass es sowieso nie wieder etwas wird mit diesem Klub.
Der schon angeklungene Vergleich mit Familie und Partnerschaft ist letztlich an vielen Punkten des Fan-Daseins eine echte Messlatte. Zu Hause werden wir auch enttäuscht. Es laufen Dinge nicht, man redet aneinander vorbei, Erwartungen bleiben unerfüllt, gemeinsame Träume geraten in Vergessenheit. Dem entgegen steht das viele Gute, das wir im Idealfall bekommen: tiefe Zuneigung, Loyalität, Nähe, Verbindlichkeit, Glück, Vertrauen, erfüllbare Ziele.
Unseren Lieblingsverein lieben wir auch, möchten wir glauben. Und wir möchten, dass andere es glauben. Wir verlieren aber mit zunehmendem Alter gelegentlich aus den Augen, wie man mit Menschen umgeht, die wir lieben. Zu Hause lösen wir das, indem wir uns wieder zusammenraufen, reden, störende Dinge ausräumen, uns neu aneinander annähern und immer wieder neu klären, was uns aneinanderfesselt. Mit Fußballvereinen ist das sehr viel komplizierter. Als Fan mal eben mit dem Trainer ausquatschen oder die Beziehung zum Klub neu aufpeppen, indem man mit dem Vorstand einen Wochenendtrip nach Venedig plant, ist in keinem einzigen mir bekannten Fall von Erfolg gekrönt gewesen.
Warum aber fällt es uns so schwer, einem geliebten Verein dasselbe entgegenzubringen wie einem geliebten Menschen? Wenn unser Verein den Bach runtergeht, ist das Fordern von Entlassungen und die Lust auf rollende Köpfe spürbar. Wir sind wütend und fordern eine Kompensation für unser getrübtes Freizeitvergnügen. Wir wollen Schuldige für schlechte Resultate oder einen miesen Tabellenstand. Und weil das alles raus muss, hauen wir drauf. Es gibt heute ja zum Glück soziale Netzwerke, wo man seine eigene Unzufriedenheit nach dem Gießkannenprinzip viel schneller und bequemer loswerden kann als früher, wo man noch einen Leserbrief hätte schreiben müssen. Mit Schreibmaschine. Und koordinierten Fingern. Und man hätte ihn anschließend falten, in einen Umschlag stecken, frankieren und zur Post bringen müssen. Das hätte eine mehrteilige, durchdachte, koordinierte Handlung vorausgesetzt.
Nicht wie heute, wo man seine Meinung in Sekundenschnelle auf Facebook oder Twitter loswird. Notfalls ohne Satzzeichen, notfalls ohne Preisgabe der eigenen Identität, und oft so in die Tastatur gehackt, dass man denken könnte, der Kommentar sei direkt mit der Faust geschrieben worden. Oder mit der Stirn, je nach Ergebnis des Wochenendes.
Ein wichtiges Tool für den Ausdruck der eigenen Unzufriedenheit sind Satzzeichen (wobei das Ausrufezeichen hier ganz weit vorne liegt und erheblich wichtiger ist als zum Beispiel das Semikolon). Noch wichtiger sind wahlweise der Tränenlach-Emoji oder der Wut-Emoji. Ohne diese Erfindungen würden viele Fans hilflos daran scheitern, ein verlorenes Spiel zu analysieren. Früher bot Facebook nur den ausschließlich positiv verwendbaren »Gefällt mir«-Daumen an. Mit dem ist nach Niederlagen beinahe nichts anzufangen. Der Wut-Emoji hilft vor allem Fußballfans, die ihre Gemütslage nach einem Spiel nicht in Worte fassen können. Ein Emoji geht immer. Der geht sogar schon während des Spiels. Der tiefere Sinn dieser Erfindung ist nicht ganz klar. Sehr viele Diskussionen über Fußball würden besser laufen, wenn man den Leuten Wut oder Gehässigkeit nicht zu einfach machen würde. Aber das wäre auch nicht im Sinne vieler Medien und mancher Fans.
Die Folgen sind häufig skurril. Mittlerweile ist abgrundtiefe Wut in Fankreisen eine völlig okaye, verbreitete Spielart der Nachbereitung einer Fußballnachricht. Gleichgültigkeit oder Differenziertheit sind kaum noch messbar. Wer nicht glücklich ist, ist wütend. Geduld haben, genauer hinschauen, abwägen, hinterfragen – das alles ist oft zu mühselig geworden. Wut geht direkt ins Blut, wie ein besonders schnelles Schmerzmittel, nur eben umgekehrt. Das unterscheidet sich in Nuancen von Medium zu Medium. Wer als Redaktion Wut säen und wutaffine Menschen antriggern möchte, bekommt Krawall in seinen Kommentarspalten. Oft wird diese Online-Wut als Kritik verklärt, aber Kritik enthält ja im Idealfall etwas Konstruktives, Hilfreiches. Der orangene, wutentbrannte Emoji hat noch keine Krisensituation im Weltfußball lösen können.
Das Anhäufen wütender Reaktionen in sozialen Netzwerken hat inzwischen eine bemerkenswerte Antrittsschnelligkeit erreicht. Sobald eine neue Meldung online gestellt wird, dauert es in der Regel nur noch wenige Sekunden bis zu den ersten eintreffenden Wut-Rückmeldungen. Und das betrifft auch Nachrichten, für deren Studium man eigentlich vier oder fünf Minuten brauchen würde. Shitstorms dauern kaum länger. Und das alles gilt interessanterweise für nahezu jede Art von Fußballmeldungen. Klar, es sind auch Veröffentlichungen vorstellbar, auf die »Wut« eine naheliegende und menschlich verständliche Reaktion wäre. »Roberto Baggio quält niedlichen Dackel« oder »Pierre Littbarski bestiehlt Obdachlosen« wären Meldungen, die in seriösen Medien absolut zu Recht für Unmut sorgen würden. Hunderte von Wut-Emojis erntet man mittlerweile aber auch mit Schlagzeilen wie »Griesbeck wechselt zu Union Berlin«, »Bayern interessiert an Arsenals Bellerin« oder »Buchtmann arbeitet an Comeback bei St. Pauli«.
Nicht einmal auf den ersten Blick besser sind die »Haha!«-Emojis. Die halten sich, was die Häufigkeit ihres Vorkommens betrifft, mit der inflationären Wut in etwa die Waage. Der häufige Gebrauch des »Haha!«-Emojis im Zusammenhang mit Fußballfragen spricht in den wenigsten Fällen für einen intelligenten Umgang mit Fanthemen. Ihr könnt das privat gerne einmal ausprobieren: Wer auf jede private Bemerkung eines anderen Menschen aus Prinzip erst einmal (oder ausschließlich) mit »AHAAAHAAAHAHAAAHAAA!« reagiert, bringt auf diesem Weg einen kontroversen Diskurs in ungefähr null Prozent aller Fälle ordentlich voran.
Wut-Emoji und Tränenlach-Emoji sind Geschwister. Wer reflexartig und locker aus der Hüfte bei jedem Fußballthema erst einmal prophylaktisch wütend reagiert, der möchte damit ausdrücken: »DIESE SCHWEINE MÜSSEN ALLE WEG!«. Der Lach-Emoji steht meistens für »IRRE, AUSSER MIR HAT HIER NIEMAND AHNUNG!«.Beide Gruppen halten ihr Verhalten für kritisches Querdenken.
Im wirklichen Leben funktioniert kritisches Querdenken etwas anders. Wer auf besorgte oder nett gemeinte Bemerkungen eines lieben Menschen immer nur mit »AHAAAAHAAAHAAAA!« reagiert, befindet sich fraglos in einer sozialen Sackgasse. Wer jeden noch so harmlosen Satz seiner Frau oder seiner Freundin mit blinder Wut und Emojis kontert, kommt höchstwahrscheinlich auch nicht recht weiter. Jedenfalls nicht mehr lange.
Wir alle können uns frei entscheiden, ob wir an unseren Verein, an einen bestimmten Spieler oder einen Trainer glauben wollen oder nicht. Wir haben die Wahl, ob wir die sportliche Führung grundsätzlich erst mal für komplett unfähig halten möchten, wenn sie Dinge tut, die wir nicht verstehen. Oder ob wir tief in uns respektieren, dass andere Menschen manchmal Dinge tun, die wir nicht verstehen. Auch bei Trainern wird gerne angenommen, sie hätten trotz ihrer Trainerausbildung beim DFB weniger Sachverstand als der durchschnittliche Facebook-User von nebenan. Ein Phänomen, das wir außerdem so sonst nur bei der Beurteilung von Politikern wahrnehmen, nicht aber zum Beispiel bei Neurochirurgen oder Dachdeckern. Niemand von uns würde einem Mediziner unterstellen, eine OP viel schlechter durchzuführen, als man es selbst täte. Und niemand würde einem Dachdecker vorhalten, er müsse das handwerklich alles ganz anders machen, das sei ja wohl klar. Bei Trainern aber haben wir diese Scheu nicht.
Natürlich darf man alles und jeden kritisieren. Trainer bewegen sich in der Öffentlichkeit und sollten das ertragen können. Ebenso sollten wir Fans aber verinnerlichen, dass Kritik möglichst unter Beachtung aller gültigen zwischenmenschlichen Standards in puncto Respekt geübt werden sollte. Zumindest dann, wenn man damit ernst genommen werden möchte. Wenn nicht, kann man natürlich auch gerne beim »AHAAAAHAAAHAAAA!« bleiben.
In den 70ern gab es unter Kuttenträgern in den Fanblocks das beliebte Aufnähermotiv »Mein Verein ist meine Religion!«. Es gab häufig auch ritualisierte Beschwörungen am Mittelkreis, in deren Verlauf Fans die Vereinsfahne auf dem Rasen ausbreiteten und anbeteten, wobei das Anbeten optisch oft an Klischees erinnerte, die man aus alten Abenteuerschinken im Fernsehen kannte, die im Orient spielten. In der Arena auf Schalke gibt es eine Kapelle, Papst Johannes Paul II. war Ehrenmitglied und ganz generell wurde an vielen Fußballstandorten so getan, als ähnele der Glaube an seinen Verein dem an den lieben Gott. Das tut er jedoch nur in Nuancen. Für ein Tor zu beten gilt in Fußballerkreisen als eher wenig effektiv, Nächstenliebe ist in Zweikampfsituationen ein schwieriges Thema, und auch andere christliche Werte treten gerne einen Schritt zurück, wenn ich mir auf dem Rasen ganz bibelfern einen Vorteil ergaunern kann.
Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass Glauben im Fußball elementar wichtig ist – oder sein sollte. Denn es gehört nicht viel zu der Erkenntnis, dass Fußball allen Beteiligten sehr viel mehr Erfüllung bieten kann, wenn wir solange wie möglich erst einmal an unseren Verein, unsere Spieler und unseren Trainer glauben. Nehmen wir den Torjäger, der für einen horrenden Betrag als Messias eingekauft und bei seiner Vorstellung auch genau so präsentiert wurde. Wenn dieser Spieler nun in seiner ersten Halbserie nicht die erhofften 15 Tore schießt, sondern nur eines, und das auch noch eher glücklich – was tun wir? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können ihn und alle Verantwortlichen im Internet dafür vernichten. Wie kann man so doof sein und für solch eine Blinze so viel Geld ausgeben? Das wusste man doch vorher! Ahaahaaahahaaa! Jeder weitere seiner Einsätze wird schon mit der Computertastatur auf dem Schoß erwartet, um beim ersten Stolperer die erste Armada an Wut und Gehässigkeit ins Netz hinauszuschicken. Und es sind konsequenterweise auch möglichst viele Menschen schuld, dass dieser teure Neueinkauf nicht zündet: Der Sportdirektor hat keine Ahnung, der Trainer ist zu blöd, um zu erkennen, dass man den Spieler nicht mehr aufstellen darf, und der Spieler soll sich bitte einfach wieder verpissen.
Das geht so lange, bis bei dem Spieler überraschend der Knoten platzt, er zwei blitzsaubere Tore zu einem wichtigen Auswärtssieg erzielt und auf einmal doch ganz gut ist. Das Eindreschen auf diesen Spieler hat zwischenzeitlich gutgetan, aber nun hat er seinen Nimbus der Unbrauchbarkeit verloren und ist als Feindbild untauglich geworden. Das wiederum empfindet so mancher Dauerkartenbesitzer als äußerst betrüblich, denn für viele funktioniert die Bundesliga nur über Feindbilder, auch und gerade beim eigenen Verein. Manche Zuschauer wollen sich ihre Übellaunigkeit um keinen Preis verderben lassen. Die brauchen diesen einen Spieler, den man sich schon beim Anpfiff zurechtlegt und von dem man sich baldige Fehlleistungen erhofft, damit man möglichst schon in der zweiten Spielminute mal so richtig aus dem Sattel gehen kann. Meistens ist dies über Wochen und Monate derselbe Spieler. Oft sind es Spieler, die teuer waren, schon etwas älter sind, als Schönlinge gelten, eher lässig-elegant auftreten oder, je nach Gesinnung, äußerlich zu fremd wirken.
Es tut sicher oft gut, seine eigene Unzufriedenheit als Fan zuverlässig über immer demselben Spieler auszukübeln, mit dem man einfach nicht warm wird. Es macht aber bei Licht betrachtet nichts besser. Ebenso wenig übrigens wie der Hinweis auf das zu hohe Einkommen eines Spielers. Wenn nämlich manche Spieler aus den genannten Motiven über Monate einen schweren Stand bei den Fans haben, kommt an einem passenden Zeitpunkt häufig der vernichtende Satz »Die verdienen so viel Geld, die sollen sich mal nicht so anstellen!«. Gerne gefolgt vom Satz »Wenn ich so arbeiten würde wie der spielt, hätte ich am Montag keinen Job mehr!«. Das mag sogar stimmen, aber ein Schuh wird vor allem umgekehrt draus: Würde der Spieler so spielen wie jemand, der acht Stunden lang immer dieselbe Fleißarbeit verrichtet, dann würde sich niemand auf eine Tribüne setzen, um ihm für viel Geld dabei zuzuschauen.
Weshalb eigentlich ist es nicht völlig selbstverständlich, dass wir bei allem Bewusstsein für Schwächen und Fehler nicht auch beim Umgang mit dem Verein, den Spielern oder dem Trainer erst einmal aus Prinzip loyal sind? Und geduldig, und verständnisvoll, und einfach nur nicht tendenziell missmutig und voller Zweifel, bloß weil wir es können? Klar, draufhauen ist immer einfacher und fühlt sich für einen kurzen Wimpernschlag richtig an. Aber schon für ein Minimum an Einfühlungsvermögen wird man in der Regel reich belohnt. Die zwei Tore nämlich, die der durchbeleidigte Spieler nach seiner langen Durststrecke aus dem Nichts schießt, fühlen sich plötzlich großartig an, wenn man diesen Spieler nicht vordergründig gehasst, sondern in den Monaten zuvor schon mit ihm gefühlt hat.
Wenn ich nochmal auf PC-Managerspiele zurückkommen darf: Ich habe vor langer Zeit wahnsinnig gerne Anstoß 3 gespielt. Meistens habe ich mir einen Traditionsverein ausgesucht, mit ordentlichem Stadion und solider Anhängerschar, mit dem ich in der Regionalliga anfing. Und ich habe, ich weiß es wie heute, irgendwann einmal den finnischen Stürmer Mixu Paatelainen verpflichtet, der gar nicht mal so billig war für einen Regionalligisten. Wahrscheinlich haben die vielen Vokale extra gekostet. Jedenfalls, Mixu Paatelainen sollte mein Sturmproblem beheben und hat in seinen ersten 15 Spielen als Stareinkauf meines Halleschen FC dann erstaunliche null Tore geschossen. Im wirklichen Leben wäre er verhöhnt, kaputt geschrieben und zum maximalen Fehleinkauf gemacht worden. Aber hey, ich habe an den Jungen geglaubt! Ich habe sehr viele Einzelgespräche mit ihm geführt (an alle Uneingeweihten: Damit verbessert man die Moral eines Spielers, aber wem sage ich das), und er wurde dann zum Rückhalt meiner Elf auf viele Jahre. Schließlich war er finnischer Nationalstürmer und hatte einen Marktwert von 12 Millionen DM. Die besten Vereine der Welt wollten ihn verpflichten, aber er war MEIN Mixu Paatelainen und blieb meinem Klub bis ans Karriereende treu. Seine Karriere beendete er mit 36 Jahren nach 170 Ligatoren für den Halleschen FC. Unter mir als Trainer hat Paatelainen tragischerweise viel mehr erreicht als im realen Leben, wo er nur auf lausige 18 Tore in 70 Länderspielen kam. Vermutlich hatte er bei seiner Wanderschaft durch Finnland, Schottland, England und Frankreich niemals einen so guten Trainer wie mich. Und jetzt ist es einfach zu spät.
Den Halleschen FC habe ich übrigens damals nach 25 Jahren als Manager/Trainer verlassen. Am Ende hatte der Verein nach etlichen Champions League-Teilnahmen ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von 200 000 Zuschauern. Das machte dann irgendwann auch keinen Spaß mehr.
Eine zentrale Rolle in der Ausbildung zum Fußballfan übernimmt Jahr für Jahr immer mehr auch das berühmte Spiel FIFA, an dem man ablesen kann, dass das Wort »Computerspiel« inzwischen vintage ist. Wir sind also bei der Konsole angekommen. Und bei FIFA, das durch eine zweifellos einzigartige Realitätsnähe besticht. Die Fuballspieler haben nach zahllosen Parametern aufgeschlüsselte Fähigkeiten, die in einem forensischen Akt zusammengestellt, aktualisiert und immer wieder angeglichen werden. Dadurch entspricht die Klasse des virtuellen Kickers am Ende ziemlich exakt der des menschlichen Vorbilds. Fast. Sie pflanzt uns aber auch das Grundgefühl ein, ein besserer Spieler müsse IMMER besser funktionieren als ein schlechterer Spieler, denn auf der Playstation ist das schließlich so.
Der virtuelle Spieler ist IMMER schneller als der als schlechter programmierte Gegenspieler. Anders als sein Vorbild in der wirklichen Welt hat er aber auch nie einen doofen Tag, Sorgen, Beziehungsstress, schlecht geschlafen, grundlos miese Laune oder eine Magenverstimmung. Man muss für ihn kein Verständnis aufbringen, wenn er mal ein Laufduell verliert, denn er verliert keines, wenn der Gegenspieler schlechtere Werte hat. Hilfreich für alle Spieler aus Knochen, Muskeln, Haut und Nervenzellen wäre, wenn man sie und ihre Leistungen anders behandelte als ihre Ebenbilder auf der Konsole, die ausschließlich aus Pixelhaufen bestehen.
Um dies klarzustellen: Ein Spieler braucht kein Mitleid und keine unermessliche Nachsicht. Wenn er schlecht spielt, spielt er schlecht. Es reicht aber völlig aus, sich über eine schlechte Leistung dann zu ärgern, wenn sie abgeliefert wird. Und nicht vorsorglich über die kommenden Monate von Minute eins an bei jedem weiteren Spiel. Als Fan in ein Bundesligaspiel zu gehen mit einer Gefühlslage à la »Mal sehen, ob heute der Knoten platzt…!« nützt allen viel mehr als der Stadionbesuch mit einem tagelang aufgebauten »Das wird doch sowieso wieder nichts!«. Vor allem dem Fan. Es ist nicht einmal mühsam, anstrengend oder schwer zu lernen. Man muss es allerdings wollen. Es ist manchmal mit komplizierten Lösungen verbunden, mit Differenzierung und manchmal auch mit Fragen, auf die es nicht immer sofort Antworten gibt. Die Alternative sind einfache Schuldige und simple Rezepte. Wer auf so etwas steht, reagiert konsequent unwirsch und höhnisch auf jeden, der Verständnis oder Empathie äußert. Wir reden hier über zwei verschiedene Welten der Fußballwahrnehmung, die manchmal in keinerlei Verbindung zueinander zu stehen scheinen. Wann und wodurch genau kam es dazu, dass viele von uns nach verlorenen Fußballspielen nicht mehr wie früher traurig und enttäuscht sind, sondern empört und aggressiv? Dass sich die Menschen mittlerweile, statt zu trauern, persönlich beleidigt fühlen? Man kann es nun machen wie in anderen Lebensbereichen auch. Man kann die Gründe dafür bei anderen suchen. Man findet sie aber vermutlich nur bei sich selbst.