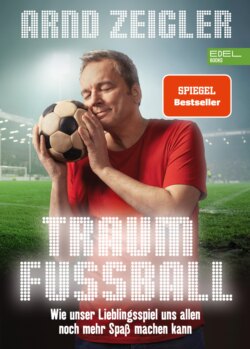Читать книгу Traumfußball - Arnd Zeigler - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
oder: Wie alles so richtig losgeht (und nie wieder aufhört)
ОглавлениеOkay, es wird ernst. Bis jetzt ging es um Autogramme, Sammelbildchen und Hans Tilkowski, um Schokoriegel und Trikotfarben. Alles schön, alles wichtig. Aber alles eher Zeugnisse von erwachendem Interesse, wie man es auch für Ausdruckstanz, Pflanzenkunde oder das Ausmalen von Mandalas entwickeln kann. Du denkst, Du hast ein neues Hobby. Du denkst, Fußball ist toll und macht Freude. Du denkst, Du hast die Wahl. Aber irgendwann packt es Dich. Und plötzlich hast Du Dein Herz verloren. An einen Verein. Ab diesem Moment ist alles anders, und mit »alles« meine ich: alles. Das Schlimme ist: Das geht wirklich nie wieder weg. Das Fantastische ist: Es geht nie wieder weg. Einem Verein verfallen zu sein ist ein Stück Schicksal. Und wenn es geschehen ist, kannst Du Dir ohne jegliches Bedenken das Wappen Deines Klubs auf den Oberarm tätowieren lassen. Das wird nie ein Problem sein, anders zum Beispiel als der Name der ersten Freundin. Der Verein bleibt. Er ist wie Dein Schatten. Du vergisst ihn manchmal für einen Moment, manchmal siehst Du ihn vor lauter Trübnis nicht, und er ist in manchen Phasen kleiner als zu anderen Zeiten. Aber er gehört zu Dir, er ist wie Du, Du wirst ihn nicht los, und jeder kann ihn sehen.
Seinen Lieblingsverein findet man auf extrem unterschiedliche Weisen. Es kann anfangs die Trikotfarbe sein, und den Rest der Leidenschaft baut man sich über die Jahre drumherum. Es kann die eigene Herkunft sein, ein Lieblingsspieler oder ein besonderes Fußballspiel, bei dem man sich stürmisch und unerklärlich in seine Mannschaft verguckt. Dieses Thema kann man eigentlich nicht vertiefen, ohne spätestens an dieser Stelle Nick Hornby zu zitieren, sinngemäß: »Du suchst Dir nicht Deinen Verein aus, sondern Dein Verein sucht sich Dich aus.«
Es kann die verlockende Aussicht sein, als Fan eines besonders nachhaltig erfolgreichen Vereins immer auch ein bisschen auf der Siegerseite zu stehen. In solch einem Fall hat man sich im Grunde für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis entschieden. Aber es gibt auch ganz andere Faktoren, die zur Findung eines Lieblingsvereins beitragen. Bei einem Auftritt in Berlin sah ich mal in der ersten Reihe einen Fan des Karlsruher SC sitzen. Zumindest trug er dessen Trikot. Nach der Veranstaltung fragte ich ihn neugierig: »Hier in Berlin ein KSC-Trikot – bist Du Karlsruher?« Er erwiderte: »Nein, ich bin Berliner. Das ist alles etwas merkwürdig entstanden, diese Sache mit Karlsruhe. Ich habe einen Bruder, der schon immer Fan des 1. FC Kaiserslautern war. Wir verstehen uns nicht besonders gut. Und einmal, während eines heftigen Streits, habe ich ihn dann gefragt: ›Sag’ mal, welchen Verein findest Du eigentlich so richtig doof?‹ Ja, und seitdem bin ich Fan vom Karlsruher SC.«
Bei mir ist es Werder Bremen. Das ist nicht immer einfach, aber für mich ist dieser Verein ein biografischer Glücksfall. Ein Schulfreund und ich sind etwa im Alter von elf Jahren mal zum Training geradelt. Er war Werder-Fan, ich suchte noch. Und dann fand ich. Werder Bremen war zu jener Zeit ein Verein, an dem im Grunde alles falsch war. Er spielte seit einem knappen Jahrzehnt gegen den Abstieg, war arm wie elf Kirchenmäuse, hatte seine Vereinsfarben einem Fischkonservenhersteller zuliebe vergessen und spielte in blauen Trikots. Die Mannschaft spielte meist bieder, selten vor mehr als 15 000 Zuschauern, und das Weserstadion war marode und zugig. Nichts, aber auch gar nichts an diesem Verein war glamourös oder vielversprechend. Der einzige Star der Mannschaft war Haudegen Horst-Dieter Höttges, der aber schon 34 war. Für mich war er etwas Besonderes. Nicht, weil er 1974 Weltmeister wurde, sondern weil es ihn damals auch als Shell-Münze gab und weil auch er auf dem Nationalelfposter über dem Bett meines großen Bruders zu sehen war. Es gab ihn wirklich. Und er spielte vor meiner Haustür in Bremen. Sein bekanntester Satz war: »Solange ich für Werder spiele, steigen wir nicht ab.« Er versprach es, und er hielt es. Solche Beschützer wünscht sich jedes Kind.
Dass Höttges sein Versprechen hielt, war toll. Dass niemand anders Werder Bremen derart über Wasser halten konnte, weniger. Zwei Jahre nach seinem Karriereende stieg Werder ab. In die damalige 2. Liga Nord, in der es danach ein Jahr lang Spiele gegen Bocholt, Erkenschwick, Lüdenscheid, Solingen und Oldenburg gab. Ich habe jedes verdammte dieser Spiele gesehen, zumindest die Heimspiele. Ich war inzwischen dafür zuständig, in der Westkurve die damalige Stadionzeitung zu verteilen. Dafür gab es freien Eintritt. Diese Zweitligasaison hat massiv zu meiner Sozialisation beigetragen. Gefühlt fand jedes der 42 Spiele (!) bei Dauerregen und 7 Grad Celsius statt. Kann natürlich gar nicht stimmen, hat sich mir aber so eingebrannt. Im Weserstadion waren in den Kurven inzwischen die Oberränge wegen akuter Baufälligkeit gesperrt worden, und im dadurch noch freudloseren Rund tummelten sich bei den Spielen manchmal 6000, manchmal 8000 Zuschauer. Aber das war egal, denn auf dem Rasen stand nach den Jahren des Abstiegskampfs plötzlich eine höchst spannende Mannschaft, in der Erwin Kostedde sein letztes Hurra erlebte, der greise Klaus Fichtel hinten alles wegverteidigte und Spezialisten wie Burdenski, Meier, Möhlmann und Reinders dafür sorgten, dass der Wiederaufstieg nie ein Problem war.
Ich erwähnte schon, dass Werder Bremen damals keine hohe Strahlkraft besaß. Und deshalb war es alles andere als schick, cool oder angesagt, Fan dieses Vereins zu sein. Werder-Fan war man, wenn man Bremer war. Sonst nicht, wenn man es vermeiden konnte. Wenn man außerhalb Bremens die Leidenschaft für den SVW durchblicken ließ, erntete man in der Regel ein komplett fassungsloses »Weshalb DAS denn?«. Der Verein galt zwar als hanseatisch und bodenständig, aber auch als langweilig und betulich. Und so absurd es klingt, für mich wurde er gerade dadurch zur Herzenssache. Es gab keine verkopften Gründe, sich diesen Verein ausgesucht zu haben. Man konnte damit nicht angeben. Wenn man Glück hatte, wurde man nicht zu sehr geärgert. Das war das höchste der Werder-Gefühle. Aber nach den grauen Anfangsjahren kam ein rauschhaftes Jahrzehnt, das Otto Rehhagel nach Bremen brachte und nur zwei Jahre nach dem Abstieg einen Weltklassemann wie Rudi Völler. Plötzlich stand der Verein oben, begeisterte Fußballfans in ganz Deutschland, spielte Fußball zum Niederknien und wurde besser und besser, bis aus dem Mauerblümchen innerhalb von zwölf Jahren ein Meister, Pokalsieger und Europacupsieger geworden war. Weiterhin kein lauter, neureicher Verein, sondern ein zurückhaltender Traditionsverein mit Augenmaß, auf den Du als Fan urplötzlich sehr wohl stolz sein konntest. Und warum nicht einfach endlich mal stolz sein?
Natürlich war das nicht von Dauer und nicht unkaputtbar, aber die jüngere Vereinsgeschichte erfüllte jeden, der dicht dran sein durfte bei all den Überraschungssiegen, Triumphen und Wundern, mit einer tiefen Dankbarkeit. Ja, ich musste einen Abstieg erleiden, ich habe Tränen vergossen, ich habe eine Heimniederlage gegen den 1.FC Bocholt mitansehen müssen, aber dann habe ich Rudi Völler und Wynton Rufer bekommen, Titelgewinne, ein immer schöneres Stadion und einen Lieblingsverein, der nicht immer stolz machte, aber auch keinen Grund mehr bot, gebückt und niedergeschlagen durch die Liga zu schleichen. Und dadurch, dass ich nun alle Facetten mitmachen durfte und musste, sind wir cool miteinander, dieser Verein und ich. Ich wäre manchmal gerne wieder ein Titelanwärter, ich hätte manchmal gerne einen neuen Rudi Völler, aber im Großen und Ganzen fühlt es sich richtig für mich an, an der Seite dieses Vereins zu sein, der wiederum immer an meiner Seite ist. Wie mein Schatten.
Ich stand einmal mitten in Neapel in einem kleinen Café. Ich wollte nur kurz etwas Erfrischendes trinken, war aus seltsamen Gründen gemeinsam mit Guido Buchwald unterwegs und sah mich wartend um, als mir bewusst wurde, dass ich durch Zufall an einem Ort gelandet waren, von dem ich irgendwann schon einmal gelesen hatte. Eine Wand des eher kleinen Raumes war komplett übersät mit Devotionalien, die an den großen Diego Armando Maradona erinnerten, der seine größte fußballerische Zeit genau hier erlebte. Nicht in diesem Lokal natürlich, das kam dann später, aber eben in Neapel. Ein Schrein mit einer Maradona-Büste stand da, ein kleines Glasfläschchen, in dem sich der Legende nach seine Abschiedsträne befindet, vergilbte Fotos, Zeitungsausschnitte, die ganze Palette halt. Ich kam ins Gespräch mit dem Eigentümer des Cafés, der mir immer noch von Ergriffenheit und Verklärung berührt erklärte, als bei der WM 1990 Italien gegen Argentinien spielte, habe ganz Italien natürlich Italien die Daumen gedrückt – bis auf Neapel. In Neapel wollten alle, dass Maradona gewinnt. Mit Argentinien, gegen Italien. Die drittgrößte Stadt einer der größten Fußballnationen der Welt stellte sich geschlossen hinter ihren berühmtesten Sohn, obwohl er für den Gegner, ein anderes Land, einen anderen Erdteil antrat. Der Wirt verneigte sich abschließend ergriffen vor Guido Buchwald und versicherte ihm, dass er, Buchwald, damals ganz Neapel furchtbar traurig gemacht habe, weil er im Finale der WM 1990 dafür gesorgt hatte, dass der rasch zermürbte Maradona einen seiner traurigsten Fußballabende überhaupt erleiden musste.
Die Bürgerinnen und Bürger von Neapel hatten damit für sich eine Frage beantwortet, die sich uns allen immer wieder stellt, wenn ein großes Fußballereignis ansteht. Wie steht es mit meiner Begeisterung für unsere Nationalmannschaft? Wie steht es mit meiner Sympathie für elf junge Männer in Schwarz und Weiß, von denen ich den meisten das gesamte restliche Jahr über eigentlich eher nichts Gutes wünsche? Fühlen Schalke-Fans bei der Euro eine ungekannte Nähe zu Marco Reus und Mats Hummels, jubeln etatmäßige Bayern-Hater über Tore von Serge Gnabry, und freut man sich über gute Spiele von Thilo Kehrer, obwohl man Paris St. Germain sonst ganz schlimm findet?
Es fühlt sich alles richtig und falsch zugleich an. Ich war bei der Euro 1996 in England zu Gast beim Gruppenspiel unserer Elf gegen Tschechien. Alles vom Feinsten: Old Trafford, Manchester, tolle Stimmung, Deutschland gewann 2:0. Ich verließ das Stadion aufgewühlt. Mein Bremer Held Dieter Eilts hatte gewonnen, aber Andy Möller und Matthias Sammer auch, und denen hatte ich noch nie zuvor zugejubelt. Ich kam mir unaufrichtig vor. Andy Möller habe ich viele Jahre später kennengelernt. Ein supernetter Kerl. Aber das konnte ich 1996 noch nicht wissen.
Wirft man alles über Bord, was man elf Monate im Jahr mit Eifer und Enthusiasmus lebt, wenn genau diejenigen Spieler das DFB-Trikot tragen, die man ansonsten mit jahrelang organisch aufgebauter Antipathie begleitet? Wenn ja, wie geht das? Ich finde ja auch nicht plötzlich eine miese Band gut, nur weil sie Deutschland beim ESC vertritt. Ich esse beim großen Straßenfest auch nicht aus Überzeugung Kartoffeln und Sauerkraut, weil ich mich mit dem deutschen Essen besser identifizieren kann. Wie also funktioniert die Zuneigung zu unserer Elf bei einer Europameisterschaft, wenn es offenbar nicht die von Herzen kommende Sympathie für die einzelnen Spieler sein kann, die man im Klubtrikot auch eher mal auspfeift? Ganz schlimm habe ich mich übrigens im Stade de France gefühlt, wo ich 2016 im deutschen Fanblock das Euro-Gruppenspiel gegen Polen schaute. Um mich herum saß vermutlich der »Fanclub Nationalmannschaft«, der sich kollektiv so benahm, wie man es sonst am Ballermann beobachten kann. Aber dort kann man kurz um die Ecke gehen, sich übergeben, und danach ist es erst mal wieder besser. Das ging in Paris im Stadion nicht.
Eine Mannschaft liebt man aus sehr nebulösen Motiven. Erstens ist mal wichtig: Man sucht es sich nicht aus. Es passiert einfach. Plötzlich ist es im Leben von großer Wichtigkeit, wie es dem 1.FC Köln geht, oder Werder Bremen, oder gar Union Solingen. Das kann ganz schnell gehen. Seinen Verein liebt man, weil er die eigene Heimat verkörpert, oder weil er vertraut ist und nah. Weitere vermeintliche Kriterien dafür gibt es in großer Zahl: Stehst Du auf ästhetischen Fußball und hast Dir deswegen eine Mannschaft ausgesucht? War einst das schicke Trikot ausschlaggebend für Deine Vereinswahl? Gewinnt Dein Verein meistens? Stehst Du oder sitzt Du, wenn Du mit Deinem Verein fieberst? Nur so aus Neugier.
Singst Du im Stadion laut mit? Wenn ja – singst Du die richtigen Songs mit? Bedeutet es Dir viel, ob Dein Team aus intelligenten Sympathieträgern besteht, oder wäre Dir ein von lauter Arschlöchern im Trikot Deines Vereins erkämpfter Meistertitel wichtiger als ein mit elf Kumpeltypen erspielter vierter Platz?
Viele dieser Fragen sind uns Fans schon mal irgendwo begegnet. Das Problem ist: Die meisten Antworten führen auf den ersten Blick zum honorablen »echten, beinharten Fan«, auf den zweiten Blick aber ins Nirgendwo. Was hat die Dauer einer Leidenschaft mit ihrer Intensität zu tun? Weshalb muss ich über meinen Verein viel wissen, wenn mich sein aktuelles Schicksal einfach nur tief berührt? Weshalb muss ich mich geografisch für meine Leidenschaft rechtfertigen, weil ich doch dummerweise in Heidelberg lebe, aber dennoch nachts nicht schlafen kann, wenn der HSV am nächsten Tag ein Schicksalsspiel hat? Weshalb war es so verwerflich, dass ich mit acht Jahren als Erstes auf das Trikot meines Vereins abgefahren bin, wenn ich jetzt, mit 29, immer noch denselben Verein vergöttere?
Mit der Nationalmannschaft funktioniert es irgendwie anders. Das erkennt man schon allein an der erstaunlich großen Zahl von Menschen, die vor einer WM oder EM diesen berühmten Satz sagen, den wir alle schon mal gehört haben: »Eigentlich interessiere ich mich gar nicht für Fußball, aber bei einem großen Turnier gucke ich dann doch!« Herrschaftszeiten, wie machen diese Leute das? Eigentlich nicht interessieren, aber bei großen Turnieren zuschauen? Was ist es dann genau, was sie suchen, wollen, finden?
Da sind wir dann auch direkt bei der unschönen Debatte über Nationalismus, Patriotismus und Deutschlandfahnen. Für manche ist eine Europameisterschaft und das Mitfiebern mit »unserer« Elf der Inbegriff einer unschuldigen, sauberen Leidenschaft. Und für andere ist es das genaue Gegenteil. Ich vermute, dass andere es für sich schon besser erklärt haben, aber ich halte es für mich so: Ich stehe auf unsere Nationalmannschaft, weil ich mich mit dem Fußball und den Spielern identifizieren kann. Weil sie mir näher und vertrauter sind als Schweden oder Italien. Ich freue mich über DFB-Siege, aber nicht, weil wir besser waren als andere, sondern weil wir gut waren. Früher war das schwer. Da war die deutsche Elf »der Panzer«, eine Ansammlung von kühlen Kraft-Kickern, die sich auf dem Platz so lange an die früher immer siegbringenden »deutschen Tugenden« klammerte, ehe andere Mannschaften wie Frankreich, Holland oder Spanien diese Tugenden in der Mottenkiste des Weltfußballs versenkten. Wir schauten neidisch und etwas peinlich berührt auf den Zauberfußball der Anderen, als wir um das Jahr 2000 herum feststellen mussten, dass unser Verständnis von Fußball sich ein für alle Mal überholt hatte.
Es gab sogar noch schlimmere Zeiten. Anfang der 1980er-Jahre war Deutschland erfolgreich, aber die Erfolgsgeschichte unserer Nationalelf enthielt sehr hässliche Kapitel. Wir wurden Europameister 1980, und zwei Jahre später beinahe Weltmeister. In dem Jahr, als Toni Schumacher den Franzosen Patrick Battiston kaputt rammte und ein Kollektiv aus unnahbaren, wenig greifbaren Fußball-Schablonisten sich durch das »Schande-von-Gijon«-Ballgeschiebe gegen Österreich auf eine sehr unsympathische Weise unsterblich machte.
Das ist vorbei, und wir sollten alle glücklich und erleichtert sein. Unsere Elf gehört immer mal wieder zu den Besten, und sie tut das, weil sie modern und schön spielt. Wir hatten charismatische Charakterspieler wie Thomas Müller und Mats Hummels, Künstler wie Mesut Özil und Superhelden wie Manuel Neuer. Und wir spielen meistens lieber 3:3 als 0:0. Ich kann mich mit dieser Mannschaft oft identifizieren. Der Vollständigkeit halber sei aber der Hinweis erlaubt, dass ich mich sicherlich ebenso sehr mit der französischen Elf identifizieren könnte, wenn ich Franzose wäre. Und die englische Mannschaft mochte ich sogar immer schon, ganz ohne Engländer zu sein. Klingt komisch, ist aber so.
Wichtig ist nicht, warum man eine Mannschaft mag. Wichtiger ist vielmehr, dass man nicht so genau erklären kannst, warum man es tut. Je irrationaler eine Leidenschaft gewachsen ist, umso mehr Pfeffer sitzt oft dahinter. Der zündende Funke zu Beginn ist dabei fast egal. Vergleiche aus der Erotik drängen sich auf: Wenn ich seit zehn Jahren glücklich und verliebt bin (also nur mal angenommen), ist es irgendwann doch völlig schnurz, ob es anfangs ein Duft, ein Augenaufschlag oder eine Stimme war, was mich betört hat. In einem sehr alten Peanuts-Comicstrip sitzt Charlie Brown neben Linus im Schulbus. Beide reden über Mädchen und über das, was sie so anziehend macht. Und Linus sagt im letzten Bild: »Ich verliebe mich in jedes Mädchen, das nach Papierkleber riecht.«
Mit dem Fußball lief es bei mir ähnlich. Der Anfang einer Liebe mag oft oberflächlich sein – viel wichtiger ist, dass man dem Zielobjekt irgendwann so richtig verfallen ist und genau weiß, dass man nicht mehr zurückkann – später dann auch nicht mehr zurückwill. Und da sind wir dann auch schon wieder bei der Lieblingsmannschaft auf dem Rasen.
Das einzig wahre Kriterium sollte sein: Geht es mir schlechter, wenn meine Jungs verlieren? Bin ich gelöst und gut gelaunt, wenn sie gewinnen? Sabbere ich manchmal vor Freude, wenn sie eine Sensation schaffen? Möchte ich in schwachen Momenten unseren Torjäger ehelichen? Ist mein Stadion das Zentrum des Universums, wenn meine Jungs ein wichtiges Spiel austragen? Sei unklug, sei leidenschaftlich, sei irrational. Sei Fan! Deine natürlichen Feinde seien falsche Verbohrtheit, Arroganz, Überheblichkeit und Hass. Deine Freunde seien Enthusiasmus, Gänsehaut und Torschrei!
Und dabei spielt keine Rolle, ob Du im Trikot hyperventilierst oder im Smoking, ob Du im Stadion vor Wut flennst oder vor dem Fernseher, ob Du Dich kehlig singend freust oder lieber mit glänzenden Augen vor Dich hin schweigst, ob Du in der Ostkurve des Weser-Stadions mitzitterst oder leider gerade in Ibbenbüren sein musst. Niemand ist ein »besserer« Fan als Du es bist, solange es sich bei Dir richtig anfühlt.
In dem Jazz-Song »Love Me Or Leave Me« gibt es die Textzeile: »I’d rather be lonely than happy with somebody else.« So ist es mit unseren Lieblingsvereinen auch. Klar, manchmal bist Du neidisch auf andere Vereine und ihr stimmungsvolleres Stadion, ihr Budget, ihre Tradition, ihr viel schöneres Trikot, ihren Torjäger, ihren Vereinssong oder ihre seriöse Vereinsführung. Aber tauschen willst Du dennoch nicht. Denn was wäre die Liebe zu einem Fußballverein, wenn es plötzlich nicht mehr besser, schöner, erfolgreicher vorstellbar wäre? Wozu solltest Du dann noch bangen und fiebern? Worauf hoffen?
Es ist längst zu spät. Dein Verein hat Dich ausgesucht. Sieh zu, wie Du damit klarkommst. Ich versuche Dir ein bisschen zu helfen, wenn ich darf. So wie hoffentlich auch mir irgendwann einmal endlich jemand helfen wird.