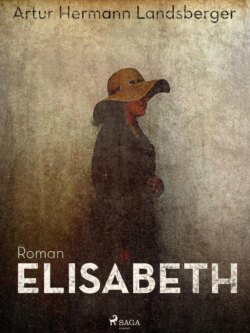Читать книгу Elisabeth - Artur Hermann Landsberger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drittes Kapitel
Оглавление„Die angebrochene Nacht“, meinte Iwan Schiff, als er mit seiner Frau und seinem Schwiegervater im Auto nach Hause fuhr, „sollte man eigentlich auf anständige Weise zu Ende führen.“
„Und schlafen gehen,“ beendete Edith den Satz.
„Nee! durchbummeln!“ erwiderte Iwan, und der alte Grothe sagte:
„Ich bin kein Spielverderber.“
„Ich sonst auch nicht,“ sagte Edith. „Aber wenn man, wie heute abend, mitten im besten Flirt unterbrochen wird, dann verliert man die Stimmung.“
„Eine verheiratete Frau flirtet nicht,“ sagte der Alte, worauf Edith und Iwan so laut anfingen zu lachen, daß der alte Grothe sie ganz verdutzt ansah.
„Und du willst ein moderner Mensch sein, Papa!“ rief Edith, als sie sich ein wenig beruhigt hatte.
„Zeig du, daß du’s bist!“ sagte Iwan, „und laß Papa und mich noch eine Stunde lang allein irgendwo hingehen.“
„Von mir aus wohin und solange ihr wollt,“ erwiderte Edith. „Obschon ich nicht begreife, wieso ich euch im Wege bin. Ich bin weder eifersüchtig noch reg’ ich mich auf, wenn ihr euch anderswohin verirrt. — Uebrigens wo steckt Erich?“
„Der Junge hat heute von mir tausend Mark bekommen,“ sagte der Alte.
„Das erklärt alles,“ meinte Iwan und befahl Leo, dem Chauffeur, statt nach Haus, in ein Ballokal im Westen zu fahren.
Leo, der Chauffeur, war wohlhabend und stieß sich nicht daran, daß er das rapide Wachstum seiner Ersparnisse weniger seiner Tätigkeit als seiner Diskretion verdankte.
Nur seiner Frau erzählte er:
„Um drei Uhr fuhr ich als erste die junge Frau Edith nach Haus. Durch den Tiergarten, obschon das ein großer Umweg war. — Aber da sie nicht allein war, so nahm ich an, daß sie es nicht besonders eilig hatte, nach Haus zu kommen. Sie sagte denn auch, als ich nach vielem Kreuz und Quer schließlich vor der Villa hielt, ziemlich enttäuscht: ‚Schon?‘ obgleich ein entrüstetes ‚Endlich‘ weit mehr am Platze gewesen wäre. Hier“ — und er legte dreißig Mark auf den Tisch —, „das gab mir der Herr, der sie bis nach Haus begleitete.“
„Und ihr Mann und der alte Herr Grothe?“ fragte die Frau.
Leo, der Chauffeur, holte aus der rechten Tasche einen Fünfzigmarkschein heraus, legte ihn auf den Tisch, betrachtete ihn und sagte:
„Das ist Herr Iwan Schiff — es zeugt von einem zwar nicht ganz reinen Gewissen, läßt aber immer noch die Möglichkeit zu, daß er sich nichts Besonderes vorzuwerfen hat. Während dies hier“ — und er zog aus der anderen Tasche einen Hundertmarkschein hervor, den er neben den Fünfziger legte — „von dem alten Herrn Grothe herrührt und keinen Zweifel darüber läßt, daß damit ein schwerer Verstoß verdeckt werden soll.“
„Ich muß offen sagen,“ erwiderte seine Frau, „daß mir die schweren Verstöße sympathischer sind als die harmlosen.“
„Das ist nicht edel gedacht,“ sagte Leo.
„Wenn es nur bei uns sauber bleibt,“ erwiderte sie. „Was andre tun, geht uns nichts an.“
„Das geht uns wohl an,“ widersprach er. „Wenn jeder so dächte, wie sollte es da besser werden? Wir müssen doch mal heraus aus dem Dreck.“
„Willst ausgerechnet du den Anfang machen?“
„Wenn das jeder sagen wollte, würde es nie anders.“
„Geh doch hinauf zur Gnädigen und sag’ ihr, wie’s ihr Mann treibt — wenn du glaubst, damit dein Vaterland zu retten. Und wenn du dann deine Stelle los bist, dann lauf zum Staatsanwalt und erzähl’ ihm von den Schiebergeschäften, die er macht.“
„Wenn ich’s mir leisten könnte, ich tät’s schon,“ erwiderte Leo. „Was er in Wiesbaden mit den Franzosen verhandelt — ich weiß so allerlei aus seinen Gesprächen während der Autofahrten — das ist nichts anderes als Landesverrat.“
„Was geht’s dich an? — Der nächste Herr, zu dem wir kommen, treibt’s womöglich noch toller.“
„Da magst du recht haben.“
„Jeder sieht heut, wo er bleibt.“
„Das ist es! Was dabei aus dem Ganzen wird, das kümmert ihn sonst was. Und daraus entsteht das ganze Elend.“
„Das du als letzter ändern kannst,“ erwiderte sie. „Dazu brauchst eine starke Hand, die wie ein Donnerwetter reinfährt.“
„Bravo!“ stimmte er zu. „Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen.“
„Na also! dann sind wir ja mal wieder einig.“
Sie gab ihrem Mann die Hand, er zog sie zu sich auf den Schoß und drückte sie an sich. —
Anders ging es inzwischen oben in der Villa zu.
Der alte Grothe war nach drei Stunden Schlaf und einer kalten Abreibung grade wieder Mensch geworden und saß vor seiner reich beladenen Frühstückstafel, als der Diener den Kandidaten Paul Schäfer meldete. Grothe sagte mit vollem Munde:
„Ins Büro!“
„Das habe ich dem Herrn auch gesagt,“ erwiderte der Diener. „Aber er erklärt, es handle sich nicht um Geschäftliches.“
„Schon faul!“
„Darf ich ihn ins Herrenzimmer führen?“
„Unsinn. — Er soll Ihnen sagen, was er will.“
Der Diener verbeugte sich und ging; kam aber gleich darauf zurück und meldete: „die Angelegenheit sei durchaus diskreter Natur“.
„Quatsch! wenn es sich nicht um ein Geschäft handelt, kann es auch nicht diskret sein. Er soll Ihnen sagen, was er will — sonst bedaure ich, ihn nicht empfangen zu können.“
Der Diener verschwand wieder und es entwickelte sich in der Halle zwischen ihm und Schäfer folgendes Gespräch.
„Der Herr Generaldirektor ersuchen nochmals, die Angelegenheit zunächst mir vorzutragen.“
„Unmöglich!“
„Dann bedauert er ...“
„Ja — aber es gibt doch Dinge, die so diskret sind, daß man sie nicht mit Dritten besprechen kann.“
„Der Herr Generaldirektor bestreiten das, da es sich, wie Sie ja selbst sagen, um kein Geschäft handelt.“
„Es handelt sich um Wichtigeres.“
„Das werden Sie dem Herrn Generaldirektor schwer klarmachen können, daß es Wichtigeres gibt als Geschäfte.“
„Ich werde es ihm klarmachen!“
„Kaum! da er Ihnen keine Gelegenheit dazu gibt.“
„Das ist ja doch Wahnsinn! Ich — ich — ja, ich kann es Ihnen unmöglich sagen.“
„Sie wollen ihn anpumpen.“
„I Gott bewahre!“ brauste Schäfer auf und fiel aus der Rolle: „Ich will seine Tochter.“
„Na also! da hab’ ich doch recht.“
„Sie sind verrückt,“
„Wenn Sie sich so einführen, mein Herr, haben Sie wenig Chancen.“
„Also wollen Sie mich jetzt melden?“
Der Diener griente und sagte:
„Sie haben Nummer achtzehn.“
„Was soll das heißen?“
„Ja, meinen Sie, Sie sind der erste? Hier geht alles der Reihe nach. Gestern war Nummer siebzehn da der um die Hand unseres gnädigen Fräuleins anhielt. Ein sehr schmucker Assessor. Und da er auch sonst bewies, daß er ein Mann von Welt war“ — dabei machte er eine nicht mißzuverstehende Handbewegung — „und mir einen Braunen in die Hand drückte, so hab’ ich ihn um drei Nummern hinaufbefördert. Er rangiert jetzt als Nummer vierzehn. Hier herrscht Ordnung.“
Mit diesen Worten verschwand er und stand gleich darauf wieder im Frühstückszimmer des alten Grothe, der ungeduldig fragte:
„Na also — was will er?“
„Ihre Tochter!“
„Also ein Geschäft. Dacht’ ich’s mir doch.“
„Wenn ich mir dazu ein Wort erlauben dürfte ...“
„Selbstredend dürfen Sie. Sie sind vor dem Kriege fünfzehn Jahre lang in den ersten Häusern Diener gewesen, haben also mehr Blick für solche Dinge als unsereins.“
„Zuviel Ehre, Herr Generaldirektor.“
„Quatsch! Sie haben die Erfahrung, und dafür bezahle ich Sie. — Also wie, glauben Sie, würde sich Herr v. Schwalbach, bei dem Sie zuletzt waren, zu einem solchen Schwiegersohn stellen?“
„Ablehnend.“
„Grund?“
„Das läßt sich schwer sagen, man hat das im Gefühl.“
„Schlecht angezogen?“
„Erstens das. Der Cut ist mindestens drei Jahre alt und über drei Zentimeter zu kurz. Der Zylinder um mehr als eine Nuance zu sehr geschweift und dann — und dann —“ sagte er ganz empört.
„Was ist noch?“ fragte der Alte.
„Nein! der Mann ist schon rein äußerlich ganz unmöglich,“ erwiderte er lebhaft und überzeugt, „und ...“
„Ja, was ist denn?“
„Er trägt im Knopfloch das schwarz-weiße Band. — Bedenken Herr Generaldirektor, wo er doch damit rechnen muß, in diesem Hause mit Herren von der Entente zusammenzutreffen.“
„Das ist natürlich unmöglich — obschon, wenn ich mich nicht irre, auch die Herren Franzosen ihre Abzeichen tragen.“
Elisabeth war während dieser Worte ins Zimmer getreten.
Der Diener, der ihr den Rücken kehrte, erwiderte:
„Ja, die Franzosen! Herr Generaldirektor vergessen, daß sie die Sieger sind.“
Da lachte Elisabeth laut auf.
Der Diener erschrak und wandte sich zu ihr um.
„Die Franzosen die Sieger!“ wiederholte sie höhnisch. „Sie sind wie die Memmen geflohen und wären in sechs Wochen erledigt gewesen, wenn sie sich nicht wie Dirnen der ganzen Welt an den Hals geschmissen hätten.“
Der alte Diener nickte und Elisabeth fuhr fort:
„Als das Verhältnis zehn zu eins war, da konnten sie siegen! Aber auch da erst, nachdem sie uns völkerrechtswidrig ausgehungert hatten und ein übermüdeter, schlecht ausgerüsteter, verhungerter deutscher Soldat zehn ausgeruhten, satten, mit allen Hilfsmitteln ausgestatteten Gegnern gegenüberstand. Ein schöner Sieg das!“
„Das stimmt!“ sagte der Diener zaghaft. „Aber jetzt, wo sie uns mit Hilfe der andern alle Waffen abgenommen naben und wir uns nicht mehr wehren können, da sind sie uns doch über.“
„Memmen!“ wiederholte Elisabeth. „Ueber einen wehrlosen Körper, dem sie vorsichtshalber Arme und Beine ausgerissen haben, schreiten sie triumphierend hinweg, pflanzen sie ihr siegreiches Banner auf. Sobald der sterbende Körper aber auch nur ein Zucken von sich gibt, schreien sie wie hysterische Weiber um Hilfe und beraten mit ihren Freunden, wie sie das letzte Aufflackern eines Sterbenden bekämpfen können. Diese Helden würden nur lächerlich wirken, wenn nicht gerade wir die Opfer ihrer feigen und sadistischen Eitelkeit wären.“
„Aber Elisabeth!“ rief Frau Jenny, die mit ihrer Tochter und Erich von der offenen Veranda aus alles mit angehört hatte. „Seit wann kannst du, die du bisher die Sanftmut selbst warst, so hassen.“
„Es hat immer Sieger und Besiegte gegeben,“ sagte Grothe. „Damit muß man sich abfinden.“
„O nein!“ erwiderte Elisabeth. „Solche Sieger hat es, solange die Welt steht, nie gegeben, und wird es, da die Vernunft der Völker die Welt vor neuen Siegen der Franzosen behüten wird, auch nie wiedergeben.“
Frau Jenny war an Elisabeth herangetreten und legte den Arm um sie.
„So also hat Reinharts Rückkehr auf dich gewirkt!“ sagte sie sanft.
„Es war längst in mir,“ erwiderte sie. „Seit gestern aber weiß ich, daß es so nicht weitergeht.“
„Was kann man ändern?“ fragte Grothe.
„Ich weiß es nicht. — Aber es gibt etwas — es muß etwas geben! — Denn sonst ...“
„Was — wäre — sonst?“ fragte die Mutter.
„Sonst müßte man aufhören, an Gott zu glauben.“
„Kind!“ rief Frau Jenny und drückte sie an sich. —
In diesem Augenblick trat Iwan Schiff ins Zimmer.
„Du kommst mir sehr gelegen,“ sagte Grothe.
„Was geht denn vor?“ fragte Schiff und der Alte erwiderte:
„Allerlei!“
Der Diener, der noch immer auf Bescheid wartete, machte sich bemerkbar.
„Ach so!“ sagte der Alte. „Dann kommt’s darauf auch nicht mehr an. Herein mit ihm!“
Alle sahen zur Tür, durch die mit dem etwas zu kurzen Cut, dem um eine Nuance zu stark geschweiften Zylinder und dem Band des eisernen Kreuzes im Knopfloch, Paul Schäfer trat.
Iwan Schiff, der ihn nie gesehen hatte und daher den Grund seines Kommens nicht einmal ahnte, musterte ihn, schielte auf das schwarzweiße Band und dachte:
„Immer noch besser als ein Hakenkreuz.“
Lotte, die Jüngste, der der Besuch galt, errötete und sah zur Erde, stand aber so unglücklich zwischen Elisabeth und ihrer Mutter, daß ihr Wunsch, unbemerkt zu verschwinden, unmöglich war.
Erich und Schäfer bekämpften sich politisch und haßten sich, ohne daß sie voneinander mehr wußten, als daß der eine Kommunist und der andere deutschnational war. Dies schien dem einen so verächtlich, wie jenem das andre, und so hatten sie trotz mancher gesellschaftlichen Begegnung denn auch gar keinen Wert darauf gelegt, sich kennenzulernen.
Paul Schäfer schlug die Hacken zusammen und stellte sich vor.
„Angenehm!“ erwiderte der Alte. „Darf ich bekannt machen?“ — und dabei wies er auf die Umstehenden. „Ich weiß nicht, wie weit Sie bereits in den Schoß meiner Familie eingedrungen sind.“
„Aber Leopold!“ ermahnte Frau Jenny ihren Gatten.
„Na ja! Ich bin es ja gewöhnt, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Aber da wir zufällig einmal alle hier versammelt sind, so können wir das Geschäft ja gleich erledigen.“ — Er sah nach der Uhr. — „In dreißig Minuten habe ich eine Sitzung, bis dahin müßt ihr also verlobt oder geschieden sein.“
„Wer?“ fragte Iwan Schiff, der jetzt glaubte, es ginge ihn an. „Wer denkt denn an Scheidung?“
Der alte Grothe lachte und erwiderte:
„I Gott bewahre! Im Gegenteil. Dieser Herr da hat sich in den Kopf gesetzt, dein Schwager zu werden.“
Schiff betrachtete ihn von der Seite, stieß sich an dem Cut, der zu kurz und an dem Zylinder, der um eine Nuance zu stark gewölbt war, vor allem aber an dem schwarz-weißen Band im Knopfloch und sagte, indem er mit dem Finger darauf hinwies:
„Das ist ja ganz nett, Herr ... wie war doch Ihr Name?“
„Schäfer,“ wiederholte der Kandidat.
„Richtig! Herr Schäfer! Aber damit kann man heutzutage keine Familie ernähren.“
„Ja, soll denn das hier so öffentlich verhandelt werden?“ fragte Frau Jenny.
„Oeffentlich?“ wiederholte Grothe und sah sich um. „So weit mein Auge reicht, sehe ich überall nur Familie.“
„Immerhin wäre es doch wohl am Platze,“ meinte Frau Jenny — „wenn du zunächst mal mit Herrn Schäfer unter vier Augen sprichst.“
„Und dann mit dir. Und hinterher mit Lotte, und schließlich mit allen gleichzeitig! — Ausgeschlossen! Soviel Zeit kann ich zu meinem Bedauern für Familienangelegenheiten nicht aufbringen. Zumal bei drei Töchtern! — Also bitte, Herr Schäfer, Sie sind ...“
„Kandidat der Rechte!“
„Was trägt das?“
Paul Schäfer erschrak.
„Ich verstehe nicht ganz ... Herr Generaldirektor“
„Aber Leopold!“ sagte Frau Jenny.
„Was ist?“ erwiderte der arglos, „die Frage ist doch berechtigt.“
„Es trägt nicht,“ mischte sich Iwan ins Gespräch, „es kostet!“
„Sie besitzen demnach Vermögen?“ fragte der Alte, und Schäfer erwiderte zögernd:
„Leider nein!“
„Dann kann es doch also nichts kosten.“
„Ich verdiene, was mein Studium kostet, durch Unterricht, den ich gebe.“
„Aha! — Und wieviel ist das?“
„Vierhundert Mark.“
„Das wären etwa zwölftausend im Monat, im Jahr also zirka hundertundfünfzigtausend. — Hm, viel ist es nicht, aber es läßt sich hören. Meine Frau hat die Kinder einfach erzogen — viel einfacher, als es mir lieb und als es nötig ist. Wenn ich also meinerseits ebenfalls hundertfünfzigtausend gebe, so könnten Sie fürs erste vielleicht damit auskommen. — Aber Sie müssen sich umkrempeln — verstehen Sie? — So, wie Sie jetzt aussehen, geht das natürlich nicht. Und dann, wie ist das gesellschaftlich? Ihr Vater?“
„Der lebt leider nicht mehr!“
„Was war er?“
„Pastor.“
„Pas ...? hm — ja — etwas kleinbürgerlich, nicht wahr? Auf dem Lande, da geht so was. Aber in der Stadt — was meinst du, Iwan?“
„Ich bin da wohl nicht ganz zuständig.“
„Ich bitt’ dich, du weißt doch, was ein Pastor ist.“
„Gewiß! Aber ich erkläre mich dafür befangen.“
„Jenny, was sagst du?“
„Da der Fall sehr gegen mein Gefühl — nun einmal öffentlich behandelt wird, so meine ich, daß nicht der Stand des Vaters, sondern der Mensch entscheidet.“
„Welcher Mensch?“
„Ob er Charakter hat und eine Zukunft — und ob er unser Kind wirklich liebt.“
„Ach so!“ erwiderte Grothe und wandte sich wieder an Schäfer. „Also, wie ist das?“
„Ich glaube wohl, daß ich eine Zukunft habe. Und was den Charakter betrifft, so gehöre ich zu der deutschnationalen Partei.“
„Als was?“
Schäfer verstand nicht und erwiderte:
„Dem Gefühl nach.“
„Bleiben Sie mir nur mit Gefühlen vom Leibe. Damit verdienen Sie heute nicht einen Dollar. Wenn Sie Politiker sind — ich hab’ nichts dagegen, und es ist mir auch völlig gleich, bei welcher Partei — Hauptsache: es trägt etwas. Und ob bei den Deutschnationalen nun gerade große Geschäfte zu machen sind, das erscheint mir zum mindesten zweifelhaft.“
„Ich treibe Politik nicht des Geldes wegen,“ erwiderte Schäfer entrüstet.
Der alte Grothe sah ihn groß an und auch Iwan Schiff schüttelte den Kopf und verstand ihn nicht.
„Und dann, Herr Generaldirektor, die vierhundert Mark, die ich durch Unterricht verdiene, sind natürlich monatlich — das reicht mit der Pension meiner Mutter, die jährlich viertausendachthundert Mark beträgt, grade aus, um uns durchzubringen.“
Grothe fuhr sich mit der Hand über die Stirn und sagte:
„Erlauben Sie mal — viertausendachthundert im Jahr — und noch einmal jährlich viertausendachthundert — das macht zusammen neuntausendsechshundert — davon leben Sie und Ihre Mutter, und davon soll meine Tochter auch mitleben — soviel braucht die in einem Monat für ihre Garderobe.“
„Nein, Papa!“ rief Lotte, die noch immer zwischen Frau Jenny und Elisabeth stand.
„Soll ich dir die Rechnungen zeigen? — Es ist auch gar kein Vorwurf! Im Gegenteil, du kannst es dir erlauben, das Doppelte zu gebrauchen.“
„Ich tue es nur, weil ... weil ...“
„Nun, warum?“ fragte Iwan Schiff.
„Weil es nun mal so ist, und ich es nicht anders kenne. Aber ich mache mir nichts daraus, und ich kann auch mit weniger auskommen.“
Darauf erwiderte der alte Grothe:
„Ich will dir mal etwas sagen, mein Kind! Wenn ich der alte Rothschild wäre und ich und meine Vorfahren hätten seit Jahrhunderten im Ueberfluß gelebt und wären, soweit wir zurückdenken, die reichsten Menschen Europas gewesen, und es käme eine meiner Töchter an der Hand eines verhungerten Kandidaten und sagte: „Papa, ich liebe ihn, und bin entschlossen, mit ihm zu hungern“ — so wäre das in der Geschichte der Rothschildschen Familie eine sehr aparte Nuance — und der Name Rothschild würde, wenn ich ja sagte, darunter auch nicht im mindesten leiden. Wenn aber Leo Grothe — wir sind unter uns und ich sag’ euch nichts Neues — der vor zehn Jahren noch hinter dem Ladentisch gestanden hat, seine Tochter an einen Habenichts gibt, so wird man die Achseln zucken und sagen: „Nu ja — wer wird denn da schon hineinheiraten.“
„Frau Jenny staunte über dies klare Urteil und soviel Selbstkritik und sagte: „Was gehen uns denn die Menschen an?“
„Viel!“ erwiderte Grothe. „Alles!“
„Dann solltest du nicht wie ein Parvenu leben!“
„Du hast recht, Jenny! Aber ich kann nicht anders. Morgens, nach einer durchbummelten Nacht denke ich genau wie du. Aber schon nach dem Essen erwacht in mir der neue Mensch, gegen den ich vergebens anzukämpfen suche. Gegen sechs Uhr ist der Kampf dann regelmäßig zu meinen Ungunsten entschieden.“
„Du solltest ihm mittags den Bordeaux entziehen und ihm weniger zu essen geben,“ sagte Iwan Schiff zu Frau Jenny, die von der Offenherzigkeit ihres Mannes stark beeindruckt war.
„Ich bin wie ich bin, und ihr werdet mich nicht ändern,“ erwiderte Grothe. „Und statt meine sentimentalen Anwandlungen zu fördern, solltet ihr lieber versuchen, mich vor Rückfällen zu schützen. Wir leben in einer Zeit, in der man das Gefühl nicht Oberhand gewinnen lassen darf.“
„Doch, Vater!“ mischte sich jetzt Erich in die Unterhaltung. „Du bist im Grunde deines Herzens Kommunist.“
„Was bin ich?“ fragte Grothe entsetzt.
„Du hast ein Herz für die Unterdrückten!“
„Das haben wir alle!“ sagte Elisabeth. „Dazu braucht man kein Kommunist zu sein.“ Und Schäfer, bei dem im selben Augenblick das Herz verstummte und der Politiker erwachte, rief:
„Nirgends ist die Menschheit geknechteter und unterdrückter als in Rußland!“
„Wir wollen die Menschheit zum Guten erlösen,“ erwiderte Erich. „Wenn es nicht anders geht, dann eben durch Gewalt. Alle Menschen sind Brüder.“
„Die Juden sind die Herren der Welt,“ erklärte Schäfer. „Ehe man sie nicht ins Ghetto gesperrt hat, kann es nicht besser werden.“
„Wenn überhaupt jemand helfen kann, dann sind wir es!“ rief Iwan Schiff. „Den Juden verdankt Deutschland den wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung.“
„Und den Verlust des Krieges!“ erwiderte Schäfer.
„O nein!“ widersprach Iwan Schiff. „Aber die Möglichkeit, daß es den Krieg überhaupt führen konnte.“
„Ihr seid die Väter des Kapitalismus und habt damit alles Unglück über die Welt gebracht!“ schrie Schäfer.
„Das ist nicht wahr!“ widersprach Schiff und rief: „Lesen Sie Spinoza!“ — Dabei bekannte er sich im stillen, daß er selbst nicht viel mehr von ihm wußte, als den Namen. Aber es klang so überzeugend, daß Schäfer zu einem Gegenhieb ausholte und rief:
„Fällt mir gar nicht ein. Lesen Sie Treitschke!“
Und als schließlich auch noch der alte Grothe, der aus irgendeinem Grunde oder auch ohne Grund Demokrat war, in den Streit eingriff, der immer heftiger und persönlicher wurde, trat Elisabeth vor und sagte mit zitternder Stimme:
„Euer Vaterland, dessentwegen ihr euch so ereifert, während ihr es im Grunde eures Herzens alle gleich stark liebt, ist ein vom Haß der Feinde gequälter, an Leib und Seele gebrochener Kranker, der keinen Streit verträgt, sondern Pflege, Liebe und Ruhe braucht.“
Sie öffnete die Flügeltür und sagte:
„Kommt! Ich führe euch zu ihm.“
Sie ging voraus — verständnislos folgten die andern.
Sie ging durch ein paar Zimmer hindurch, bis zum Korridor, stieg eine Treppe hinauf, ging einen Flur entlang, öffnete eine Tür und trat in das Zimmer, in dem Reinhart lag.
Schneeweiß, mit tiefen Furchen, verwelkt, abgemagert, lag er im Bett und sah aus toten Augen erstaunt Elisabeth und die andern an.
„Was ist denn das?“ fragte Grothe entsetzt, und Elisabeth erwiderte:
„Ein Mensch!“
Nur Erich erkannte ihn und wandte sich ab.
„Seht ihn euch an!“ — drängte Elisabeth, erzählte ihnen seinen Leidensweg und sagte: „Die deutsche Schmach und das deutsche Leid, da habt ihr beides! — Und nun reicht euch die Hände! — Kein Streit mehr! Erst sorgt gemeinsam für die Erstarkung und Gesundung! — Aber nicht, indem ihr euern Haß und eure Liebe laut hinausschreit — damit verderbt ihr alles — indem ihr sie im stillen pflegt — immer daran denkt! nie davon sprecht!“
Reinhart, der — wie wohl auch die andern — nur fühlte, um was es ging, richtete sich mühsam auf und streckte den Arm aus. Und all diese Menschen, die sich eben noch befehdet hatten, traten zu ihm heran und gaben ihm schweigend die Hand.
Dann führte Elisabeth sie wieder hinaus.
Draußen sagte der alte Grothe:
„Wir alle haben jetzt nur noch einen Gedanken. Was sonst uns trennt, es sei, was es wolle, verschwindet daneben. Und daher, lieber Schäfer, nehmen Sie mein Kind und machen Sie es glücklich.“
Elisabeth strahlte, während die beiden sich in den Armen lagen.