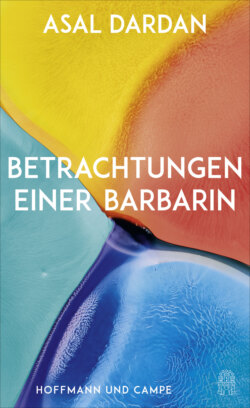Читать книгу Betrachtungen einer Barbarin - Asal Dardan - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Spitzweg
ОглавлениеWas ich habe, will ich nicht verlieren, aber
wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber
die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber
die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber
wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber
wo ich sterbe, da will ich nicht hin:
Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
Thomas Brasch
Meine Flucht ist eine Erzählung, keine Erfahrung. Ich war dabei, habe die Gesichter meiner Eltern beobachtet, die Gesichter der anderen Fluggäste, die der Grenzpolizisten. Ich habe vermutlich viel geschlafen und ein wenig gebrabbelt und geweint, dies und das wahrgenommen. Meine Eltern mussten das Land, in dem ich geboren wurde, mit einem Koffer und einem einjährigen Kind verlassen; und alles, was sie als Familie hätten sein können, hinter sich lassen. Zum Beispiel das Haus, in dem ich hätte aufwachsen können, und die Sprache, die mich geprägt hätte. Beinahe, fast. Stattdessen bleiben mir überlieferte Fragmente: das Auto meiner Eltern, das auf dem Weg zum Krankenhaus von der protestierenden Menschenmenge angehalten wurde, obwohl sich darin eine Frau in den Wehen befand. Der Chauffeur meiner Eltern, der mich wenige Stunden nach der Geburt begutachtete und meinen kleinen Fuß in den Mund nahm, um mir später einmal davon erzählen zu können. Mein Vater, der die Fassung verlor und mich beinahe fallen ließ, weil ich nicht zu schreien aufhörte, als meine Eltern sich mit mir im Haus vor den Demonstrant*innen versteckten. Die bejubelten Schritte an meinem ersten Geburtstag in einem weiß-blauen Schottenrock, den meine Tante aus Aberdeen geschickt hatte.
Meine eigene Erinnerung setzt irgendwann in der Hochhauswohnung im Kölner Stadtteil Höhenberg ein. Ich sitze alleine am Küchentisch, esse Hühnersuppe und warte auf den Weihnachtsmann. Ich ahne bereits, dass mein Vater derjenige ist, der die Geschenke unter den Baum legt, vermute aber, dass das in Absprache mit dem Weihnachtsmann geschieht. Ich will mich vorbildlich verhalten. Die Engel beobachten mich, einer fliegt sogar über den Kopf meiner Mutter hinweg durch den Türrahmen, während sie auf den Knien den Linoleumboden putzt. »Immer putzt sie, deine Mutter«, sagt mein Vater. »Dabei versteht sie nicht, dass sie so das Gift nur weiterverbreitet.« Ich glaubte ihm alles, weil er alles wusste.
Wenn ich an die Zeit in dieser Wohnung zurückdenke, dann ist meine Mutter fast unsichtbar, weil mein Vater jeden Winkel meiner Erinnerung ausfüllt. Das mütterliche Gerüst hielt alles zusammen, aber es war die väterliche Zierde, die ich bewunderte. Er brachte mir das Fahrradfahren und Schachspielen bei, er ließ mich stundenlang auf seinem Schoß sitzen, während er persische Gedichte rezitierte oder mir die Welt erklärte. Er behandelte mich wie eine kleine Freundin, deren Gesellschaft er wertschätzte. Heute denke ich, dass ich seine einzige Freundin war, und das macht mich sehr traurig. Doch nichts an dieser Zeit wirkte verdächtig oder deutete darauf hin, dass sie von einem Tag auf den anderen enden würde. Im Grunde hatte ich eine idyllische Kindheit, auch wenn die Hochhäuser von Höhenberg nicht die klassische Kulisse dafür sind. Aber ich dachte nicht viel über mein Leben nach, ich war, und bloß sein zu können kommt einer Idylle sehr nahe. Wenn man sie nicht wahrnimmt, kann Enge sehr gemütlich sein, gerade als Kind. Ich hatte die gleiche rosa Tapete mit weißen Punkten wie Ernie aus der Sesamstraße, und ich fand es aufregend, die Tüten in den Müllschlucker zu werfen und dann in den knarzenden Aufzug zu springen. Alles befand sich an seinem Platz, und mein eigener Platz befand sich im Zentrum von allem. Erst viel später machte sich bemerkbar, dass mir die materiellen und symbolischen Anhaltspunkte fehlten, um mich und meine Eltern in dieser Welt zu verorten. Inzwischen sind mir meine Eltern entwischt, und damit sind mir auch Teile meiner selbst entwischt. Man gewöhnt sich daran, dass das Leben wie ein Netz ist, etwas bleibt ja doch darin hängen. Nach dem Rest darf man nicht greifen, sonst reißen die Maschen, und dann ist alles weg.
Da meine Eltern kaum etwas aus dem Iran hatten mitnehmen können, fingen wir ohnehin mit wenig an. Es gab in unserer Wohnung keine Familienfotos und keine Erbstücke, keine alten Bücher, keine über Jahre gesammelten Gegenstände, keine Souvenirs oder Dinge, die man einfach nicht wegwirft, obwohl sie keinen Nutzen mehr haben. Es gab dort keine Erinnerungen, nur eine hatte ich selbst erschaffen, als ich mit einem Löschstift einen lächelnden Eierkopf auf unser neues braunes Ledersofa malte. Wir hatten nicht oft Gäste, aber wenn mal jemand bei uns war, gab es immer diese Geschichte zu erzählen, wie Asal direkt an dem Tag, als das Sofa geliefert wurde, ein Gesicht darauf verewigt hatte. Auf diese Geschichte war ich stolz, auch wenn ich zu dieser Zeit noch eine brave Tochter sein wollte.
An unseren Wänden hingen mehrere Drucke von Carl Spitzweg: Der Kaktusfreund, Der ewige Hochzeiter, Der Bücherwurm. Ich weiß nicht, wie sie dorthin kamen, aber ich mochte diese Bilder, ihre Beschaulichkeit und Harmlosigkeit. Sie waren, was sie zeigten. Hübsche erdfarbene Kulissen, in denen sich manierliche Menschen bewegten, die genau dort waren, wo sie hingehörten, und dennoch der Gegenwart zu entkommen schienen. Der Kaktusfreund gefiel mir ganz besonders. Er wusste, was zu tun war, welche Kleidung er zu tragen hatte, wie er sich bewegen sollte und womit er seine Zeit verbringen wollte. Er war, was er war. Ein alter Herr mit Pfeife, der in aller Ruhe im Garten inmitten seiner Pflanzentöpfe steht und eine einzelne rote Kaktusblüte inspiziert.
Damals wusste ich nicht, dass ich Spitzwegs hübsche Häuser und Straßen nicht in meiner Stadt wiederfand, weil sie in der Zwischenzeit von Bomben zerstört worden waren. Auch von Spitzwegs spöttischer Kritik am Biedermeierlichen seiner Zeit oder davon, dass er einer von Hitlers Lieblingsmalern war, hatte ich als Kind selbstverständlich keine Ahnung. Spitzwegs Bilder sind in der Tat zuweilen humorvoll, aber sogar der Humor ist durch und durch spießig, weshalb es mich nicht wundert, dass dem provinziellen Kitschkopf Hitler die überschaubaren Landschaften und die vom modernen Leben unberührten bürgerlichen Szenen gefielen. Das Absurde am Nationalsozialismus ist ja, dass er zelebrierte, was er im gleichen Zuge zerstörte, weil er alles reiner und besser zu erschaffen meinte. Doch das, was er erschuf, ist leblos und falsch, und selbst das, was gerettet wurde, kann nur noch durch einen braunen Schleier gesehen werden, als habe sich Hitler nachträglich in alles eingeschrieben, was vor ihm da war.
Wie im Fall der Bilder, die bei uns in der Wohnung hingen, mit denen ich als Kind viel anfangen konnte, weil ich eine exzellente Kleinbürgerin war. Ich sehnte mich nach Einfamilienhäusern mit großen Gärten und Garagen und Treppen, auf denen ich dann sitzen und meine Schnürsenkel zubinden würde, während mein Haustier, ein Hund oder eine Katze, um mich herumschlich. Im Villenviertel in Bensberg, wo meine späteren Schulfreundinnen lebten, sah es genauso aus, wie ich es mir vor diesen Bildern in der Kölner Wohnung sitzend immer erträumt hatte. In gewisser Weise lebten meine Schulfreundinnen im neuen Biedermeier. Die Häuser, in denen sie lebten, gehörten ihren Familien, vielleicht sogar schon seit ein oder zwei Generationen, die Großeltern wohnten in Laufweite und hatten dieselbe Schule wie ihre Enkelinnen besucht. Umzüge kamen bei ihnen gar nicht vor. Manche Mütter machten Seidenmalerei oder veranstalteten wöchentliche Scrabble-Abende im Wintergarten, die älteren Geschwister waren sehr cool, weil sie Hobbys hatten und in ihren Zimmern laute Musik hörten, überall Poster und Unordnung. Susannes Schwester etwa malte Anarchie- und Peace-Zeichen auf ihre Hände und Arme und war oft unhöflich zu ihren Eltern. Beim Rausgehen zischte sie manchmal »Is’ mir doch egal«, und ich bewunderte sie dafür. Aber noch mehr bewunderte ich ihre Mutter, die davon unberührt blieb und ihre Tochter einfach weiter zu lieben schien. »In unserer Kultur benimmt man sich nicht so«, war der Satz, der bei mir zu Hause den Zusammenbruch einleitete, jedes Mal wenn ich frech oder unhöflich war. Es war stets mehr als ein Streit, weil es gleich ans Fundament der Familie zu gehen schien und manchmal eine tagelange Erschütterung zur Folge hatte. Ich litt sehr darunter und wollte gern besser verstehen, was an mir so falsch war. Ich wusste nicht genau, worum es sich bei der besagten Kultur handelte und warum sie anders war als bei Susanne zu Hause. Wenn die Kultur, die für mich verantwortlich zu sein schien, meine Gefühle nicht guthieß, warum hatte ich sie dann?
Manchmal hoffte ich, ich könnte später Susannes Leben haben, ich wartete in gewisser Weise auf meine westdeutsche Kindheit. Ich fühlte mich behütet, das war nicht das Problem. Aber das Leben meiner Schulkameradinnen schien von offizieller Stelle abgesegnet, während ich mir vorkam, als sei ich daran vorbeigeschmuggelt worden. Die Brüche im Leben dieser Familien sah ich genauso wenig wie die Brüche in Spitzwegs Bildern. Und ich sah auch die Brüche in unserem Leben nicht, weil sie unsichtbar waren. Ich vermutete, dass das, was kaputt war, vor allem in mir kaputt sein musste, weil um mich herum alles zu funktionieren schien. Gelegentlich schlich sich eine Ahnung des Unsichtbaren in unsere Wohnung, immer dann, wenn meine Eltern iranische Musik hörten, insbesondere die Popmusik aus der Zeit vor der Revolution. Es waren Lieder, die sie vor ihrer Flucht gehört hatten – im Auto auf dem Weg zum Markt, in Restaurants und Bars, bei der Hausarbeit, bei Treffen mit Freunden und Familienmitgliedern. Diese Lieder, die westlichen Mainstream-Pop mit einem iranischen Sound verknüpften und nach der Revolution von der islamischen Führung verboten und damit also selbst ins Exil geschickt wurden, erschufen eine zweispurige Zeit. Die alte Zeit existierte neben der Zeit weiter, die wir als Familie bewohnten. Sie war nur eingefroren, nichts veränderte sich mehr. Diese Poplieder waren eine Tür, durch die meine Eltern zu dieser Parallelzeit gingen, zu dem Land, das weg war, zu den Menschen, den Gerüchen und dem Alltag, die sie vermissten. Die Kontexte waren mir unbekannt, aber die Musik pflanzte mir eine fremde Sehnsucht ein, Sehnsucht nach etwas, das nicht meins war, aber meins hätte sein können. Ich frage mich manchmal, ob ich im Iran mehr ich geworden wäre. Keine Ahnung, wer das wäre, aber die Frage deutet auf ein Verlangen nach Ungebrochenheit und Vertrautheit. Aber ich fühlte mich fremd im Leben meiner Eltern, im einzigen Leben, das ich kannte. Die Verletzungen, die man geliebten Menschen zufügt, manchmal sogar zufügen möchte, sind unvermeidlich. Aber ich zwang meine Eltern allein durch meine Abhängigkeit von ihnen und durch ihre Liebe zu mir, eine Normalität zu simulieren, die ihnen wehtun musste. Was war schon normal daran, sich von einem Tag auf den anderen neu erschaffen zu müssen?
Sie sprachen kaum über den Iran und ihr Leben vor der Flucht, aber die Musik trug ihre Heimat in unsere Wohnung. Sogar meinen Namen verdanke ich einem dieser Lieder, es beginnt mit den wuchtigen Worten »Ich komme aus der Stadt der Liebe«, als sänge ein Gesandter aus der Ferne. Für mich ging es um meine Geburtsstadt, die eine Stadt aus Legenden war. In meiner Vorstellung drängten sich bunte Autos durch die Straßen Teherans, während Menschen an Straßenecken gegen die lauten Hupgeräusche ansprachen und lebhafte Diskussionen führten. Dabei spuckten sie die Schalen der gerösteten Kürbiskerne, die sie mit den Zähnen aufknackten, auf den Boden. Alte Männer saßen herum und flochten Körbe oder schälten Orangen und Granatäpfel. Die Frauen zupften Petersilienblätter von den Stängeln, und die Mütter wickelten Schafskäse oder Datteln in Fladenbrot und stopften das Essen den spielenden Kindern in den Mund. Draußen in der Ferne lagen unendliche Felder voller roter Mohnblumen und wilder Kätzchen. Die Menschen hatten Augen und Haare und Nasen wie meine, und das Treiben hatte nur die Lebensfreude zum Ziel. Begleitet natürlich von den Stimmen der großen Stars der iranischen Popmusik aus den Siebzigern: Googoosh, Ebi und Dariush. Die Heimat, die mir vorschwebte, war ganz anders als in den Bildern von Spitzweg, sie war urban, dreckig, laut und chaotisch. Ein bisschen wie Köln, nur ohne unser Aus-der-Welt-Gefallensein.
Meine Vorstellungen vom Iran waren mit Sicherheit geprägt von den Videokassetten, die uns Verwandte aus Kalifornien schickten. Aus Tehrangeles, wie der Stadtteil genannt wird, in dem so viele Exiliraner*innen leben, wo sie einkaufen, essen und an sich selbst festhalten. Die Videokassetten zeigten alte Fernsehaufnahmen von Googoosh, die für mich zusammen mit Whitney Houston und Farah Diba zu den schönsten Frauen der Welt zählte, und von Ebi und Dariush, die wie mein Vater mandeläugige Männer mit Bart waren, die an der Welt litten und dabei überaus schön aussahen. Dariush warf ich manchmal mit Jesus zusammen, vermutlich weil beide eine verletzliche, sich einsam gegen die Welt stellende Männlichkeit vertraten. Dariush imitierte aber wohl eher James Dean, was auch den Klerikern nicht entging, die sich nach der Revolution dranmachten, alles zu verbieten, was die iranisch-islamische Kultur unterwanderte. Das bedeutete auch, dass Frauen in der Islamischen Republik nicht auftreten durften, vor allem nicht als Solosängerinnen. Ihre Stimmen sollten ungehört bleiben, ihre Körper ungesehen. Aber Musik reicht über Grenzen hinaus, irgendwo wird eine Note gespielt und gehört, selbst in den verstecktesten Winkeln. Die Welt in ihren Tönen bleibt lebendig, solange sie nur Hörer*innen findet, etwa ein kleines Mädchen in Köln.
In einem wehmütigen Lied, das ich als Kind sehr oft hörte, singt Googoosh: »Ja geh, aber egal, wo du sein wirst, egal, wo auf dieser Welt, eines Tages werde ich dich finden und dir in die Augen schauen«, und ich wusste, dass ich gemeint war, dass ich sie im Stich gelassen hatte und sie mich dennoch suchte. Um mich zurückzuholen, zurück zu mir.
Die Liedtexte waren manchmal rätselhaft, aber die Gefühle, die sie transportierten, erfüllten mich. Ich komme zu dir, komm zu mir, ich warte auf dich, warum wartest du nicht auf mich, wo wartest du, ich finde dich, denkst du an mich, ich denke an dich, mein Herz spricht, mein Herz bricht, ich liebe dich, liebst du mich, hilf mir, du, nur du. Ich phantasierte mich in diese Lieder hinein, die von der romantischen Liebe handelten, aber einem ganzen Land galten. Es war ein ideales Land, der Ort, an dem meine Eltern alles gehabt hatten und alles gewesen waren. Ihre Leben liefen, wie sie es für sich erhofft hatten, bis sie plötzlich gar nicht mehr liefen, weil sie sich in einer Hochhauswohnung im Ausland wiederfanden. Niemand wusste dort von ihnen oder hatte auf sie gewartet. Als habe eine riesige Hand sie am Kragen gepackt und quer über den Globus geschleudert. So einen Aufprall kann man überleben, aber ohne Blessuren kommt man nicht davon. Ob die Menschen, die in den Talkshows und auf den Meinungsseiten so viele Ansichten über Flucht und Migration verbreiten, ohne sie jemals selbst erlebt zu haben, manchmal eine Minute innehalten? Ob sie dann darüber nachdenken, was das für eine Zäsur ist, noch keinen Zugang zur neuen, aufgenötigten Welt zu haben, während man nicht fassen kann, dass man die alte Welt nun wirklich loslassen muss?
Was die alte Welt, nach der meine Eltern und ich uns aus unterschiedlichen Gründen sehnten, für jene Menschen war, die nicht im Sinne des Schahs gewirkt und gedacht oder in seinen Diensten gestanden hatten wie mein Vater, spielte bei uns zu Hause keine Rolle. Ich wuchs mit der Überzeugung auf, dass die Pahlavis unfehlbar und würdevoll waren, selbst noch angesichts der herben Beleidigung des Umsturzes. Ich verehrte sie, ihre Trauer schrieb sich mir ein, ich dachte sogar, ich könnte sie rächen, irgendwann, wenn ich groß wäre. Viel später erst verstand ich, dass die Stimme von Googoosh für andere Menschen kein Symbol einer idealen Vergangenheit war, hatte sie doch mehrmals für den Schah und seine Familie im Niavaran-Palast gesungen. Mich überrascht, wie sehr ich mich gegen diese Einsicht wehrte, selbst als ich schon längst verstanden hatte, dass der Schah meiner Kindheit eine Märchenfigur war. Vielleicht liegt es auch an diesem Verlust der Illusionen über die Heimat meiner Eltern, dass ich letztendlich nicht zwei, sondern gar keine Heimat habe. Das ist das Seltsame am Leben zwischen mehreren Welten, es bietet einem keine ganzen, sondern aus Phantasien und Sehnsüchten gebaute Fastorte. Orte, an denen man bleiben will, auch wenn man nie dort gewesen ist.