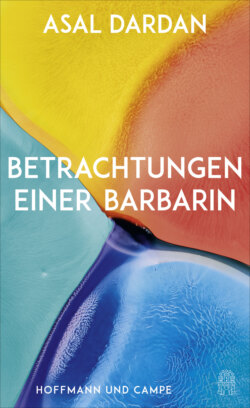Читать книгу Betrachtungen einer Barbarin - Asal Dardan - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Neue Jahre
ОглавлениеUnd nun, was sollen wir ohne Barbaren tun?
Diese Menschen waren immerhin eine Lösung.
Konstantinos P. Kavafis
Ein oder zwei Goldfische in einer leeren, offenen Glaskugel. In Deutschland gilt das heute als Tierquälerei. Fische benötigen ein Aquarium mit Filter und Heizung und Sand und Pflanzen. Ein Fischhabitat. Ein Ort, an dem sie leben können, wie es ihnen entspricht und zusteht. Ein gutes Fischleben.
Ein oder zwei mahi ghermez. Sie symbolisieren Glück und Freude und sind fester Bestandteil des persischen Neujahrsfestes Nouruz. Am dreizehnten Tag des neuen Jahres soll man sie in einem Gewässer freisetzen und damit an die Natur zurückgeben. Jedes Jahr Millionen Goldfische, im Iran und im Exil.
Unsere Goldfische sind meist vor dem dreizehnten Tag verendet. Je älter ich wurde, desto weniger traurig machte mich das. Es gehörte dazu. Anfangs habe ich ihnen noch Namen gegeben und sie beerdigt, mich noch gescheut, sie mit der Hand aus dem Wasser zu fischen. Später haben wir sie in ein Küchenpapier gewickelt und in den Müll geworfen. Irgendwann haben wir keine mehr gekauft.
Inzwischen feiere ich das Neujahrsfest nicht mehr. Höchstens ein paar schriftliche Glückwünsche an die wenigen iranischen Menschen, die ich beiläufig kenne. Meistens schreiben sie mir zuerst, ich googele dann die passenden Antworten in der Hoffnung, dass Wortwahl und Ton meiner Nachricht zum Anlass passen. Ich möchte mich nicht blamieren, nicht offenbaren.
Als Kind hörte ich irgendwann auf, Persisch zu sprechen. Nicht weil mir Deutsch lieber war, sondern weil ich merkte, dass mir die Sprache entglitt. Meine Mutter und ich waren bei einer Bekannten zum Tee eingeladen, und ihr Sohn fragte die beiden Erwachsenen, weshalb ich die Wörter so seltsam betonte. Er war jünger als ich, was es noch unangenehmer für mich machte. Ich kam mir bereits damals vor wie eine Schauspielerin, die andere imitierte. Ich hatte gehofft, man würde mir die Rolle noch ein Weilchen länger abnehmen. Das war das letzte Mal, dass ich mich an einem Gespräch auf Persisch beteiligt habe.
Es gibt Menschen in meinem Alter, die im Exil leben und sich auf Persisch unterhalten können, die Nouruz feiern und nicht jedes Mal aufs Neue vom kalendarischen Frühlingsbeginn, dem ersten Tag des Jahres, überrascht werden. Sie wissen ohne Google, welche Gerichte man für diesen Tag kocht und welche sieben Sachen traditionell auf den Neujahrstisch gehören. Ich kann mir nicht helfen, manchmal neidisch darauf zu sein.
Hin und wieder überlege ich, das Fest für meine Kinder wieder einzuführen. Sie haben ein Aquarium mit Filter und Pflanzen und Eltern, die wissen, wie man es pflegt. Sie würden die Neuzugänge lieben, die gefärbten Eier, den bunt gedeckten Tisch, die Süßigkeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass mir das Fest nicht zusteht, mir als Gast. Ein Grund, warum mir der Kontakt zu anderen Iraner*innen schwerfällt. Ich fühle mich auch unter ihnen deplatziert. Sie erinnern mich daran, was ich versäumt habe, was für mich nie selbstverständlich sein wird. Sie haben die Kollektivität oder zumindest den Zugang zu ihr bewahrt, die mir verlorengegangen ist.
Ich hätte besser aufpassen sollen, als meine Mutter die Neujahrsvorbereitungen traf. Oder als sie das mit Nüssen, Zucker und Kardamom gefüllte Gebäck machte, den Teig mit Joghurt. Als sie mit meinen Tanten Assyrisch und mit meinem Vater Persisch sprach, mir Geschichten aus der Zeit vor meiner Geburt erzählte: mein früh ergrauter Großvater, der auf einem Stuhl vor dem Haus saß und die vorbeikommenden Jungs beschimpfte: »Lasst bloß meine Töchter in Ruhe, sonst gibt’s Ärger«; die Cousine meiner Großmutter, die jeden Morgen einen Topf Bohnen für ihre Familie auf den Herd stellte, sich dann fein anzog und schminkte, um den Rest des Tages irgendwohin zu verschwinden; der gutmütige Nachbarsjunge, der immer zum Fernsehen vorbeikam und sich neben das Gerät setzte, um die Reaktionen der anderen zu beobachten. Hübsch ausgemalte Anekdoten, die sich in meiner Vorstellung nicht zu einem Ganzen zusammenfügen lassen. Wie alt wurde mein Großvater, wie hieß diese Cousine, wer war der Junge, und was wurde aus ihm? Was passierte zwischen all diesen Schnappschüssen ihres Lebens?
Vielleicht gibt es gar kein Ganzes, für niemanden, immer nur die Illusion davon. Manche können Zeit und Raum schneller mit ihrem Inneren in Einklang bringen, andere eben nicht.
Im Exil lebt Heimat nicht von selbst. Sie hat ein künstliches Herz, das jederzeit aufhören kann zu schlagen. Sobald man die Gerichte nicht mehr kocht, die Sprachen verlernt, die Geschichten nicht mehr weitergibt. Ich wusste, dass ich mich um all das bemühen musste. Ich wusste nur nicht, dass ich irgendwann allein dafür verantwortlich sein würde. Weil niemand um mich herum die Bedeutung von mahi ghermez versteht oder weiß, warum man zu Nouruz bemalte Eier und Linsensprossen im Haus haben sollte.
Ich frage mich, wie ich das Fest wohl feiern, wie ich es zu meinem Fest machen könnte. Um meine Kindheitserinnerungen besser greifen zu können, habe ich ein bisschen recherchiert und erfahren, dass Nouruz seinen Ursprung in der vorislamischen zoroastrischen Tradition hat. Es ist bis heute das wichtigste nationale Fest des Iran. Nach der Revolution wollte man es verbieten. Aber man sah schnell ein, dass das bei einer jahrhundertealten Tradition aussichtslos sein würde, also passte man es an die Ideologie des neu gegründeten Islamischen Staats an. Schon vorher hatten unterschiedliche Interpretationen existiert, weil sich die Bräuche mit der Ankunft des Islam veränderten. So gab es auch vor 1979 vor allem haft-sin: Haft bedeutet sieben, und sin steht für den Buchstaben , »s«, also wird der Neujahrstisch mit sieben Sachen gedeckt, die mit »s« beginnen. Ich bin jedoch mit haft-schin aufgewachsen, einem Tisch, der dem persischen Buchstaben , »sch«, gewidmet ist. Ein einziger Buchstabe, ein paar andere Gegenstände und doch eine völlig andere Weltsicht: Während auf dem einen Tisch scharab (Wein) und schekar (Zucker) zu finden sind, deckt man den anderen mit serkeh (Essig) und sumac (Essigbaumgewürz). Auch wenn Milch nicht problematisch ist, heißt sie nun einmal schir, weshalb man sie durch sir (Knoblauch) ersetzt hat. Und statt des aus dem 11. Jahrhundert stammenden Nationalepos Schahname (Das Buch der Könige) befindet sich auf dem haft-sin meist eine Ausgabe des Koran. In diesem Punkt ist die Symbolik wohl wichtiger als die Stringenz.
Manche Dinge aber sind geblieben, etwa die Goldfische, das Gras und die Linsensprossen. Sie alle symbolisieren jeweils etwas, das man ins neue Jahr mitnehmen soll. Was genau das ist, müsste ich ebenfalls nachschlagen, aber es werden wohl die naheliegenden Dinge sein: Gesundheit, Wohlstand, Glück. Universelle Wünsche, von denen wir immer wieder meinen, sie brauchen diese ganz bestimmten Ausdrucksformen, diese und sonst keine anderen, damit sie sich für uns erfüllen.
Es werden nicht nur Menschen, sondern auch Feste und Traditionen ins Exil geschickt. Immer dann, wenn ein Regime ein anderes ersetzt, wenn Menschen an einen anderen Ort fliehen müssen. Ich frage mich, ob ein iranisches Exil existiert und dort ein anderes Nouruz gefeiert wird als im Land. Gibt es mehr als diese Zweiteilung?
Exil ist für mich ein schwieriger Begriff, von Diaspora zu sprechen traue ich mich erst recht nicht. Diaspora klingt nach einem Ort, nach einer Gemeinschaft. Nur wo?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob diese Begriffe etwas mit mir zu tun haben. Bin ich überhaupt im Exil, wenn ich das Land, aus dem ich komme, nie gesehen habe? Habe ich meine Zugehörigkeit zur Diaspora verwirkt, wenn ich den Kontakt zu den anderen nicht pflege und die Feste nicht feiere? Was mache ich nur mit den Attributen, die mir zugeschrieben werden? Die ich mir selbst zuschreibe, aber sofort von mir weise, wenn jemand anderes von ihnen spricht?
Ich sage manchmal, ich sei »im Iran geboren« oder »Iranerin«, zögerlich und meistens aus Trotz behaupte ich, »Deutsche« zu sein, sehr selten sage ich »aus einer assyrischen Familie« oder »Deutsch-Iranerin«. Nichts davon klingt richtig, vor allem aus dem Mund anderer.
Kürzlich habe ich in einer Fotoausstellung eine Reihe iranischer Passfotos gesehen. Ich schaute mir die Gesichter an und sah Nasen wie meine, Augen wie meine, Haare wie meine. Für einen kurzen Moment konnte ich mir vorstellen, wie entspannend es sein würde, all diese Menschen zu meinem Alltag zu zählen. Ihnen auf der Straße und in Geschäften zu begegnen, im Bahnhof, im Kino, beim Einwohnermeldeamt. Ich würde nicht auffallen, ich wäre nicht anders. Man wüsste, wie mein Name ausgesprochen wird, man würde sich nicht fragen, woher ich komme. Rede ich da von Heimat? Ich hoffe nicht.
Fremdsein, Anderssein, Heimweh – ich wehre mich dagegen. Ich möchte jenen nicht recht geben, die mich als fremd und anders betrachten, weil sie mich nicht zu ihrer Heimat zählen. Das sind in gewissem Sinne ebenfalls Attribute, die eigene Herkunft überhöhen, andere aus der Heimat ausschließen. Sie gehören zu dem Land, in dem ich aufwuchs. Es kennt das Exil sehr gut, hat es zum Teil seiner Kultur gemacht.
Im Jahr 1943 beschrieb die Exilantin Hannah Arendt diesen Zustand so:
Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. […] Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle.
Arendt schrieb diese Sätze auf Englisch, nicht auf Deutsch. Sie schrieb sie, ohne zu wissen, ob sie Deutschland jemals wiedersehen würde.
Damals wurden Menschen auf eindeutigere Weise zum anderen erklärt als heute. Die Geschichten des Ausschlusses und der Verfolgung sind spezifisch, die Traumata nicht vergleichbar. Aber in einem ist der Verlust, den man Exil nennt, universell – der Goldfisch befindet sich außerhalb seines Habitats, ist zur Betrachtung ausgestellt und zugleich isoliert von allem. Exil bedeutet eine radikale Verunsicherung, nicht nur weil das Umfeld einem unvertraut ist, sondern weil man nicht weiß, wie man sich als man selbst in dem neuen Umfeld bewegen kann. Man verfügt nicht über das Wissen, die Strategien und das Selbstvertrauen, man weiß nicht, wie improvisieren – mit dem Habitat ist einem auch der Habitus abhandengekommen, zumindest seine Selbstverständlichkeit und seine Übersetzbarkeit zwischen dem Innen und dem Außen. Man ist nicht mehr das, was man geworden ist.
Ich selbst habe kein Zuhause verloren, dennoch fällt es mir schwer, mich zugehörig zu fühlen. In gewisser Weise bin ich nicht geworden. Ich konnte mich nicht festlegen, welche Kultur mich definiert, konnte noch nicht einmal definieren, was in meinem Leben welcher Kultur zugehörig ist. Kohärenz und Einklang lösen bei mir mehr Stress aus als Uneindeutigkeit und Verflechtung. Ich möchte den Druck loswerden, das alles richtig draufhaben, dem allen entsprechen zu müssen. Das gilt für die vermeintliche Leitkultur Deutschlands ebenso wie für das iranische Exilleben.
Das Neujahrsfest richtig feiern, die Gerichte richtig kochen, die Redewendungen sofort verstehen – dass mir all das nicht möglich ist, macht mein Exilgefühl aus. Und gegen dieses Gefühl gibt es kein Mittel, denn alles, was hilft, macht es zugleich schlimmer. Ich kann die Rezepte und historischen Hintergründe nachschlagen, kann den Tisch nach Anleitung decken, die Musik ausfindig machen und hören, sogar die Gedichte und Geschichten auswendig lernen. Aber wenn ich meinen Kindern von scharab und schekar und Schahname erzählte, würde ich ihre Neugierde nicht für Lebendiges in unserem Leben wecken. Ich möchte das Gefühl des Exils nicht an sie weitergeben. Aber vielleicht wird es dadurch erst recht wachsen, wer weiß das schon. Vermutlich hat mir meine Mutter die iranische Sprache, die Bräuche und Gepflogenheiten nicht aufgedrängt, weil sie mich verschonen wollte, wie ich nun meine Kinder verschonen will. Es ist gut, die Kinder sein zu lassen, würde nur die Gesellschaft das auch tun. Aber sie will Selbstauskünfte und Bekenntnisse und Definitionen und Eindeutigkeiten. Sie will, dass man passt.
Ich bin keine Iranerin, und ich bin keine Deutsche, und ich bin doch beides. Und ich werde mitnichten dem Kitsch unserer Tage nachgeben und behaupten, ich sei Europäerin. Ich empfinde Zugehörigkeit als einen Prozess und keinen Zustand, keine Frage der Loyalität zu einem Territorium, weshalb ich nie eine grundsätzliche Aussage darüber treffen kann, wohin ich gehöre.
Ich komme mir anmaßend vor, das als Schmerz zu beschreiben. Ich musste nicht von einem vertrauten Ort an einen mir unbekannten Ort ziehen. Trotzdem befinde ich mich an diesem Zwischenort, hin und her gezogen, nostalgisch in die eine Richtung und sehnsuchtsvoll in die andere Richtung blickend, gewollt und ungewollt unzugehörig.
Edward Said schrieb in seinem Essay »Reflections on Exile«, dass die existenzielle Trauer, die dem Exil zugrunde liegt, niemals überwunden werden kann. Zum Glück tappte er dabei ebenso wenig wie Hannah Arendt in die Falle, sentimental zu werden. Was soll das auch bringen, die vermeintlichen Wurzeln zu glorifizieren, bloß weil man sie verloren hat? Weder das Gefühl der Wurzellosigkeit noch der Argwohn derer, die ihre eigenen Wurzeln einzigartig finden, verschwinden davon. Man kann den Nationalismus nicht mit noch mehr Illusion bekämpfen.
Ich kann mich daran erinnern, wie ich mich mit zunehmendem Alter immer mehr darüber amüsierte, wenn eine meiner Tanten wieder einmal die assyrische Kultur als Ursprung für alles erklärte, die Badewanne, das Rad, die Keilschrift, Jesus, Andre Agassi – allesamt assyrisch. Als Kind war ich sehr beeindruckt von diesen Errungenschaften, von denen es eine direkte Verbindung zu mir zu geben schien. Damals sah ich die drei Schwestern meiner Mutter noch häufiger. Zwei lebten wenige Häuser voneinander entfernt im schottischen Aberdeen, die andere lebte in Los Angeles. Für mich war es immer magisch, sie zu besuchen, sie als real existierende, lebendige und sprechende Menschen zu erleben. Meistens flog ich in den Sommerferien ein paar Wochen alleine nach Schottland, zu Weihnachten kam meine Mutter mit. Ich sah die vier Frauen gern zusammen, sie waren wie Variationen voneinander. Zwei hatten die gleichen Hände, drei die gleichen Augenbrauen, alle vier die gleichen eher kurzen Beine. Ich beobachtete und belauschte sie dabei, wie sie gemeinsam in der Küche das Essen zubereiteten oder stundenlang Anekdoten aus der Vergangenheit austauschten, während sie geröstete Sonnenblumen- und Kürbiskerne zwischen den Zähnen knackten. Wie herbeigezaubert tauchten plötzlich diese seltsam nach Holzleim riechenden Kaugummis auf, die sie als Mädchen in Kirkuk immer gekaut hatten, gab es kiloweise Nüsse, Rosinen und die feinsten Safranfäden aus dem Iran, Videokassetten mit alten Filmen und Musikvideos. Sie alle reisten immer mit Übergepäck an, hatten viele Schätze dabei, die eigentlich unerreichbar erschienen, und saßen dann ein oder zwei Tage lang vor ihren Koffern auf dem Boden und packten diese Tüte und jene Dose aus. Endlos. Für mich war die alles beinhaltende Tasche von Mary Poppins kein großes Mysterium, ich kannte das Phänomen schon längst.
Meine Mutter und ihre Schwestern sprachen ununterbrochen über diesen gemeinsamen Ort, wo sie gelernt hatten, dieselben Gerichte zu kochen, dieselben Sprachen zu sprechen, dieselben Routinen und Vorlieben im Haushalt zu entwickeln. Ich kannte keine anderen Mütter, die ihr Obst und Gemüse desinfizierten, die Zwiebeln für ein Allheilmittel hielten, die Vorratsräume wie kleine private Supermärkte besaßen. Ich verstand kaum etwas, was sie sagten, weil sie die meiste Zeit assyrisch sprachen. Es machte mir nichts aus, mir wurde nie langweilig. Wie sie da kicherten und sich gegenseitig aufzogen, vor Lachen in Tränen ausbrachen und auch mal traurig und wütend wurden, lieferten sie mir eine genaue Vision davon, wie ich als erwachsene Frau sein würde. Doch ihr erzählter Ort wirkte nicht in dem Maße, um aus mir eine von ihnen zu machen. Ich hatte einen eigenen Ort, der mich machte und den ich zu meinem zu machen versuchte.
Später ärgerte ich mich über manche ihrer Aussagen, insbesondere wenn andere Kulturen des Diebstahls bezichtigt wurden. So hatten die Russen den Iranern den Kaviar und den Samowar gestohlen und die Türken vom Essen bis zur Poesie ohnehin alles. Heute verstehe ich, dass es dabei um eine Verteidigung des Selbst ging. Meine Tanten waren machtlos dagegen, dass man sie als fremd wahrnahm. Sie sprachen mit Akzent, sie kochten anders, sie gestikulierten viel. Sie waren recht beliebt in der Nachbarschaft, aber die Gesellschaft sprach ihnen keine Relevanz zu. Sie durften sein, gesehen wurden sie nicht. Aber immerhin hatten ihre Vorfahren etwas in die Welt gebracht, das auch hier an diesem Ort wertvoll war. Und meine Tanten hatten – losgelöst von ihren Beispielen und der Frage, ob sie der Wahrheit entsprechen – nicht unrecht: Zivilisationen, Kulturen, Nationen entstehen nicht getrennt, sie werden nur getrennt voneinander erzählt.
Nationalismus und Exil sind laut Said Gegensätze, die sich prägen und begründen. Gäbe es keine Menschen, die von dort nach hier kommen wollen oder müssen, bräuchte es die Präzisierung des Eigenen nicht. Doch man wählt weder die Nation noch das Exil. Man ist eben an einem Ort zur Welt gekommen, an dem man lernt, wie die anderen zu sprechen und zu kochen und Gesten zu interpretieren. Manchmal ist das Leben an diesem Ort nicht mehr möglich, dann muss man gehen oder fliehen und kann oft nicht mehr zurück. Nationalismen kreieren Gruppen, während das Exil eine sehr akute Erfahrung der Einsamkeit ist, weil man sich außerhalb einer Gruppe erlebt.
Die Nation hat eine Erzählung, die eine Einheit suggeriert, das Exil besteht aus zu vielen, um sie erzählen zu können. Die eine zurechtgezimmert, die anderen wie Späne auf dem Boden.
Ohne die anderen kein Wir ist eine Binsenweisheit der modernen Welt. Mit Rückgriff auf Arendt schreibt die feministische Theoretikerin Christina Thürmer-Rohr in ihrem wichtigen Essayband Fremdheiten und Freundschaften: »Ein familienanaloges Wir wirkt wie ein Schlagbaum, der die Grenzen zwischen Zugehörigen und Nichtzugehörigen markiert.« Es geht dabei um mehr als um Worte. Die Grenzen, entlang derer Zugehörigkeiten und Nichtzugehörigkeiten etabliert werden, sind nicht rein metaphysisch, sie schaffen materielle Realitäten. Sie entscheiden darüber, wessen Recht auf Unversehrtheit, auf Versorgung, Schutz und Entfaltung respektiert wird und wessen nicht. Solch ein Wir wird also schnell gewaltvoll, ganz gleich, wie schöngeistig und hochtrabend es daherkommt. Menschen finden immer wieder Gründe, Fremdes oder schlicht anderes mit Hilfe eines Wir abzulehnen und abzuwerten. Keiner dieser Gründe wirkt im großen Gefüge des Menschseins vernünftig oder legitim. Wenn es aber das menschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit gibt, kann es dann nicht ein gewaltfreies Wir geben?
Das Problem ist vielleicht die Illusion, dass Einheit möglich wäre. Wenn das Wir begriffen wird, wie es Thürmer-Rohr vorschlägt, müssten Differenz und Distanz nicht überwunden werden. Dann läge der Wert bereits in der Begegnung.
Im Grunde ist es traurig, dass meine Tanten meinten, zur Sicherheit noch ein paar kulturelle und materielle Gaben als Friedensangebot mitbringen zu müssen. In der giftigen Logik des Kampfs der Kulturen ist das Argument der Nützlichkeit sicher hilfreich, um sich gegenüber einem argwöhnischen Wir zu behaupten. Man ist ihm ausgeliefert und muss beweisen, dass man als Fremde nicht gleich Feind sein muss. Aber wenn man nur in Relation zum Anderen bestehen darf, wenn man erst die Frage beantworten muss, wie man ihm dienlich sein kann, dann bleibt die Logik des Kampfs bestehen. Man begegnet einander nicht auf Augenhöhe, man begegnet einander nicht als einzelne Menschen.
Gerade in solch einem Kampf mit dem, was man als das Andere, das Unbekannte wahrnimmt, begegnet man sich selbst – seiner Kraft und Schwäche, seiner Standhaftigkeit und Verführbarkeit, seinem Willen und seinen Grenzen. Es ist wie der Kampf, dem sich Jakob am Grenzfluss Jabbok stellen muss, kurz bevor er nach seinem zwanzigjährigen Exil nach Hause zurückkehrt. Seit meiner ersten illustrierten Kinderbibel hat mich diese Geschichte nicht mehr verlassen. Ich war als Kind sehr religiös. Ich hatte eine recht große Marienfigur auf meinem Nachttisch, die ich manchmal küsste, und ich schrieb in Poesiealben, dass Jesus mein Vorbild sei. Wie ich dazu kam, weiß ich nicht genau. Meine Mutter sprach nicht über ihren Glauben, und mein muslimisch aufgewachsener Vater machte selbst mir als Kind gegenüber keinen Hehl aus seinem Atheismus und seiner Abscheu vor allen Religionen. Vielleicht gab mir der Glaube Halt, so wie es meinen Tanten Halt gab, Jesus als Assyrer zu bezeichnen. Inzwischen habe ich den Glauben verloren, aber ich liebe noch immer die Geschichten, so wie Jakobs Kampf, und auch die ihn darstellenden Werke von Eugène Delacroix und Jacob Epstein. Beide haben ein Element des Tanzes und der Verführung. Sowohl das Gemälde von Delacroix wie auch die Skulptur von Epstein zeigen die physische Auseinandersetzung von Wille und Ausdauer, in der sich die beiden Körper gegeneinander und ineinander stemmen, über ihre Grenzen gehend nah und zugleich entzweit.
Es gibt unterschiedliche Interpretationen, wer der Fremde ist, der Jakob angreift. Es könnte sich um ein von Gott gesandtes Wesen handeln, kein wohlgesonnener Engel unserer verklärten Vorstellung, sondern eine übernatürliche, rohe Kraft. Oder vielleicht sogar Gott selbst, der Jakob bis aufs äußerste auf die Probe stellen möchte. Ich mag die psychologische Lesart, in der Jakob die ganze Nacht bis zum Sonnenaufgang mit sich selbst ringt. Er ist sein eigener Kontrahent, weshalb keiner von beiden den anderen überwältigen kann.
In dieser Nacht am Jabbok befindet Jakob sich nicht nur an der Grenze zwischen zwei Orten, sondern auch zwischen zwei Leben. Er kehrt zurück in seine Heimat, aus der er als junger Mann fliehen musste, weil er seinen Vater Isaak und seinen Zwillingsbruder Esau hintergangen hatte. Ein selbst verschuldetes Exil. Jakob weiß nicht, wie Esau ihm begegnen wird, ob er ihm den Betrug noch nachträgt oder ihm inzwischen vergeben hat. Ein Recht auf Vergebung hat er nicht, das weiß er vermutlich. Vielleicht ringt Jakob in dieser Nacht also mit seinem Gottesvertrauen, ringt damit, ob er nach dieser Nacht noch beschützt werden wird. Aber es könnte zugleich auch ein Kampf mit seinem Glauben an sich selbst, mit seinem vergangenen Ich, mit seinen Schatten und Abgründen sein. Jakob möchte in Frieden zurückkehren, muss dafür aber zuerst über sich selbst und seine vergangenen Taten hinauswachsen. Die Begegnung wird ihn verändert zurücklassen, ein bisschen demütiger und verletzt, aber vielleicht auch ein bisschen größer.
Bei Tagesanbruch segnet der Unbekannte ihn und gibt ihm den Namen Israel, macht ihn also zum Gründer einer Nation. Und sein Bruder Esau fällt ihm in die Arme, empfängt ihn offen und vergebend. Jakob und Esau hat es nicht geholfen, aus einer Familie zu stammen, Zwillingsbrüder zu sein. Sie mussten erst ihre Freundschaft zueinander finden, ihre Arme ausbreiten, um einander anzunehmen.
Mir gefällt das Bild eines Menschen, der in der Annahme, mit einem Unbekannten zu ringen, in erster Linie mit sich selbst ringt. Wovor wir Angst haben, was uns bedrohlich und überwältigend vorkommt, stellt uns vor die Frage, wie wir ihm begegnen wollen, also wer wir sein wollen in dieser Begegnung.
Ich ringe viel mit mir selbst als der Anderen. Das mag vielleicht daran liegen, dass mir die Erfahrung, mir selbst immer wieder fremd zu sein, aufgezwungen wird durch Menschen, die mich als etwas sehen, das ich nicht in mir erkenne oder schlichtweg nicht bin. Eine aufgezwungene Entfremdung und Fremdmachung, die es mir aber erlaubt, ein größeres Bewusstsein zu erlangen für die Absurdität, Menschen mit einem Blick greifen und begreifen zu wollen. Es geht nicht darum, gut zu sein, sondern besser zu handeln, was eine Menge Selbstdisziplin und Selbstreflexion erfordert. Ich erlaube mir immer seltener, ängstlich oder ablehnend zu reagieren, wenn ich auf Fremdes treffe.
Damals in Aberdeen, als meine Tanten alles ausgepackt hatten, alles gekocht und gegessen war, wenn die jüngeren Kinder im Bett lagen, saßen wir manchmal gemeinsam vor dem Fernseher und schauten The Jazz Singer mit Neil Diamond. Ich glaube, es war ein kleines Ritual. Jedenfalls heulten meine Tanten und meine Mutter, und meine Cousine und ich heulten mit. Ich kann mich heute nur noch an eine Szene des Films erinnern. Sie findet in einem Treppenhaus statt, der strenggläubige Vater der Hauptfigur Yussel schaut nach oben zu seinem Sohn und zerreißt den Kragen seines Hemdes. Es ist das Zeichen dafür, dass dieser für ihn gestorben ist. Dem Vater ist der Schmerz anzusehen, aber er kann Yussels neuen Lebensstil nicht akzeptieren, sieht darin einen Verrat an ihrem Glauben und ihrer Kultur. Da saßen also diese kurzbeinigen assyrischen Frauen und heulten wegen dieses jüdischen Sohnes, den sie alle mächtig attraktiv fanden und dem sie die Erfüllung all seiner Träume wünschten. Mit diesem Bild, das zu einer meiner liebsten Kindheitserinnerungen zählt, muss ich aber auch Widersprüche vereinbaren, wie die Aussage meiner Tante, sie hätte lieber einen toten als einen schwulen Sohn. Warum muss es diesen Drang zur Feindschaft geben? Dieses Bestreben, sich von Dingen zu trennen, die doch eindeutig zum eigenen Leben gehören? Mir fällt die bekannte Frage von C.G. Jung dazu ein, die man sich nicht nur als Individuum, sondern auch als Gesellschaft stellen kann: »Willst du gut sein oder ganz?« Das Paradoxe an diesem Ganzen ist, dass es wie ein Mobile ist – einzelne, frei schwingende und nur lose zusammenhängende Teile.
So wie sich Jakob seinem Schatten stellt, so sollten wir individuell und als Gesellschaft die Bereitschaft aufbringen, uns immer und immer wieder in den Ringkampf mit uns selbst zu begeben. Das kann nicht ordentlich und auch nicht kontrolliert verlaufen, und genau aus diesem Grund ist es ein menschenwürdiger Weg. Wir müssen uns als Einzelne erkennen und befragen, um unsere soziale, politische und materielle Verwicklung mit allem und jedem um uns herum zu verstehen. Dabei müssen wir den Ambivalenzen Raum lassen, auf persönlicher wie gesellschaftlicher Ebene. Dem einzelnen Menschen sollte die Freiheit zustehen, facettenreich, widersprüchlich und wandelbar zu sein. Und was uns als Menschen zusteht, sollte sich gesellschaftlich niederschlagen dürfen. Denn im Prozess der Ordnungsfindung laufen wir Gefahr, jenes, für das wir die Ordnung herstellen wollen, zu verlieren.
Davon handelt eines meiner liebsten Bücher, J.M. Coetzees Warten auf die Barbaren, dessen Titel sich auf Konstantinos Kavafis’ oben zitiertes Gedicht bezieht und mich wiederum zu dem Titel dieses Buchs inspirierte. In seiner Novelle beschreibt Coetzee den Moment, in dem eine Gesellschaft sich selbst verliert und zu dem wird, was sie fürchtet. Schauplatz ist eine Garnisonsstadt eines ungenannten Reichs. Es herrscht weder Krieg noch Frieden, was bedeutet, dass vor allem die Angst herrscht. Die Bewohner sind sich gewiss, dass die barbarischen Nomaden angreifen werden. Irgendwann, bald. Also entsendet die ferne Hauptstadt Offiziere in die Wüste. Sie kehren mit Gefangenen wieder, die zum Erstaunen aller gar nicht gefährlich wirken. Doch einer der Offiziere sagt: »Schmerz ist Wahrheit«, und beginnt zu foltern. Das anfängliche Mitgefühl der Bewohner ebbt ab, sie sehen keine Menschen mehr, sondern nur die potenzielle Gefahr des Fremden, des Anderen. Auch wenn die Nomaden nicht angreifen, sind die Barbaren dennoch da:
Nun vor ihren Wächtern zusammengetrieben, stehen sie in einem hoffnungslosen Grüppchen im Winkel des Hofs, Nomaden und Fischer beisammen, krank, ausgehungert, verletzt, verängstigt. Es wäre das Beste, wenn dieses dunkle Kapitel der Weltgeschichte sofort beendet würde, wenn diese hässlichen Menschen vom Angesicht der Erde beseitigt würden und wir geloben würden, einen neuen Anfang zu machen und ein Reich zu gründen, in dem es keine Ungerechtigkeit, keinen Schmerz mehr gäbe. Es würde wenig kosten, sie hinaus in die Wüste marschieren zu lassen (nachdem man ihnen zunächst eine Mahlzeit verabreicht hätte, um den Marsch zu ermöglichen), sie dazu zu bringen, mit ihrer letzten Kraft eine Grube auszuheben, groß genug, damit alle darin Platz fänden (oder die Grube sogar für sie auszuheben!), und sie dort begraben sein zu lassen für alle Ewigkeit, um dann zur ummauerten Stadt zurückzukehren voller neuer Vorhaben, neuer Vorsätze.
Im Anderen den Einzelnen sehen und in sich das Fremde – das ist eine immense Herausforderung. Ich versuche, mich ihr zu stellen, nicht immer erfolgreich, aber immer wieder, wenn mich jemand irritiert, verunsichert, herausfordert, wütend macht. Ich kenne die bebende Ohnmacht, wenn jemand plötzlich in mir eine Barbarin zu sehen scheint, wenn ich diesem Blick ausgeliefert bin, solange diese Person sich der Begegnung mit mir als Einzelne entzieht. Aber ich kenne auch den Impuls, dieser inneren Barbarisierung nachgeben zu wollen, etwas Fremdes gleich allem Hässlichen und Verzichtbaren zuzuordnen. Wenn ich mich bemühe, wenn ich dem nicht nachgebe, kann ich in einer nicht zu fassenden Gruppe – etwa Tausenden von Migrant*innen an den Außengrenzen Europas – Einzelne erahnen. Vielleicht nicht als Individuen, deren Gesichter und Stimmen und Geschichten ich kenne, von denen ich weiß, was sie kochen und wie sie sprechen. Aber als von mir losgelöste Einzelne, als Einzelne mit einem Recht auf all das, auf das ich auch ein Recht habe. Dann fällt es mir schwerer, sie in eine Grube zu imaginieren, mir einzureden, dass sie bloß verschwinden müssten, damit alles gut wird. Vielleicht feiern sie Feste, bei denen ich als Gast willkommen wäre?
In Schweden war ich eine freiwillig Ausgewanderte. Manchmal wünschte ich mir, wieder in Deutschland zu leben und meinen Kindern ein bisschen mehr von dem zu zeigen, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich feiere das iranische Neujahrsfest nicht und habe gelernt, dass das schlechte Gewissen, das mich begleitet, spezifisch für uns Migrantenkinder ist. Freund*innen, die keine Migrationsgeschichte haben, hadern kaum damit, wenn sie Familientraditionen nicht fortsetzen.
Wer weiß, wie meine Kinder es später handhaben werden. Heute lernen sie deutsche und schwedische Feiertage kennen. Ihre schwedischen Freund*innen beneiden sie um den Nikolausstiefel und den gebastelten Adventskalender, den es bei ihnen nicht gibt. Und ich habe in gewisser Weise meinen eigenen Feiertag bekommen, denn mein Geburtstag fällt auf das schwedische Luciafest am dreizehnten Tag des Dezembers. An diesem Tag gibt es mein liebstes schwedisches Gepäck, die wie ein S aussehenden und mit Safran gebackenen lussekatter. Zu entdecken, dass der Geschmack von Safran, den ich aus meiner Kindheit kenne, in Schweden ebenfalls bekannt und beliebt ist und mit diesem Tag verbunden wird, war überraschend und schön. Die historischen Details kenne ich nicht, weiß aber, dass Safran im Mittelalter mit dem Islam über Nordafrika nach Europa kam. Und ebenso wie das Gewürz, das mit diesem Tag verbunden wird, ist auch die Heilige, die ihm den Namen gibt, nicht wirklich schwedisch. Die heilige Lucia, die von der Ostküste Siziliens stammte, ähnelte wohl kaum dem geläufigen Bild der schönen, hochgewachsenen blonden Frau, mit der man heute die Lucia des Festes identifiziert. Aber ich liebe es, wenn meine Kinder in einer Reihe mit all den anderen Kindern als Lucia in einem weißen Gewand mit einem roten Band um die Hüfte oder als Pfefferkuchenmänner verkleidet das traurig-schöne Lucialied singen.
Viele glauben, es handele sich beim Luciafest um eine sehr alte Tradition. Doch es wurde erst 1927 populär, als eine schwedische Tageszeitung für eine Werbekampagne einen Wettbewerb austrug, um die schönste Lucia zu finden. Bis heute ist es etwas Besonderes, in der Kirche die Prozession anzuführen. Auch ein bisschen nervenaufreibend, weil man einen Kranz mit brennenden Kerzen auf dem Kopf trägt. Für das schwedische Selbstverständnis macht es keinen Unterschied, dass die Tradition erfunden ist, und für mich als Zugezogene auch nicht. Ich habe in Schweden etwas gefunden, das ich schön finde und das mir entspricht. Einen Tag im Jahr.