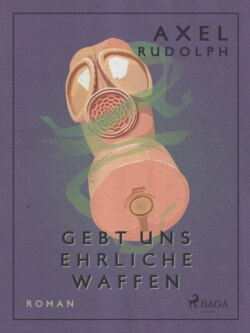Читать книгу Gebt uns ehrliche Waffen - Axel Rudolph - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеEs ist schwer zu entscheiden, ob es Janes Geburtstag ist, den Edgewood feiert, oder nur den Geburtstag der Tochter I. T. Harnishs. Jane hat Freunde um ihrer selbst willen in Edgewood. Ihr ruhig-anspruchsloses, aufrichtiges Wesen, ihre ernste Arbeit und ihr Gerechtigkeitsgefühl, das sie im Werk oft genug für einen Unterdrückten eintreten ließ, haben ihr Freunde geworben. Es gibt aber auch Leute in Edgewood, die ihr nicht grün sind. Denn Jane Harnish ist verschlossen, zurückhaltend, oft so sehr, daß es ihr als Hochmut ausgelegt wird. Eines aber ist sicher: Ganz Edgewood feiert heute den Geburtstag der Tochter des ersten Bürgers der Stadt. Gleich nach dem Lunch sind die Abordnungen anmarschiert, ein regelrechter Festzug, während noch die Autos der Gäste in langen Reihen vor der Villa Harnish anfuhren. Da sind die Abordnungen der Werksleute, Beamten und Angestellten der Fabriken. Jedes Ressort, jede Abteilung hat eine Deputation geschickt: die Direktion, die kaufmännischen Büros, die Laboratorien, die Eisengießerei, die Arbeiter, die Gasleute, die Werkpolizei und die Werkfeuerwehr. Das Offizierskorps des Gasregiments ist fast vollzählig unter den Gästen. Uniformen des Unteroffizier- und des Soldatenklubs beleben den festlich-heiteren Zug, der an der Veranda vorbeidefiliert. Fahnenabordnungen der Sportklubs von Edgewood, eine lustige Gruppe des St. Lawrence-College, dessen Protektor I. T. Harnish ist, und in dem auch Jane ihren ersten Unterricht genossen hat. In buntem Gemisch die verschiedenen Deputationen der Stadt: Vereine, Klubs, Studentenverbände, Angestellte großer Firmen und Betriebe, die indirekt abhängig sind von den Harnish-Werken. Musikbanden schmettern ihre Märsche, Fahnen und Blumengewinde wogen über dem Zug, taktfest brüllen die jungen Collegemen und -girls die ulkigsinnlosen Kampfrufe ihres Campus.
Und nicht minder bunt wogt das Getriebe oben auf der breiten Veranda, von der aus Harnish und seine Gäste dem Zug zusehen. Immer noch kommen neue Gäste, Geschäftsfreunde aus anderen Städten, Mitglieder der „Society“, offizielle und offiziöse Amtspersonen der Stadt. Immer wieder muß Jane Hände schütteln, Glückwünsche entgegennehmen, während unten ein „Hipp, hipp, hurra“ nach dem anderen aus den Reihen der Vorüberdefilierenden steigt.
Surren und Brummen schwillt in der Luft an, erfüllt fast den Äther mit gleichförmigem Dröhnen: Die Flieger der Militärstaffel von Edgewood lassen es sich nicht nehmen, bei der Feier mitzuwirken.
„Sieh nur, Jane! Die Flieger! Entzückend!“ Daisy Glenn drängt sich aufgeregt an die Seite der Freundin. Augen und Gläser richten sich aufwärts zu den Flugzeugen, die in exakter Staffelung sicher und ruhig ihre Kreise über der Villa ziehen. „Achtzehn Stück,“ konstatiert Daisy befriedigt. „Die ganze Escadre.“ Ganz schnell wirft sie einen fast ehrfurchtsvollen Blick auf den ruhig und gelassen neben seiner Tochter stehenden Harnish und neigt sich dann anerkennend zu Jane.
„Dein Vater ist ein großer Mann in den Staaten, Jane.“
„Hallo!“ jubelt an der anderen Seite die blonde Gwendolyn und schwenkt wie verrückt ein kleines Sternenbanner in der Luft, „seht doch! Sie werfen Bomben mit Blumen ab, direkt über dem Haus!“
Auch Jane schaut empor zu den Riesenvögeln, von denen sich tropfenweise kleine schwarze Punkte lösen, mit rasender Geschwindigkeit in die Tiefe sausen, zwanzig Meter über der Erde plötzlich zerplatzen und einen Regen von bunten Feldblumen über die Veranda streuen. Mitten im begeisterten Applaus der Gäste lacht Jane ein wenig gezwungen auf:
„Hoffentlich kommt keine Verwechslung vor.“ Und als Daisy Glenn sie unschuldig fragend ansieht, ergänzt sie trocken: „Mit den Bomben — mein’ ich.“
Zum Glück geht das Wort verloren im Jubel der Menschen. Nur Daisy und Harnish, die zunächst stehen, haben die Bemerkung gehört. Und nur einer — Harnish — hat den bitteren Zug gesehen, der sich dabei um Janes Mundwinkel legte.
Auch Jonny Bixton sieht die Flieger, als er von der Stadt her mit langen Schritten die Straßen zum Villenviertel hinaufsteigt. Aber er jubelt nicht. Er verschluckt so etwas wie einen ehrlichen Soldatenfluch, als er die Blumen aus der Luft herunterrieseln sieht. Kein Wunder, daß er sich in Edgewood die Beine abgelaufen hat nach einem Blumenstrauß. Alle Gärtnereien, jeder Blumenladen — ausverkauft. Nur noch halbverwelkte Schnittblumen und ein paar Töpfe, mit denen man beim besten Willen nicht in der Villa Harnish antreten kann. Die Ladeninhaber zucken bedauernd die Achseln: „Wir hatten uns eingedeckt, Sir. Aber die Waren gingen ja ab wie warme Semmeln. Geburtstag im Hause Harnish. Da ist’s kein Wunder, nicht wahr?“
Sergeant Bixton ist trotz seines Glücksgefühls nicht in rosiger Stimmung, als er die Halle der Villa betritt. Hopkins, der Butler, merkt es und setzt pflichtschuldigst gleichfalls eine sorgenvolle Miene auf. Vielleicht ist es diese Jammermiene, die Bixton auf den Gedanken bringt, dem Butler sein Leid zu klagen. „Keine Blumen!‘ Hopkins wiegt bedauernd den Kopf. „Schlimm! Sehr schlimm! Der Gentleman kann natürlich nicht ohne Blumen als Gratulant erscheinen. Aber vielleicht ...“ kein Zug verändert sich in dem alten Dienergesicht, nur ganz hinten in seinen Augen blitzt ein verschmitztes Lichtlein auf, während er sich ein wenig zu dem Gast neigt: „... vielleicht kann ich dem Herrn behilflich sein.“ Mit einer runden Handbewegung weist Hopkins auf die Körbe und Sträuße, die dichtgedrängt die halbe Halle füllen. „Go on!“ Bixton erfaßt mit einem Blick die Situation, greift aufs Geratewohl einen Orchideenstrauß aus der Menge heraus und hält ihn dem Butler unter die Nase: „Wieviel?“
Tief in Hopkins korrektem Dienerherzen tobt ein stiller Kampf. Aber auf eine so sachliche und präzise Frage gibt es nur eine Antwort.
„Zwei Dollar, Sir!“ lispelt der Butler. Den Schein, den Bixton ihm gibt, läßt er mit einer kleinen zustimmenden Verbeugung in seiner Hosentasche verschwinden. Das „Danke!“ schenkt er sich diesmal. Es ist besser, so schnell wie möglich über dieses kleine Extrageschäftchen hinwegzugehen.
Drinnen im Saal hat Dr. Westphal sich inzwischen durch die Menge der Bekannten und Mitgäste hindurch Howdoyoudo’t. Er kann zufrieden sein. Harnish behandelt ihn mit ausgesprochenem Respekt, sogar mit Auszeichnung. Er hat ihn selber einer Reihe von großen Tieren der Gesellschaft und Finanz vorgestellt und jedesmal hinzugefügt: „Der beste Mann, den die chemische Wissenschaft in Amerika hat.“ Auch die anderen behandeln ihn aufmerksam. Schließlich ist Dr. Westphal der Mann, der das neue Gas gefunden hat. Ein Millionenobjekt, sagt man. Also ein Mann, der gewissermaßen Harnish ein paar Millionen geschenkt hat, ein Mann, der Vorteile bringen kann. Das imponiert auch den Dollarmenschen, die sonst nicht viel übrig haben für einen „Man of science“ und die Wissenschaft als ein wenig fruchtbringendes Liebhabergebiet betrachten. Nun steht Westphal, von Harnish selber präsentiert, endlich vor dem Geburtstagskind und kann seinen Spruch herleiern.
„Oh, wirklich? Auch Sie?“
Es liegt fast etwas Beleidigendes in Janes Worten, und die Art, in der sie seinen Blumenstrauß nimmt, streift fast an die Grenze des konventionell Erlaubten. Westphal fühlt eine Röte des Unmuts in sein Gesicht steigen, und Harnish beeilt sich, auch hier mit Nachdruck darauf aufmerksam zu machen, daß er Mr. Westphal zu großem Dank verpflichtet sei.
Jane nickt. „Ich weiß die großen Fähigkeiten Dr. Westphals wohl zu schätzen, Vater.“ Und im Bestreben, ihre Unfreundlichkeit gutzumachen, wendet sie sich an die Freundinnen, die sie — wie Sterne die Sonne des Tages — in flimmerndem, duftigem Kranz umgeben:
„Mein Vater hat keinen besseren Mitarbeiter als Dr. Westphal.“
Gerhard horcht verwundert auf. Warum nur klingt eine unverkennbare leise Bitterkeit durch diese Worte? Aber er kommt nicht dazu, darüber nachzudenken. Jane Harnish hat Brixton bemerkt, der sich etwas verlegen an die Gruppe herangedrückt hat, seine Orchideen in der Faust. Lebhaft, angeregt winkt sie dem Sergeanten zu.
„Gestatten Sie auch mir, Miß Harnish ...“
„Oh — Jonny! Wie lieb von Ihnen!“ Kameradschaftlich, herzlich streckt Jane ihm ihre Hand entgegen. Dr. Westphal ist erledigt und tritt, aufatmend, wie nach einer überstandenen Audienz, einen Schritt zurück. Die Freundinnen sehen sich vielsagend an. Jonny? Wieso — Jonny? Ihre Neugier wird rasch gestillt, denn Harnish klopft dem jungen Mann jovial auf die Schulter:
„Darf ich Ihnen Sergeant Bixton vorstellen, liebe Daisy? Mein Kurier und außerdem ein guter Freund Janes.“
„Oh!“ Daisy Glenn macht aus Gewohnheit ihre Flirtaugen, während sie dem Sergeanten die Hand reicht. Mildred Bruce kann eine ganz kleine Spitze nicht unterdrücken:
„Ich glaube, ich habe Sie schon mal gesehen, Mr. Bixton. Fuhren Sie nicht neulich über die Strandpromenade? Am Mittwochabend, glaub ich.“
„Ja, wir fuhren an dir vorbei!“ fällt Jane gelassen ein. „Wir machten gerade unsere abendliche Spazierfahrt.“
„Oh!“ Mildres märchentief verlogene Kinderaugen sitzen auf Stielen. Ringsum stehen die Plappermäuler offen vor Erstaunen. Mr. Harnish beeilt sich, der Situation die Spitze abzubrechen:
„Mr. Bixton ist ein hervorragender Soldat, meine Damen. Hat als ganz junger Bursche am Weltkrieg teilgenommen. Dekoriert von General Pershing und Marschall Foch.“
„Indeed?“ Das Interesse der jungen Damen wird lebhaft.
„Haben Sie diese Uniform im Krieg getragen?“
„Bitte, Mr. Bixton, schreiben Sie Ihren Namen hier in mein Buch! Hier — gleich hinter Mr. Schmeling!“
„Sie müssen uns vom Krieg erzählen, Mr. Bixton. Der Krieg war so interessant!“
„Der Krieg war furchtbar.“
Hart und schwer fallen Janes Worte in das Geplätscher. Seltsam, ihre Augen suchen dabei Gerhard Westphal, der sich im Hintergrund hält. Westphal begegnet dem Blick und fühlt einen Moment lang einen kalten Schrecken. Was ist das? Was da aus Jane Harnishs Augen zu ihm hinüberströmt, das ist nicht Unfreundlichkeit oder Hochmut. Das ist Haß, eine Welt von Haß.
Aber schon geht das Geplauder weiter. „Yes, deary.“ Der Gastgeberin widerspricht man nicht, wenn sie auch noch so seltsame Ansichten äußert. Die jungen Damen pflichten eifrig bei: „Wie wahr! Er war furchtbar! Man konnte im Krieg nicht mal zur Saison nach London fahren.“
Janes Augen ziehen sich von Dr. Westphal zurück, heften sich wieder auf Bixton, der nicht recht weiß, wie er sich an dem lustig dahinhüpfenden Gespräch beteiligen soll. Ihre Hand spielt mit einer Blume.
„Sind Sie gern Soldat, Jonny?“
Bixton sieht verwundert auf. Sein „Ja“ kommt so erstaunt-selbstverständlich, so ganz ohne Pathos, daß niemand an seiner Aufrichtigkeit zweifeln kann.
Jane macht eine Bewegung, als ob sie etwas erwidern wollte, aber eine der jungen Damen kommt ihr zuvor:
„Waren die Deutschen sehr schlimm im Kriege, Mr. Bixton?“
Bixton kann ein kleines Lächeln nur mühsam unterdrücken. „Die Deutschen sind tüchtige Burschen.“ Eine Erinnerung läßt ihn auftauen und gesprächiger werden, als es sonst seine Art ist. „Ich lag bei Chateau Tierry einmal vier Stunden lang mit einem von ihnen in einem Granattrichter. Wir waren beide verwundet hineingerollt. Während das Artilleriefeuer über uns wegging, verbanden wir uns gegenseitig, so gut es gehen wollte.“
„Warum haben Sie ihn nicht getötet, Jonny?“
Maßlos verblüfft starrt Bixton die Fragerin an. Ganze vier Sekunden braucht er, um die Frage zu verdauen. Dann schüttelt er vorwurfsvoll den Kopf.
„Wir waren beide verwundet, Miß Jane. Lagen im selben Loch. Die nächste Granate, ob deutsch oder amerikanisch, konnte uns beide erledigen. Kameraden.“
„Aber doch feindliche Kameraden. Ganz ehrlich, Jonny: Als Sie da mit dem Deutschen zusammen in dem Granattrichter lagen, was haben Sie da gedacht?“
Bixton besinnt sich. „Nun, ich dachte,“ sagt er langsam, „ich dachte, daß es gut sei, einmal Atem zu schöpfen, und daß wir beide jetzt Ruhepause hätten. Ein schlechter Boxer, der den Gegner angreift, wenn der Ringrichter den Gang abgepfiffen hat.“
Harnish nickt zustimmend mit dem Kopfe:
„Fair play im rauhesten Sport. Warum nicht?“ —
„Mr. Harnish!“ Der Butler hat sich durch die Gesellschaft geschlängelt und überreicht seinem Herrn eine Karte. Harnish nimmt sie vom Tablett, wirft einen Blick darauf und zieht die Augenbrauen hoch:
„Ach, du lieber Gott! Professor Elkins, Präsident der Vereinigung der Friedensfreunde.“ Er zuckt die Achseln und wendet sich fragend an Jane: „Kann ihn nicht gut abweisen lassen.“
„Warum auch?“ Jane hatte sich in ihrem Sessel etwas aufgerichtet. „Ich freue mich, ihn kennenzulernen.“
Professor Elkins ist ein eleganter Fünfziger vom ausgesprochenen Typ des amerikanischen Salon-Gelehrten. Ein Paar gute, etwas kurzsichtige Augen versöhnen mit seiner für einen Mann der Wissenschaft reichlich auffallenden Eleganz. Alles in allem: ein interessanter Mann, dem man seine Erfolge in der älteren Damenwelt der Society ohne weiteres glaubt. Für die Freundinnen Janes ist Professor Elkins eine kleine Sensation, denn bei seinem Erscheinen ist die von Daisy aufgeworfene Frage, ob die „Friedensfreunde“ eine neue Kirche sind oder nur eine alte republikanische Gesellschaft aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, noch nicht voll geklärt, der Professor also jedenfalls noch von einem mystischen Halbdunkel umgeben. Und nichts reizt die im hellsten Sonnenlicht lebende Lady so sehr wie das Dämmerdunkel.
Auf die Vorstellung Harnishs macht Professor Elkins eine tiefe Verbeugung vor Jane:
„Miß Harnish? Dann kommt mein Dank gleich an die richtige Adresse.“ Jane winkt ab: „Erwähnen Sie es nicht, Herr Professor!“ Aber niemand kann Professor Elkins am Reden hindern, wenn er reden will. Und so erfährt Harnish zu seinem Erstaunen, daß Professor Elkins gestern für die „Vereinigung der Friedensfreunde“ einen von Miß Harnish unterschriebenen Scheck über 2000 Dollar erhalten hat, einen Scheck, der, wie Professor Elkins mit Nachdruck erklärt, anstandslos von der Bank honoriert wurde. Auch die Freundinnen sehen Jane erstaunt an, wenngleich aus einem anderen Grunde als Harnish. Nur zweitausend Dollar? Ist das nicht etwas wenig für Jane Harnish, die das Recht hat, jede beliebige Zahl auf die Blankoschecks ihres Vaters zu setzen? Woher soll man auch wissen, daß diese 2000 Dollar nichts zu tun haben mit den Schecks I. T. Harnishs, sondern einen guten Teil der Jahresgage darstellen, die Jane als Chemikerin des Werkes bezieht?
„Sie werden mein Erstaunen, mein freudiges Erstaunen begreifen, Mr. Harnish,“ fährt der Professor fort, „grade aus Ihrem Hause eine derartige Spende zu erhalten.“ Und etwas pathetisch fügt er hinzu: „Uns trennen ja schließlich Welten!“
Harnish zieht die Brauen hoch. „Wieso?“
In Professor Elkins’ Gesicht kommt jener kleine spitzfindig-ironische Zug, der ihn zum gefürchteten Diskussionsredner in den Versammlungen macht:
„Wir bekämpfen die Waffen — Sie produzieren sie.“
Harnish nickt gelassen. „Yes. Noch mehr Waffen. Noch viel mehr Waffen. Granaten, Maschinengewehre, Tanks, Gase. Muß so sein.“ Seine Stimme bekommt einen warmen, fast herzlichen Klang. „Ich habe heute das erstemal das Vergnügen, Sie zu sehen, Professor Elkins, und von Janes Spende wußte ich nichts. Aber ich billige sie. Durchaus. Sie ist mir sogar lieb. Nur in der Zahl hat sie sich wohl vergriffen. Ich werde Ihnen morgen einen Scheck über 20 000 Dollar zugehen lassen. Und die Damen ...“ Harnish macht eine runde Handbewegung zu den neugierig lauschenden Ladies hin, „... ich bin überzeugt, die Damen werden sich ebenfalls gern an der Spende beteiligen.“
„Sicherlich!“ — „Schreiben Sie mir Ihre Adresse auf, Herr Professor!“ — „Ich werde meinen Vater bitten, so zu tun, wie Mr. Harnish.“ —
Professor Elkins verbeugt sich dankend nach allen Seiten. Etwas betreten, mit leicht zusammengekniffenen Augen. Harnish lächelt dünn.
„Sie fürchten, lieber Professor, daß Sie eine Geldspende von mir, dem Rüstungsfabrikanten, kompromittieren könnte?“
Elkins fährt sich mit dem Taschentuch leicht über die Stirn. „Ganz kraß gesagt, ja, Mr. Harnish. Indessen ... ich gestehe wirklich ...“
Harnishs breite, siegelringgeschmückte Hand legt sich wohlwollend auf die Schulter des Professors:
„Sie wollen doch den Frieden?“
Professor Elkins schaut auf. Seine Unsicherheit ist wie weggeblasen. In seine Augen kommt ein warmes, gutes Licht:
„Im Namen der Menschheit — ja!“
„Na, sehen Sie!“ Harnish nickt befriedigt. „Da stimmen wir schon überein. Wir wollen auch den Frieden. Darum produzieren wir Waffen. Jawohl! Reden Sie nicht, lieber Professor, sondern hören Sie mal ganz ruhig zu! Es gibt immer Verbrecher unter den Menschen, böse Elemente. Gegen die kleinen, die höchstens eine Gangsterbande hinter sich haben, genügt die Polizei, die Sie doch gewiß bejahen werden. Gegen die großen aber, die ganze Völker aufhetzen, müssen wir eine Wehrmacht haben, eine starke Macht, mit allen Kampfmitteln, die diese Gegner des Friedens selber besitzen. Unsere Wehrmacht soll in erster Linie groß genug sein, um unsere Küsten zu schützen. Wir wollen aber darüber hinaus Polizei sein, wollen die üblen Elemente der ganzen Welt zwingen, ihre verbrecherischen Gelüste zu unterdrücken. Auf daß endlich einmal Ruhe wird in der Welt!“
Es ist still geworden in dem kleinen Kreis in der Palmennische des Wintergartens. Harnish hat nicht laut gesprochen, eher leise. Aber in seiner Stimme hat eine so grollende, stahlharte Eindringlichkeit gelegen, daß selbst die Mündchen der Marzipanprinzeßchen ringsum verstummt sind.
Zum zweiten Male fährt Professor Elkins sich mit seinem Seidentuch nervös über die Stirn:
„In der Tat ... Mr. Harnish ... ich bin nicht ganz einig mit Ihnen ... immerhin, ich muß gestehen, daß Ihre Auffassung ein ganz neues Licht auf manche Probleme wirft und daß ich ...“ er atmet hörbar auf und fährt dann rasch fort ... „... erst jetzt mich ganz berechtigt fühle, die hochherzige Spende Miß Harnishs im Namen der Vereinigung der Friedensfreunde dankbar anzunehmen. Vielleicht ... vielleicht geben Sie mir eine Möglichkeit, einmal die angeschnittenen Probleme ausführlich mit Ihnen zu erörtern. Hier würde es ...“ mit einer vollendeten Verbeugung gegen die Damen ... „gewiß die Ladies allzu sehr langweilen.“
Harnish nickt freundlich. „Jederzeit, lieber Professor! Senden Sie mir nur vorher eine Zeile.“ Ein kurzer Händedruck der beiden Männer, während Harnish gleichzeitig einen fragenden Blick des bereits seit einigen Minuten erwartungsvoll herüberschauenden Butlers mit einem Kopfnicken beantwortet. Hopkins, der Butler, wendet sich um und hebt die Hand. In der nächsten Sekunde beginnt die auf der Estrade halb hinter Blattpflanzen verborgene Musikkapelle den ersten Tango zu intonieren. Das schwirrende Geplauder im Saal verstummt. Die Gruppen lösen sich auf in Paare. Zehn, zwölf Gentlemen stürzen beflissen auf Jane Harnish zu. Aber Jane kommt allen zuvor. Sie ist aufgestanden und hat wie etwas Selbstverständliches Bixtons Arm genommen. Krebsrot vor Stolz, von fragend verwunderten Blicken und erregtem Tuscheln gefolgt, führt Jonny Bixton die Tochter I. T. Harnishs zum Tanz.
Nachdenklich sieht Gerhard Westphal der Tanzenden nach. Zum ersten Male seit langer Zeit beschäftigt ein Problem sein Gehirn, das nicht mit chemischen Formeln zu lösen ist.