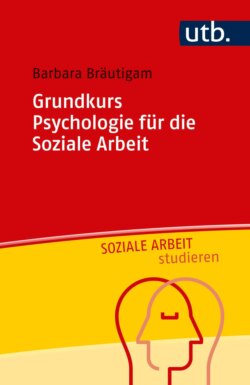Читать книгу Grundkurs Psychologie für die Soziale Arbeit - Barbara Bräutigam - Страница 9
Оглавление2 Entwicklungspsychologie
Das Fachgebiet der Entwicklungspsychologie beschäftigt sich mit den Veränderungen und stabilen Faktoren menschlichen Erlebens und Verhaltens. Die Vorstellungen davon, wie Entwicklung sich zeigt und durch was sie verursacht wird, haben sich im 20. Jahrhundert stark verändert. Die moderne Entwicklungspsychologie betrachtet Entwicklung über die gesamte Lebensspanne, betont die Variabilität in Entwicklungsverläufen und versteht Entwicklung als kontextabhängig. Im Fokus dieses Kapitels steht zum einen die Betrachtung der unterschiedlichen Lebensalter. Hierzu zählen Entwicklungsfaktoren und Risiken in der Schwangerschaft, die frühe Entwicklung kognitiver, emotionaler und selbstregulatorischer Prozesse. Weiterhin werden die vielfältigen Transformationsprozesse im Jugendalter sowie die entwicklungsbezogenen Herausforderungen im mittleren und höheren Erwachsenenalter beschrieben. Zum anderen wird der Blick auf verschiedene Aspekte der sozioemotionalen Entwicklung gelenkt sowie auf die unterschiedlichen Kontexte und Rahmenbedingungen, die sich förderlich – oder eben auch nicht – auf die individuelle Entwicklung auswirken. Dazu zählt die Bindungsentwicklung, die die angeborene soziale Motivation beschreibt, nahe Beziehungen einzugehen sowie die Entwicklung von Mentalisierung und Empathie.
„Entwicklungspsychologen versuchen herauszufinden, wie Menschen sich unter verschiedenen Rahmenbedingungen entwickeln. Sie beachten dabei verschiedene Dimensionen, z.B. die kognitive, emotionale oder soziale Entwicklung. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei, möglichst allgemeine Entwicklungsgesetze zu entdecken und die unterschiedlichen Bedingungen für gelingende Entwicklungsverläufe zu erfassen“ (Wälte et al. 2011, 15).
Ganz allgemein kann man sagen, dass sich Entwicklungspsychologie mit Veränderungen und Stabilitäten des menschlichen Erlebens und Verhaltens beschäftigt. Dabei betrachtet sie die innerhalb eines Individuums ablaufende Entwicklung (intraindividuell) und die Entwicklung mehrerer Menschen im Vergleich (interindividuell). Anhand des folgenden Fallbeispiels sollen die Nützlichkeit und Notwendigkeit entwicklungspsychologischer Kenntnisse in der Praxis der Sozialen Arbeit dargestellt werden:
Im Rahmen einer Supervision stellt eine Sozialarbeiterin den Fall der 4-jährigen Lisa dar, die sich in ihrer Kindergartengruppe auffällig verhält, indem sie sich sehr zurückgezogen zeigt, sich kaum verbal äußert und sich von der Erzieherin nur schwer in das Gruppengeschehen integrieren lässt. Die Sozialarbeiterin hat nun die Aufgabe, Lisa in ihren sozialen Kompetenzen zu fördern. Aus der Vorgeschichte des Mädchens wird deutlich, dass es in der 25. Schwangerschaftswoche als sehr frühe Frühgeburt zur Welt kam und beide Eltern drogenabhängig waren. Die leibliche Mutter, die zum Zeitpunkt der Geburt noch minderjährig war, brachte den drei Monate alten Säugling zu ihrer Mutter, die sich seitdem um das Kind kümmert. Lisa erhielt Physio-, Ergo- und Logopädie und wird von beiden Großeltern liebevoll und innig betreut, wobei beide selbst sozial sehr zurückgezogen leben und andere Menschen so gut wie nie zu Besuch kommen. In der Videoaufnahme einer Spielsituation eines Regelspiels, die die Sozialarbeiterin mit in die Supervision bringt, wird deutlich, dass Lisa ihrer Spielkameradin im Zählen und auch im Begreifen des Spielverlaufs kognitiv weit überlegen ist, das andere Mädchen aber hohe soziale und verbale Kompetenzen zeigt, in dem es z.B. laut überlegt, wie es jetzt wohl weiterspielen könne, und Lisa auch um Hilfe bittet.
Um Lisa unterstützen zu können, muss die Sozialarbeiterin u.a. die besonderen Entwicklungsbedingungen, die Lisa geprägt haben, verstehen und einordnen können. Auf welchem Entwicklungsstand ist Lisa, und wie stellt sich dieser im Vergleich zu anderen Kindern dar?
Im Falle von Lisa sind relevante Rahmenbedingungen z.B. ihre frühe Geburt in der 25. Schwangerschaftswoche und der Drogenkonsum ihrer leiblichen Mutter einerseits und die sehr gute und stabile Bindung an die Großmutter sowie die diversen Förderungen durch Physio-, Ergo- und Logopädie andererseits. Lisa entwickelt sich in den einzelnen Funktionsbereichen (sozial, kognitiv, emotional, motorisch) unterschiedlich; so ist sie kognitiv ihrer Spielkameradin überlegen, im sozialen Bereich hingegen hat sie noch Nachholbedarf. Warum diese Aspekte aus entwicklungspsychologischer Perspektive relevant sind und warum die Fachkraft aus der Sozialen Arbeit sie benötigt, um Lisa und ihre Familie adäquat in ihrem Umfeld unterstützen zu können, wird in den folgenden Kapiteln deutlich.
2.1 Entwicklungspsychologie in der Sozialen Arbeit
Entwicklungspsychologische Kenntnisse sind im Feld der Sozialen Arbeit vor allem aus zwei Gründen hoch relevant. Der erste Grund bezieht sich auf die lebensalterbezogenen Bedürfnisse und auf anstehende Entwicklungsaufgaben. Der Psychoanalytiker Erik Erikson (1902–1994) entwarf ein Stufenmodell psychosozialer Entwicklung (Erikson 1988), bei dem er jedem Lebensalter bestimmte Themen zuordnete, die im Spannungsfeld zwischen individuellen Bedürfnissen und den umweltbedingten Anforderungen entstehen. Im ersten Lebensjahr manifestiert sich dieses Spannungsfeld beispielsweise zwischen Ur Vertrauen vs. Ur Misstrauen, d.h., in dieser Phase entscheidet sich, ob das Kind von seiner Umwelt so getragen und versorgt wird, dass es ein grundsätzliches Vertrauen in menschliche Beziehungen entwickeln kann. Auch wenn die von Erikson beschriebenen Stadien auf Grund der heutigen Diversität von Biographien mittlerweile sehr normativ erscheinen, sind viele der genannten Spannungsfelder nach wie vor aktuell und werden von aktuellen bindungstheoretischen Befunden (s. Kapitel 2.3) gestütztss.
Das Konzept der Entwicklungsaufgaben wurde erstmals von Robert J. Havighurst (1948/1982) beschrieben und betrachtet das Leben unter dem Fokus einer Abfolge von zu bewältigenden Anforderungen. Anstehende Entwicklungsaufgaben werden im Wechselspiel zwischen äußeren bzw. inneren Anforderungen von Kindern und Jugendlichen je nach der physischen Reife, des kulturellen Drucks und individueller Zielsetzungen und Werte gelöst (Petermann et al. 2004, Resch 1999). Das erfordert die Fähigkeit zur Selbstregulation, d.h., Kinder und Jugendliche müssen sich angesichts der Konfrontation mit den unterschiedlichen Anforderungen immer wieder mit bestimmten Gefühlen – z.B. Überforderungsgefühle,Ängste – auseinandersetzen und dennoch handlungsfähig bleiben.
Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch bei der Arbeit mit älteren Menschen sind also bestimmte von den Klienten zu leistende Entwicklungsaufgaben zu berücksichtigen. Bei kleineren Kindern, wie bei Lisa, zählt die Integration in die Kindergartengruppe dazu, bei Schulkindern der regelmäßige Schulbesuch und eine Konzentrationsleistung über 45 Minuten und bei Jugendlichen eine zunehmende Verselbständigung. In der Phase der Adoleszenz vollziehen sich komplexe körperliche, geistige und seelische Veränderungen, die einen Übergang zum Erwachsenwerden markieren (Fend 2013). Dazu zählen neben Ablösung und dem Eingehen neuer Bindungsbeziehungen u.a. auch die Aufgaben von Bildungsnotwendigkeit und Qualifikation, die Entwicklung einer Zukunftsperspektive, von Verantwortlichkeit, von Partizipation, sprich der Ausbildung eines ethischen und politischen Bewusstseins (Albert et al. 2010, Resch/Lehmkuhl 2015). Bei älteren Menschen zählt die Auseinandersetzung mit dem drohenden oder bereits erfolgten Verlust bestimmter Fähigkeiten zu den zentralen Herausforderungen (Lindenberger 2012); darüber hinaus kann aber auch die Ausbildung von Generativität eine wichtige Entwicklungsaufgabe in diesem Lebensabschnitt darstellen:
„Gemeint ist die aktive Sorge um die nachfolgende Generation mit der angestrebten Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und Chancen. Dies beinhaltet die Fähigkeit, von sich selbst absehen zu können, für andere da zu sein und das erworbene Wissen und die Erfahrungen in eine Art ‚Weltverbesserung‘ einzubringen“ (Rass 2011, 156)
Diverse biologisch, psychologisch oder sozial bedingte Gründe können dazu führen, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Diese Schwierigkeiten bestimmen zu einem nicht geringen Anteil den Unterstützungsbedarf durch Fachkräfte der Sozialen Arbeit. Störungen in der Entwicklung oder auch manifeste psychische Störungen können insbesondere bei Kindern und Jugendlichen oftmals als Ausdruck von Überforderung verstanden werden, wenn die erforderliche Selbstregulation unter komplizierten und vielschichtigen inneren und äußeren Umständen nicht mehr symptomfrei geleistet werden kann (Resch 1999, Metzmacher 2004).
„Aus dem Blickwinkel der Entwicklungspsychopathologie liegt der Schlüssel für das Verständnis einer gegebenen Störung darin, sie vor dem Hintergrund der wesentlichen Themen derjenigen Entwicklungsperiode, in der sie auftritt, zu betrachten, und nach misslungenen Anpassungsversuchen die wesentlichen Themen dieser und/oder früherer Entwicklungsperioden zu suchen“(Marvin 2003, 111f.).
Störungen können somit auch als „kompetente Lösungsversuche“ (Marvin 2003) angesehen werden, um sehr ungünstige Umweltbedingungen individuell zu kompensieren. Bei Lisa kann ihre soziale Zurückgezogenheit z.B. als Versuch angesehen werden, sich selbst am besten zu schützen; auch diese Komponente sollte bei der Auswahl möglicher Hilfen berücksichtigt werden.
Der zweite Grund, warum entwicklungspsychologische Kenntnisse für Fachkräfte der Sozialen Arbeit wichtig sind, besteht in der Fähigkeit zur Differenzierung zwischen entwicklungsangemessenen bzw. erwartbaren Verhaltensweisen und überfordernden bzw. unterfordernden Ansprüchen an die jeweiligen Menschen. Die Erwartung von Eltern, dass ihr drei Monate altes Kind durchschläft, ist zwar ausgesprochen verständlich, aber aus entwicklungspsychologischer Perspektive nicht angemessen. Gleichzeitig kann einem 12-jährigen Kind in der Regel zugemutet werden, allein zur Schule zu gehen und nicht von seinen Eltern ständig begleitet zu werden. Entwicklungspsychologie bietet somit eine normative Orientierungsfolie, auch wenn diese, wie in Lisas Fall, durchaus kritisch zu hinterfragen ist. Auf Grund von Lisas biologischer Vorgeschichte ist z.B. nicht zu erwarten, dass sie mit vier Jahren bereits in allen „Funktionsbereichen“ altersentsprechend entwickelt ist.
2.2 Der Entwicklungsbegriff und Entwicklungsmodelle
„Es kann schon nicht alles so bleiben
Hier unter dem wechselnden Mond
Es blüht eine Zeit und verwelket
Was mit uns die Erde bewohnt […]“ (August von Kotzebue, 1802).
Vereinfacht könnte man sagen, dass Entwicklung Veränderung über die Zeit bedeutet. Die meisten EntwicklungspsychologInnen gehen allerdings davon aus, dass es sich dabei um Veränderungen handelt, die lebensalterbezogen, langfristig und geordnet verlaufen (Ulich 2005). Nach dieser Auffassung wäre also eine kurzfristige Veränderung des Gemütszustandes, wie z.B. eine depressive Episode, keine Entwicklung. Hingegen ist eine fortschreitende Erkrankung im höheren Lebensalter, wie z.B. Demenz, durchaus als Entwicklung zu verstehen.
Ein erweiterter Entwicklungsbegriff beinhaltet alle längerfristig wirksamen Veränderungen von Kompetenzen, also alle bleibenden sowie kurzzeitigen Veränderungen, die weitere Veränderungen nach sich ziehen (Flammer/Alsaker 2002).
Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen und Ideen davon, wie Entwicklung von statten geht. Dies wird beispielhaft deutlich an unterschiedlichen Vorstellungen von Kindheit und des angemessenen Umgangs mit Kindern (Ariès 1975; deMause 1989; Dornes 2012). Philipp Ariès zeichnet in seinem berühmten Buch „Geschichte der Kindheit“ (1975) den Wandel des Kindheitsbegriffs nach und macht die Relativität und die historische Eingebundenheit des Begriffs der Kindheit, so wie wir ihn heute verstehen, deutlich. Nach dem Historiker Lloyd deMause (1989) ist das Verständnis von Kindheit und den Bedürfnissen von Kindern bis ins 20. Jahrhundert zum einen als eine Art Abnahme eines Alptraums zu verstehen. Dieser reichte von systematischen Kindermorden in der Antike (Herodes) über die in manchen Ländern bis heute bestehende gnadenlose Ausbeutung von Kindern als Arbeitskraft bis hin zur gesetzlichen Ächtung von Gewalt in der Erziehung in Deutschland im Jahre 2000 der Erziehung. Zum anderen weist Martin Dornes (2012) darauf hin, dass Kinder zwar zum einen kontinuierlich mehr Rechte erhielten, aber dafür umso mehr an Freiheiten einbüßten.
Im 17. und 18. Jahrhundert herrschte die Vorstellung vor, dass das Kind ein kleiner Erwachsener sei und keiner spezifischen Lebensräume bedürfe. Eine andere Idee, die vor allem in der christlichen Religion wurzelte, implizierte, dass Kinder eher einen schlechten Kern haben und vor allem bestraft werden müssen – hier spricht man von dem sogenannten „Erbsündemodell“. Jean Jacques Rosseau, einer der wichtigsten Philosophen und Pädagogen der Aufklärung (1712–1778), vertrat hingegen die Auffassung, dass der Mensch und somit auch das Kind von Natur aus gut sei, und im Wesentlichen vor äußeren und somit auch vor erzieherischen Einflüssen geschützt werden müsse. Heute herrscht in der westlichen Welt in der Regel das Bild vom Kind als einer aktiv handelnden Persönlichkeit, das in seiner Kompetenzentwicklung umfassend gefördert und begleitet werden sollte (Hédervári-Heller 2011).
Eine Kernfrage aller Entwicklungsmodelle beschäftigte sich damit, ob die Entwicklung von inneren oder äußeren Kräften gelenkt wird. Auch in der Sozialen Arbeit ist diese Frage immer dann von Bedeutsamkeit, wenn es um die Möglichkeiten von äußerer Einflussnahme bzw. Hilfe und Unterstützung von verschiedenen Zielgruppen geht. Historisch bedeutsam sind dabei zwei entgegengesetzte Modelle: das endogenistische und das exogenistische Entwicklungsmodell. Beide Modelle wurden Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vertreten und prägten die damaligen Vorstellungen von Entwicklungspsychologie.
Das endogenistische Entwicklungsmodell stellte Entwicklung phasenhaft in mehreren irreversiblen Schritten ablaufend dar, an deren Ende ein abgeschlossener Reifezustand vorlag. Die einzelnen Phasen wurden im Kindesalter bildhaft benannt – der Greifling, der Läufling, das Schimpansenalter, das Alter der Namensfragen/ Warumfragen, das Märchenalter, die Schulreife. Teile dieser mittlerweile in seiner Absolutheit überholten Vorstellung finden sich nach wie vor in verschiedenen pädagogischen Konzepten, so z.B. in der Waldorfpädagogik oder auch übergreifend in der Feststellung der Schulreife.
Das exogenistische, auch als Tabula-Rasa-Modell bezeichnete Modell, findet seine Wurzeln vor allem im Behaviourismus (s. Kapitel 3.6.2 und 6.5). Es geht davon aus, dass Kinder ohne jegliche Anlagen auf die Welt kommen und durch Erziehung in jede beliebige Richtung geformt werden können. Nach dieser Vorstellung gibt es keine festgelegten Abläufe, sondern Entwicklung wird als Lernfortschritt betrachtet – Dinge können beliebig gelernt oder auch wieder verlernt werden. Auch dieses Modell ist mittlerweile in seinem Absolutheitsanspruch überholt (Wicki 2015). Teile davon finden sich aber noch immer in eher verhaltensorientierten Konzepten von Heimeinrichtungen oder Jugendwohngruppen, die vor allem mit Lob und Strafe in sogenannten Verstärkerprogrammen (s. Kapitel 3.6.3) arbeiten.
Insgesamt werden beide Entwicklungsmodelle – das endogenistische und das exogenistische – mittlerweile als zu universalistisch beurteilt, weil sie z.B. zu wenig kulturelle und individuelle Unterschiede berücksichtigen. Zudem konzentrierten sich beide Entwicklungsmodelle sehr auf die Kindheit und Jugend und beinhalten tendenziell starre und normative Vorstellungen von Entwicklungsverläufen (Montada et al. 2012).
Die moderne Entwicklungspsychologie betrachtet Entwicklung über die gesamte Lebensspanne und bezieht differentielle Entwicklungen ein. Zudem wird Entwicklung in viel stärkerem Maße kontextabhängig und als von den sozialen Versorgungssystemen abhängig verstanden. So weiß man beispielsweise, dass Armut ein wesentliches Entwicklungsrisiko darstellt (Weiß 2010).
„Die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne hat eine Erkenntnis in aller Schärfe deutlich gemacht: Die differenziellen Unterschiede im Lebenslauf beziehen sich nicht nur auf die Variabilität zwischen Kulturen, Subkulturen oder sozialen Gruppen, sondern auch auf die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Generationen. Sexualität beispielsweise ist heutzutage von einem Jugendlichen in anderer Weise zu bewältigen als früher, ebenso wie etwa das Altern heute andere Anforderungen an die Menschen stellt als an Angehörige früherer Generationen. Von Generation zu Generation sind nur beschränkte Schlussfolgerungen möglich. So wird Entwicklungspsychologie auch immer eine ‚unendliche Geschichte‘ sein“ (Langfeldt/Nothdurft 2015, 73).
Ein aktuelles und für die Soziale Arbeit anschlussfähiges Entwicklungsmodell ist das biopsychosoziale Entwicklungsmodell (Fröhlich Gildhoff 2013). Die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und aktuellen Anforderungen ist demzufolge abhängig von
biologischen Bedingungen (Genen, Temperament, Schwangerschaft, Geburtsumständen),
psychischen Strukturen (Emotions- und Reizregulation) und
sozialen Umständen (Bindungserfahrungen etc.).
Im Falle von Lisa wäre also ihre Entwicklung maßgeblich von dem Drogenkonsum ihrer Mutter während der Schwangerschaft und ihrer Frühgeburt (biologische Bedingungen), ihrer guten Emotionsregulation (psychische Strukturen) sowie vom Abbruch der Mutter-Kind-Beziehung einerseits und der verlässlichen sowie warmherzigen Beziehung zu den sozial zurückgezogen lebenden Großeltern andererseits (soziale Umstände) geprägt.
In diesem Modell wird der Mensch als erkennender und potenziell reflektierender Mitgestalter seiner Entwicklung angesehen, der sich ein Bild von sich selbst und seiner Umwelt macht und bei neuen Erfahrungen modifiziert. Dabei wird nicht nur dem Entwicklungssubjekt, sondern auch den Entwicklungskontexten und den in diesen agierenden Menschen gestaltender Einfluss auf die Entwicklung zugeschrieben.
2.3 Bindung
Das Konstrukt der Bindung soll aus folgenden Gründen unter der entwicklungspsychologischen Perspektive einigermaßen gründlich erläutert werden: Ein Großteil Sozialer Arbeit manifestiert sich in psychosozialen Hilfeprozessen, die von Beziehungen getragen sind. Dabei
„[…] lässt sich für das Gelingen eines psychosozialen Hilfeprozesses eine authentische, emotional tragfähige, persönlich geprägte und dennoch reflexiv und fachlich durchdrungene Beziehungsgestaltung herauskristallisieren, die sich inmitten des Lebensalltags der AdressatInnen entfaltet“ (Gahleitner 2017, 234).
Bei dieser professionellen Beziehungsgestaltung mit KlientInnen sind SozialarbeiterInnen in der Regel permanent mit zwei Bindungssystemen konfrontiert: mit ihrem eigenen und mit dem ihrer KlientInnen. Das Bindungssystem meint die angeborene Motivation, in bedrohlich erlebten Situationen, die Nähe oder den Schutz einer vertrauten Person aufzusuchen.
Aber was bedeutet Bindung überhaupt?
2.3.1 Der Bindungsbegriff
Bindung beschreibt die angeborene soziale Motivation, Beziehungen zu anderen emotional nahe stehenden Menschen einzugehen (Bowlby 1969, Bischof 1989). Im Englischen wird zwischen „bonding“ (emotionale Bindung der Eltern an das Kind) und „attachment“ (emotionale Bindung des Kindes an seine Bezugsperson) differenziert. Das Bonding wird hormonell vorbereitet und zeitbegrenzt in den ersten Minuten nach der Geburt ausgelöst; dieses ist eine sensible Phase für den Prägungsvorgang und der Grund dafür, dass heutzutage in den meisten deutschen Krankenhäusern viel Wert darauf gelegt wird, den Kontakt zwischen Mutter und Kind unmittelbar nach der Geburt möglichst wenig zu stören.
Das Bedürfnis nach Bindung ist komplementär zu dem Bedürfnis nach Exploration – also der Wunsch, die Welt zu erkunden – und Autonomie zu verstehen. Die Herstellung der Ausgewogenheit beider Bedürfnisse gilt als eine lebenslange Entwicklungsaufgabe (Rass 2011).
Alle Kinder entwickeln im Verlaufe des ersten Lebensjahres eine oder mehrere enge Bindungen zu nahestehenden Personen. Ausgenommen davon sind Kinder, deren kognitives Entwicklungsniveau das von sechs Monaten nicht überschreitet, sowie schwer vernachlässigte Kinder. Im günstigen Fall hat das Kind bis zum Beginn des dritten Lebensjahres eine „sichere“ Bindung (s. Kapitel 2.3.2) zu einer oder mehreren zentralen Bezugspersonen aufgebaut.
„Das Kind sollte bis dahin eine emotionale Repräsentation der Bindungsperson entwickelt haben; diese ermöglicht es ihm zum einen, bei Angst und Gefahr zur Bindungsperson zu laufen und dort wie in einem ‚sicheren Hafen‘ Schutz zu suchen, und sorgt zum anderen dafür, dass das Kind innerlich auf die emotional positive Erfahrung von Schutz und Geborgenheit aus vielen solchen früheren Erlebnissen zurückgreifen und sich durch den Rückgriff und die Erinnerung an das gute Gefühl bei Aktivierung der Bindungsrepräsentation emotional selbst beruhigen kann“ (Brisch 2015, 40).
2.3.2 Bindungsstile
In der Bindungstheorie wird zwischen unterschiedlichen Bindungsstilen unterschieden. Diese Unterscheidung geht auf die Bindungsforscherin Mary Ainsworth zurück, die den sogenannten „Fremde Situations Test“ (1974/2011) entwickelte, bei dem sie das Verhalten von Kindern im Alter zwischen 12 und 18 Monaten in kurzen experimentell hergestellten Trennungssituationen beobachtete. Dabei kristallisierten sich drei unterschiedliche Bindungsstile heraus, die alle als Variationen eines normalen Bindungsverhaltens angesehen werden.
Als Typ A gilt der unsicher–vermeidende Bindungsstil – Mary Ainsworth ging davon aus, dass dieser Stil sich am häufigsten manifestieren würde, was sich aber nicht bewahrheitete. Die auf diese Weise gebundenen Kinder reagieren vermeintlich „cool“ auf die Trennung von der Bezugsperson, explorieren ungerührt weiter und zeigen keine besondere Reaktion nach Wiederkehr der Bezugsperson. Bei hormonellen Messungen am Hautwiderstand wurde aber deutlich, dass diese Kinder sehr wohl in dieser Trennungssituation Stress erleben, aber bereits Ende des ersten Lebensjahrs in der Lage sind, ihre Gefühle zu maskieren.
Martin Dornes (2012) beschreibt, dass Kinder bereits mit neun Monaten „Mentalisten“ seien, also in der Regel hoch interessiert daran sind, die Einstellungen anderer Menschen in deren Gesichtern zu lesen. Die Reaktion des Maskierens erklärt man sich in etwa auf diese Weise: Unsicher-vermeidend gebundene Kinder „lesen“ aus den Reaktionen ihrer Bezugspersonen, dass ein autonomes und gefühlsverbergendes Verhalten ein adäquates und gewünschtes Verhalten sei. Noch in vielen Kindertageseinrichtungen gelten die Kinder, die in Trennungssituationen „nicht so viel Theater“ machen, als die pflegeleichten und sich richtig verhaltenden Kinder. Auch in einigen afrikanischen Ländern scheint die Variante eines eher passiven und emotionslosen Babys und Kleinkindes populärer. Das Kind ist dann durch sein ruhiges Verhalten besser von anderen zu beaufsichtigen; Weinen oder Schreien gilt eher als Zeichen für eine ernsthafte Gefährdung (Atabavikpo Lochmann 2015).
Als Typ B gilt der sicher gebundene Bindungsstil – etwa 60–70 % aller Kinder sind den meisten Studien zufolge diesem Stil zuzurechnen. Sicher gebundene Kinder reagieren in der Regel mit deutlichen Emotionen (Weinen oder Schreien) auf die Trennung von der Bezugsperson, lassen sich dann beruhigen und reagieren mit klar erkennbarer Freude auf die Wiederkehr der Bezugsperson. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres verhalten sich sicher gebundene Kinder überwiegend kooperativ. Zu der Entwicklung eines sicheren Bindungsstils gehört die elterliche Feinfühligkeit bzw. die intuitive Elternschaft, die sich bei einem Großteil der Eltern als Anpassungsleistung nach der Geburt einstellt (Papoušek/Papoušek 1987) und auf die im nächsten Abschnitt (2.3.3) eingegangen wird.
Der Typ C wird als unsicher-ambivalenter Bindungsstil bezeichnet. Die betroffenen Kinder reagieren ebenfalls wie sicher gebundene Kinder deutlich erkennbar auf die Trennung, lassen sich dann aber nicht beruhigen und bleiben auch bei der Wiederkehr der Bezugsperson eher in der negativen Emotion. Häufig korreliert dieser Bindungsstil mit trennungsängstlichen oder zumindest sehr trennungsambivalenten Bezugspersonen.
Später wurde von Mary Main und Judith Solomon (1986) auch der sogenannte desorganisierte Bindungsstil (Typ D) klassifiziert. Dieser zeigt sich in einem äußerst wechselhaften, nicht eindeutigen Bindungsverhalten und geht z.T. mit plötzlichem Erstarren und eingefrorener Mimik einher. Er taucht bei ca. 5–10% der beobachteten Kinder auf und wird im Zusammenhang mit traumatisierenden Erlebnissen, Misshandlung oder auch chronischer Vernachlässigung gesehen.
Von den Bindungsstilen zu unterscheiden sind Bindungsstörungen, die in kinderpsychiatrische Diagnosesysteme einzuordnen sind. Hierzu zählt beispielsweise die reaktive Bindungsstörung, die von Angst und großer Zurückhaltung gegenüber Erwachsenen geprägt ist, und die Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung, die sich in Distanz- und Wahllosigkeit in Zuwendungsbezeugungen gegenüber Erwachsenen manifestiert. Letztere tritt des Öfteren bei stark deprivierten und vernachlässigten Kindern auf, die schon viele Wechsel ihrer Bezugspersonen erfahren mussten.
„Das Muster der sicheren Bindung wird als adaptiv für eine gesunde Entwicklung betrachtet. Trotzdem handelt es sich bei den bisher beschriebenen unsicheren Bindungsmustern und auch bei der Bindungsdesorganisation nicht um pathologische Muster, sondern um Varianten von Bindungsmustern, die innerhalb eines normalen Verhaltensspektrums angesiedelt werden können“ (Spangler 2011, 284).
Sichere oder unsichere Bindungsstile sind das Ergebnis gemeinsamer und individuell unterschiedlicher Interaktionserfahrungen. Sie können auch von Bezugsperson zu Bezugsperson variieren, sind geronnene Beziehungserfahrungen und nicht als stabile Eigenschaftsbeschreibungen zu betrachten. Frühe Bindungserfahrungen sind zwar für die spätere Entwicklung hoch bedeutsam. Dennoch kann das innere Arbeitsmodell von Bindung sich durch spätere positive Beziehungserfahrungen positiv oder durch das Auftreten schwerer Belastungen im späteren Leben auch negativ verändern (Seiffge-Krenke 2015). Bindungsprozesse werden als mentale Arbeitsmodelle etwa ab Mitte des zweiten Lebensjahres gespeichert – dieses geht auch mit dem Beginn des Spracherwerbs einher; mit fünf Jahren sind sie meist entwickelt und bilden das Bindungssystem.
2.3.3 Das Konzept der elterlichen Feinfühligkeit
Elterliche Feinfühligkeit setzt sich aus drei Komponenten zusammen:
a. Wahrnehmung der Signale des Kindes
b. angemessene Interpretation dieser Signale
c. angemessene und prompte Reaktion auf diese Signale
Bei einem Säugling sollte im Sinne von Feinfühligkeit auf die Bedürfnisäußerung – beispielsweise Schreien wegen Hungers – direkt geantwortet und sofern möglich auch mit sofortiger Bedürfnisbefriedigung gehandelt werden. Bei einem Kind um das erste Lebensjahr herum würde feinfühliges Handeln dagegen bedeuten, zwar direkt auf die Bedürfnisäußerung des Kindes zu antworten, aber je nach Situation nicht unbedingt gleich zu handeln und das Bedürfnis umgehend zu befriedigen (also nicht sofort unbekleidet und nass aus der Dusche zu springen, wenn das Kleinkind Hunger äußert).
Zu diesen feinfühligen Kompetenzen gehört es auch, dem Kind markiert seine Gefühle zu spiegeln. Das bedeutet, dem Kind durch Gestik, Mimik und Worte zu verstehen zu geben, dass man seine akute Not (z. B. Hunger, Schmerz, Müdigkeit) versteht, aber nicht teilt, und darum in der Lage ist, das Kind zu trösten. Das Kind bekommt somit seine Gefühle zum einen als seine eigenen und zum anderen als vom Gegenüber aushaltbar gespiegelt. Diese markierte Spiegelung ist zentral für die Ausbildung der Mentalisierungsfähigkeit, auf die unter Kapitel 2.6.1 eingegangen wird.
Etwa dreiviertel aller Eltern verfügen über derlei intuitive kommunikative Kompetenzen. Auch Geschwisterkinder können etwa ab dem 4. Lebensjahr im Umgang mit dem jüngeren Geschwisterkind Feinfühligkeit zeigen. Einige Eltern, beispielsweise depressiv erkrankte Elternteile, haben jedoch Schwierigkeiten, feinfühlig gegenüber ihren Kindern zu agieren (Murray 2011).
Lange Zeit ging es bei dem Konstrukt der Feinfühligkeit immer nur um die mütterliche Feinfühligkeit. Heute wird zwischen einem mütterlichen und einem väterlichen feinfühligen Interaktionsstil unterschieden – wobei diese Bezeichnungen insofern missverständlich sind, als dass sie nicht geschlechtsgebunden sind. Der sogenannte mütterliche Interaktionsstil, den aber auch Männer praktizieren können, zeichnet sich eher durch Konventionalität, Fürsorglichkeit und Sicherheit aus. Der sogenannte väterliche Interaktionsstil, den ebenso auch Mütter verfolgen können, manifestiert sich in unkonventionellem, das Erregungsniveau stimulierendem Verhalten (Grossmann/Grossmann 2006).
Ein wesentlicher Faktor für die Interaktion zwischen Eltern und Kind ist aber nicht nur die elterliche Feinfühligkeit, sondern u.a. auch der Gesundheitszustand und das Temperament des Kindes (Bindt 2003); alle diese Faktoren haben durchaus Auswirkungen auf den jeweiligen Bindungsstil der Kinder. In der Temperamentsforschung werden drei Temperamentsdimensionen unterschieden (Elsner/Pauen 2012):
a. das einfache Temperament (easy babies): Dazu zählen die sogenannten „Sonnenscheinkinder“ – explorativ, freundlich, mit hoher Selbstregulationsfähigkeit und kontaktsuchend.
b. das langsam auftauende Temperament (slow-to-warm-up babies): Diese Kinder verhalten sich eher zurückgezogen und beobachtend, verfügen über eine hohe Selbstregulationsfähigkeit und sind wenig reizoffen.
c. das schwierige Temperament (difficult babies): diese Kinder sind oftmals sehr explorativ, haben aber eine niedrige Selbstregulationsfähigkeit und sind sehr reizoffen; zu ihnen zählen die sogenannten „Schreibabys“.
Wichtig hierbei zu beachten ist die Passung bzw. das Zusammentreffen der unterschiedlichen Faktoren. So ist es auch für feinfühlige Eltern herausfordernder, eine sichere Bindung mit einem Kind mit einem schwierigen Temperament einzugehen; dennoch kann dieses durchaus gelingen. Wenn jedoch Eltern, die nur über geringe intuitive kommunikative Kompetenzen verfügen, ein Kind mit einem schwierigen Temperament haben, ist das Risiko für eine unsichere Bindung bzw. auch für die Entwicklung einer Bindungsstörung durchaus erhöht.
2.3.4 Bindungsstile im Erwachsenenalter
Zur Untersuchung von Bindungsstilen im Erwachsenenalter – hier spricht man von Bindungseinstellung – entwickelte Mary Main das Adult Attachment Interview (AAI) (Gloger-Tippelt 2012). Hierbei zeigten sich ähnliche Unterschiede wie bei Kindern. So konnten die autonome Bindungseinstellung, die distanziertbeziehungsabweisende Bindungseinstellung, die präokkupiertverstrickte Bindungseinstellung und die vom unverarbeiteten Objektverlust geprägte Bindungseinstellung unterschieden werden (Grossmann/Grossmann 2006).
Die autonome Bindungseinstellung von Eltern, die eine realistische und nicht idealisierende Erinnerung an die eigene Kindheit sowie positive und negative reflektierte Gefühle gegenüber Bindungspersonen umfasst, korrelierte überwiegend mit dem sicher gebundenen Bindungsstil ihrer Kinder.
Eltern mit distanziert beziehungsabweisender Bindungseinstellung haben oft viele Erinnerungen an ihre eigene Kindheit verdrängt, idealisieren diese, betonen ihre eigene Unabhängigkeit und Stärke und beharren darauf, dass es ihnen an nichts gefehlt habe. Dieser Bindungsstil korreliert mit dem unsicher-vermeidend gebundenen Bindungstyp bei Kindern.
Die präokkupiert-verstrickte Bindungseinstellung ist durch eine übermäßig detaillierte und wenig distanzierte Erinnerung an die eigene Kindheit sowie eine noch starke Abhängigkeit gegenüber den ursprünglichen Bindungspersonen gekennzeichnet. Elternteile mit der präokkupiert-verstrickten Bindungseinstellung haben oft unsicher-ambivalent gebundene Kinder mit erschwerten Ablöseprozessen.
Menschen mit einer von einem unverarbeiteten Objektverlust geprägten Bindungseinstellung haben oftmals schwere traumatisierende Verlusterlebnisse in ihrer Kindheit erfahren, die sie nicht bearbeiten konnten; dieses kann sich dann auch transgenerational in einem desorganisiert gebundenen Bindungsstil ihrer Kinder fortsetzen.
2.3.5 Die Relevanz des Bindungssystems
Bindungen werden als dauerhafte, dyadische Beziehungen definiert und werden nicht nur für die frühe Kindheit angenommen, sondern für den gesamten Lebensverlauf. Nicht jede Bezugsperson wird zur Bindungsperson, aber ein Kind ist in der Regel an mehr Personen gebunden, als nur seine Eltern.
In vertrauten Situationen und bei ausgeglichener Befindlichkeit gehen Kinder eher dem Interesse nach Neuem nach; in unvertrauten Situationen überwiegt das Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit und sie suchen Rückhalt bei den Menschen, zu denen sie eine sichere Bindung entwickelt haben. Dieses lässt sich auch auf das Erwachsenenalter übertragen: In einer Erstsemesterveranstaltung werden die Studierenden vorrangig das Bedürfnis haben, mit ihnen vertrauten Menschen zusammenzusitzen – im letzten Semester ist das Bedürfnis, sich nach außen und beispielsweise in Richtung Berufswelt zu orientieren, meistens relativ groß.
Eine Bindungsperson qualifiziert sich dadurch, dass sie vom Kind als personifizierte emotionale und empathische Sicherheitsquelle identifiziert wird, von der aus das Kind, je nach Situation und Kontext, regelmäßig exploriert und zurückkehrt, um emotional aufzutanken. Ein typisches Beispiel ist das von der Bezugsperson wegrobbende und sich doch immer wieder umdrehende Kleinkind, das sich auf diese Weise der Anwesenheit und der Aufmerksamkeit durch die Bezugsperson versichert. In Situationen der Verunsicherung und Angst wird das Bindungssystem aktiviert, d.h., Menschen suchen entsprechend ihres Bindungsstils besondere Nähe oder besondere Distanz zu den relevanten Bezugspersonen. Aus diesem Grunde begegnen SozialarbeiterInnen ihren KlientInnen auch oft in solchen Situationen, in denen deren Bindungssystem aktiviert ist – d.h. also in Notsituationen oder in Momenten, die von gefühlter oder realer Bedrohung geprägt sind.
In einer Hilfekonferenz für den zwölfjährigen Max, an dem die zuständige Jugendamtsmitarbeiterin, der Bezugserzieher der Jugendwohngruppe, Max und seine Eltern und deren Familientherapeutin teilnehmen, geht es um die Frage, wann und unter welchen Umständen Max wieder zu Hause wohnen darf. Max lebt wegen seines aggressiven Verhaltens, das sich in unkontrollierbaren Wutausbrüchen und verbalen Attacken gegen seine Mutter manifestiert, seit einem halben Jahr in der Wohngruppe. Er möchte sehr gern wieder zu Hause wohnen, auch seine Eltern wollen ihn wieder bei sich zu Hause aufnehmen, sie leben aber in furchtsamer Erwartung vor dem nächsten Wutausbruch. Bei einer probeweisen Beurlaubung, bei der Max unter dem Druck steht, sich „adäquat“ zu benehmen, trägt sich folgende Situation zu: Max will mit seiner Mutter am Sonntagmorgen Hausaufgaben machen. Diese stellt die Bedingung, dass er sich dazu anzieht. Max will die Hausaufgaben aber im Schlafanzug machen. Es kommt zum Streit und die Mutter verlässt abrupt das Zimmer. Daraufhin eskaliert die Situation, Max randaliert in seinem Zimmer und die Beurlaubung wird vorzeitig abgebrochen.
Dieses Beispiel stellt die Aktivierung einer Bindungsreaktion in einer für Max bedrohlichen Situation dar. Die bedrohliche Situation besteht zum einen darin, dass Max sich generell in seinen Rückkehrwünschen bedroht sieht, da hierzu noch keine verlässliche Entscheidung getroffen wurde. Zum anderen werden in dem plötzlichen Akt des Zimmer-Verlassens durch die Mutter möglicherweise alte Verlassenheitsängste aktiviert. Max hat als kleines Kind öfter die Erfahrung gemacht, dass seine Wünsche nach Nähe und Trost offenbar nicht aushaltbar sind und nicht erfüllt werden können, und reagiert zunächst mit Frustration, die sich dann in Aggression kehrt, wenn er den Wunsch nach Nähe verspürt. Für seine Eltern, die vermutlich über eine distanziertbeziehungsabweisende Bindungseinstellung verfügen, sind seine „Nähewünsche“ als solche nicht mehr erkennbar. Beide Eltern verfügen nur über ein sehr geringes Erinnerungsvermögen an ihre eigene Kindheit, verbalisieren wenig ihre Gefühle und pochen sehr auf ihre Autonomie und Unabhängigkeit. Max maskiert seine Nähe- und Trostbedürfnisse hinter pseudoautonomem, ruppigem und aggressivem Verhalten. Max‘ Eltern können demzufolge sein Verhalten aus gut nachvollziehbaren Gründen nur als gegen sich gerichtet erkennen.
Bindungsstile können sich im Laufe des Lebens modifizieren oder durch korrigierende Erfahrungen verändert werden. Zu den wesentlichen protektiven Faktoren zählt eine längere und stabile Beziehung an eine Bezugsperson – dieses kann z.B. eine Großmutter, ein Pflegevater oder auch eine langjährige sozialpädagogische Familienhelferin sein – eine stabile Partnerschaft im Erwachsenenalter oder auch eine psychotherapeutische Behandlung (Kißgen 2009).
Anhand von Bindungstheorien ist es also insgesamt möglich, Verhalten sowie Erlebens- und Verarbeitungsweisen von kleinen Kindern in emotionalen Notsituationen bzw. körperlich bedrohlichen Situationen zu beschreiben und zu erklären. Bindungssysteme werden jedoch nicht nur in der Kindheit, sondern ein Leben lang in Notsituationen aktiviert. Auch SozialarbeiterInnen selbst müssen also – beispielsweise in Krisensituationen – darauf achten, dass KlientInnen ihre eigenen Bindungsbedürfnissignale erkennen und wenn möglich auch zeigen dürfen. Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist, dass es für Menschen auf der Flucht von immenser Wichtigkeit ist, einen wie auch immer gearteten Kontakt zu ihren Angehörigen in ihrer Heimat zu haben, sodass die Schaffung oder Ermöglichung von Internet- und/oder telefonischen Verbindungen beispielsweise in Notunterkünften oder Flüchtlingsheimen unter Bindungsgesichtspunkten als absolut elementar anzusehen ist.
2.4 Entwicklungsfaktoren und -risiken in der Schwangerschaft
Die meisten Frauen erleben Schwangerschaft als einen schönen und unkomplizierten Prozess. SozialarbeiterInnen sind aber häufig mit den Risiken und Belastungen rund um die Schwangerschaft bei den betroffenen Frauen und Familien beschäftigt. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel die entwicklungsbezogenen Risiken der Schwangerschaft beschrieben.
Ein Risiko jeder Schwangerschaft ist die Fehlgeburt. Bereits nach der Zeugung beginnt der biologische Entwicklungsprozess eines Individuums. Etwa zehn Tage nach der Empfängnis bilden sich die ersten Zellen an der Uteruswand der Mutter. Allerdings überleben nicht einmal die Hälfte aller befruchteten Eizellen die ersten zwei Wochen (Myers 2014). Die Zahl der (in diesem frühen Stadium der Schwangerschaft meist unbemerkten) Fehlgeburten liegt in den ersten vier Wochen bei fast 50%.
Fehlgeburten werden in Anamnesen und Genogrammen, bei denen es um die Erfassung individueller und familienbezogener Lebenserfahrungen geht, oft verschwiegen – aus Scham, dem Gefühl vermeintlicher Bedeutungslosigkeit oder auch aus der Empfindung heraus, allein damit zu sein. Sie haben aber in der Regel für die Mütter, Väter und die Geschwister eine hohe psychische Bedeutung und können auch eine Belastung darstellen, die umso stärker ist, desto tabuisierter sie gehandhabt werden.
Andere Risiken für die Entwicklung des Kindes in der Schwangerschaft sind Erkrankungen der Mutter, beispielsweise durch Virusinfektionen, oder unerwartete Komplikationen während der Geburt. Ein plötzlicher Sauerstoffmangel während der Geburt kann beispielsweise zu schweren Folgeschäden führen, die die werdenden Eltern oft unvorbereitet schwer treffen. Sich in dieser Situation um Eltern zu kümmern und Unterstützung anzubieten, ist oft die Aufgabe von in Kliniken tätigen SozialarbeiterInnen.
Auch das Verhalten der Mutter kann Schädigungen für das Kind verursachen. So schaden Nikotin, Alkohol sowie der Konsum anderer Drogen – mit Ausnahme von Koffein – der Entwicklung des Embryos und späteren Fötus. Es sei an den eingangs beschriebenen Fall von Lisa erinnert, bei der der Drogenkonsum der Mutter mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Auslöser der Frühgeburt gewesen ist. Weitere Folgeschäden können Missbildungen und/oder Verhaltensstörungen sein. Die Zahl der jährlich in Deutschland mit alkoholbedingten Schädigungen auf die Welt gebrachten Kinder liegt in den 2010er Jahren bei etwa 10.000, ca. 2000 Babys erfüllen das Vollbild des „fetalen Alkoholsyndroms“. Dieses kann sich in drei Bereichen entfalten: in körperlichen Fehlbildungen, Wachstumsstörungen und Schädigungen des zentralen Nervensystems. Diese Gruppe bildet ein nicht zu vernachlässigendes Klientel von SozialarbeiterInnen (Pfinder/Feldmann 2011, ter Horst 2010).
SozialarbeiterInnen arbeiten nicht nur mit den hiervon betroffenen Kindern, sondern auch mit ihren Eltern, und insbesondere mit ihren Müttern. Sie haben die Aufgabe, in der Arbeit mit drogen- und alkoholabhängigen potenziellen und schwangeren Müttern präventiv tätig zu sein und diese aufzuklären. Wenn die Kinder geboren wurden, sind sie weiter unterstützend tätig in der Elternarbeit.
Unterschätzt werden nach wie vor die Folgen einer unerkannten und nicht behandelten postpartalen Depression. Etwa 10–15% (Bühring 2012) der Mütter erleiden eine postpartale Depression, die sich von dem zwei- bis fünftägigen „Babyblues“ unmittelbar nach der Geburt in ihrer Länge und ihrem Ausmaß unterscheidet. Erschwerend für die Erkennung und Behandlung dieser Erkrankung kommt hinzu, dass der gesellschaftliche Druck auf die Frauen, jetzt glücklich mit ihrem neugeborenen Kind sein zu müssen, nach wie vor enorm hoch ist und die Scham, diesen Erwartungen nicht entsprechen zu können, umso höher. Aus sozialarbeiterischer Sicht ist insbesondere darauf zu achten, die postpartale Depression als solche zu enttabuisieren, über Behandlungsmöglichkeiten zu informieren, Betroffene ggf. an psychiatrische oder psychotherapeutische Fachkräfte weiter zu vermitteln sowie die sozialen Netzwerke der Betroffenen zu aktivieren, um diese auch informell zu unterstützen. Insbesondere aufsuchende Hilfeformen sind ausgesprochen geeignet, die Rate unerkannter und unbehandelter postpartaler Depressionen zu senken (Hübner-Liebermann et al. 2012). Die postpartale Psychose, eine Erkrankung, bei der die betroffene Frau unter extremen Angst-, Wahnvorstellungen oder Halluzinationen leidet, ist eher selten und betrifft 0,1–0,2% der Mütter. Sie bedürfen in der Regel einer sofortigen stationären psychiatrischen Behandlung, wobei idealerweise Fachkräfte der Sozialen Arbeit die Zusammenarbeit verschiedener Professionen koordinieren sollten.
2.5 Entwicklung in der Säuglings-und Kleinkindzeit
„Für Joey sind fast alle Begegnungen mit der Welt dramatisch und vom Gefühl bestimmt. Elemente und Wesen dieser dramatischen Zusammentreffen sind für uns Erwachsene nicht offensichtlich. Von allen Dingen im Zimmer erregt der Sonnenschein an der Wand Joeys Aufmerksamkeit am meisten und hält ihn in Bann. Die Helligkeit und Intensität faszinieren ihn. Im Alter von sechs Wochen ist seine Sehfähigkeit schon recht gut entwickelt, wenn auch zur Perfektion noch einiges fehlt. Er erkennt bereits verschiedene Farben, Formen und Intensitätsgrade. Von Geburt an hat er starke Vorlieben für bestimmte Dinge, die er ansehen möchte, für Dinge, die ihm gefallen. An erster Stelle steht dabei die Intensität einer Wahrnehmung […]“ (Stern/Bruschweiler-Stern 2004, 24).
Dieses Zitat stammt aus dem fiktiven „Tagebuch eines Babys“ des britischen Entwicklungspsychologen Daniel Stern, bei dem höchst eindrücklich die Wahrnehmung eines Sonnenstrahls durch einen Säugling beschrieben wird. Bereits Neugeborene verfügen über ein differenziertes Wahrnehmungsvermögen: Sie schmecken und unterscheiden von Anfang an zwischen „süß“, „sauer“ und „bitter“. Nach wenigen Tagen erkennen sie ihre Mutter am Geruch. Sie hören bereits seit dem sechsten Schwangerschaftsmonat und orientieren sich als Neugeborene in Richtung einer Schallquelle. Sie sind in der Lage, Objekte, Muster, Figuren oder Formen zu erkennen, wenn sie sie auch noch nicht mit den Augen fixieren können, und sie unterscheiden Farbtöne und Helligkeitsabstufungen. Im Unterschied zu Sigmund Freud, der den Säugling noch als passives und einzig und allein an seiner Lustbefriedigung orientiertes Wesen ansah, hat der Entwicklungspsychologe Martin Dornes (1993) das Bild des kompetenten und an Interaktion interessierten Säuglings geprägt. Im Folgenden werden zum einen die Entwicklung des Selbst, und zum anderen die frühe Entwicklung kognitiver, emotionaler und selbstregulatorischer Prozesse beschrieben.
2.5.1 Die Entwicklung des Selbst
Daniel Stern (1979)schildert die Entwicklung des Selbstempfindens in vier Stadien. Das erste Stadium wird durch ein sogenanntes unreflektiertes Selbstempfinden gekennzeichnet; das Neugeborene ist ganz mit sich und seinen vegetativen Prozessen beschäftigt, von denen es beherrscht und manchmal auch gequält wird. Stern hat für dieses Stadium den schönen Begriff des auftauchenden Selbst geprägt; der dritte Lebensmonat, der auch den Übergang von der Neugeborenen- zur Säuglingszeit darstellt, ist oft ein Zeitpunkt, an dem viele Kinder erst „richtig“auf die Welt kommen.
Ab dem dritten Monat erfolgt laut Stern die Bildung eines Kernselbst. Das Kind spürt, dass es von der Mutter körperlich getrennt ist, und es existiert ein primär körperliches Selbstempfinden. Ab diesem Zeitpunkt werden bereits zwei entgegengesetzte Grundbedürfnisse erkennbar, die den Menschen ein Leben lang begleiten werden: das Bedürfnis nach Bindung und das Bedürfnis nach Exploration und Autonomie. Lichtenberg (1991) spricht von fünf Motivationssystemen, die er bereits dem Säuglingsalter zuschrieb. Dazu gehören die Notwendigkeit biologische Bedürfnisse wie Essen und Schlafen zu erfüllen, das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung, das Bedürfnis nach Rückzug, wenn unangenehme Dinge passieren, und das Bedürfnis nach Sinnlichkeit und Sexualität.
Ungefähr mit Beginn des siebten Lebensmonats wird, so Stern, das Stadium des subjektiven Selbst erreicht. Dieses bedeutet, dass das Kind ab diesem Zeitpunkt die zentrale Erfahrung von Intersubjektivität macht – Erlebnisse und Gefühle können mit anderen geteilt werden. Interessanterweise geht dieses Stadium mit einem bedeutsamen Schritt in der motorischen Entwicklung einher: Etwa ab diesem Zeitpunkt können sich die meisten Kinder auf irgendeine Weise von ihren Bezugspersonen wegbewegen. Charakteristisch ist ein eifriges Wegrobben, das von einem in regelmäßigen Abständen den Kopf in Richtung der Bezugsperson Wenden begleitet wird – nach dem Motto: „Bist Du noch da? Na dann ist gut, dann kann ich weiter. “
In dieser Sequenz bildet sich das Grundkonzept bzw. die Grundspannung komplementärer menschlicher Bedürfnisse ab, die bereits bei der Beschreibung des Bindungsbegriffs (s. Kapitel 2.3.1) benannt wurde: Es geht um die Befriedigung des Explorationsbedürfnisses – die Suche nach Veränderung – und um die des Bindungsbedürfnisses – der Wunsch nach einer sicheren Rückzugsmöglichkeit. Ungefähr zur selben Zeit setzt das sogenannte „Fremdeln“ ein, das sich vor allem in der Abwendung des Blicks und lauten Unmutsäußerungen manifestiert, wenn eine sich dem Kind nicht ganz so vertraute Person plötzlich nähert. Dieses Phänomen tritt auf, wenn sich bereits eine Bindung an eine Bezugsperson etabliert hat, also Vertrauen entstanden ist. Unter funktionalen Gesichtspunkten erklärt sich das Fremdeln aus der neu entstandenen Fähigkeit zu eigener Fortbewegung. Das Kind kann sich selbst wegbewegen und sich vor Fremden und nicht fürsorgemotivierten Personen quasi schützen (Bischof-Köhler 2011).
Etwa ab dem 15–18. Lebensmonat setzt das vierte Stadium des Selbstempfindens ein, welches Stern als das verbale bzw. konzeptuelle Selbst bezeichnet. Das Kind wird sich seiner selbst als „ich“ bewusst. Bis zu dieser Zeit ist das sog. Playmate-Verhalten zu beobachten. Die Kinder lächeln oder spielen mit dem Spiegelbild wie mit einem Spielpartner, identifizieren es aber nicht als ihr eigenes Abbild. Nun erkennen Kinder ihr eigenes Spiegelbild.
Auch motivational geschieht in diesem neuen Stadium des Selbstempfindens eine Veränderung: Die Kinder bekommen ein Gefühl für ihre eigene Leistung. In einem Experiment wurde deutlich, dass Kinder ab dem Zeitpunkt, an dem sie sich selbst im Spiegel erkennen können, nicht mehr gelassen darauf reagieren, ob sie oder jemand anderes den letzten Stein auf einen selbst gebauten Turm legen. Sie geben deutlich zu erkennen, die Erfahrung des Selbst-fertiggestellt-Habens machen zu wollen (Bischof-Köhler 2011). Diese Phase geht mit einer zunehmenden Fähigkeit zu symbolisieren, d.h. in Als-ob-Möglichkeiten zu denken, einher. Es ist eine Phase, in der man Kinder wie selbstverständlich mit einem Auto am Ohr durchs Zimmer streifen sieht – sie „telefonieren“ dann, bzw. tun so, als ob.
„In der Ausgestaltung von Als-ob-Situationen – ich tue so, als wenn ich einkaufen gehe, indem ich Mamas Schlüssel, ihre Schuhe und eine Plastiktüte als Handtasche nehme – macht sich das Kind eine weitere Realität verfügbar. Mit symbolischen Gesten und Handlungen setzt es Erfahrungen und Ereignisse in Szene, die von realen Ereignissen und Gegenständen entkoppelt sind. Das Spiel ist geprägt von Intensität, Ernsthaftigkeit, Freude, Kreativität und Konzentration; es folgt einem inneren ‚Faden‘ und führt zu Zufriedenheit und Sättigung“ (Rass 2011, 91).
Die Fähigkeit zur Symbolisierung ist eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung späterer Verbalisierungs- und Abstraktionsfähigkeiten und auch dafür, Emotionen in Sprache zu übersetzen und nicht unmittelbar auszuagieren. Jugendliche mit dissozialen Störungen – eine häufige Klientel von SozialarbeiterInnen – sind oftmals genau in dieser Fähigkeit beeinträchtigt; ihnen fehlt die Möglichkeit, ihre Wut zu verbalisieren, sodass sie sie in gewalttätigen Handlungen ausdrücken müssen.
2.5.2 Kognitionen, Emotionen und die Fähigkeit zur Selbstregulation
Jean Piaget (1896–1980) gilt als einer der wichtigsten Entwicklungspsychologen, der sich mit der geistigen Entwicklung von Säuglingen und Kindern beschäftigte. Er verstand diese geistige Entwicklung als Prozess der aktiven Konstruktion von Wissen in der Interaktion des Individuums mit der Umwelt. Das Kind bezeichnete Piaget als einen von einer inneren Neugier getriebenen Wissenschaftler, der aktiv seine Umwelt erkunde (Piaget 2003, Sodian 2012). Dabei beschrieb er den Erkenntnisprozess im Wechselspiel von zwei komplementären Mechanismen. Den einen nannte Piaget Assimilation. Assimilation geschehe immer dann, wenn etwas Neues in bestehende mentale Strukturen integriert werden könne. Dieser reiche aber allein nicht aus, um sich den Lernzuwachs von Kindern zu erklären:
„Wenn nur Assimilation an der Entwicklung beteiligt wäre, gäbe es keine Variationen in der Struktur des Kindes. Infolgedessen würde es keine neuen Inhalte erwerben und sich nicht weiterentwickeln“ (Piaget 2003, 55).
Den anderen und ergänzenden Mechanismus bezeichnete Piaget als Akkomodation. Hierbei müssen sich die mentalen Strukturen an die Umweltanforderungen anpassen und entwickeln sich auf diese Weise weiter. Das Wechselspiel dieser beiden Mechanismen soll an folgendem Beispiel illustriert werden:
Ein anderthalbjähriges Kind hat herausgefunden, dass ein Teller, wenn es ihn auf den Boden wirft, zerbricht. Wenn es dann eine Tasse herunterwirft, lernt es, dass auch Tassen zerbrechen und ordnet dies seinem vorhandenen Wahrnehmungsschema zu, dass Gegenstände, wenn man sie herunterwirft, kaputt gehen. So erklärt sich der Mechanismus der Assimilation. Die bestehende mentale Struktur des Kindes beinhaltet nun die Überzeugung, dass Gegenstände, die man hinunterwirft, kaputt gehen. Nun stellt das Kind aber fest, dass z.B. ein Plastikteller oder ein Plastikauto heil bleibt, obwohl man sie herunterwirft. Das heißt, das Kind verändert durch den Mechanismus der Akkomodation seine mentalen Strukturen von „alle Gegenstände gehen kaputt, wenn ich sie runterwerfe“ in „manche Gegenstände, die ich herunterwerfe, gehen kaputt, andere nicht“.
Piaget umschrieb die ersten zwei Lebensjahre als sensumotorisches Stadium, in dem die kognitiven Grundlagen für die sensorischen und motorischen Handlungen – die sensumotorischen Schemata – gelegt werden. Dazu zählen z.B. das Saugschema und die Exploration mit dem Mund. Jean Piaget fand auch heraus, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter – er schätzte es bei acht Monaten – keine Objektpermanenz haben. Sie gehen also davon aus, dass ein Gegenstand – z.B. ein Ball –, der aus ihrem Blickfeld verschwindet, dann auch nicht mehr existiert. Nach heutigen Erkenntnissen weiß man allerdings, dass Piaget die kognitiven Fähigkeiten jüngerer Kinder deutlich unterschätzte, dass sich die Fähigkeit zur Objektpermanenz deutlich früher einstellt und prozesshaft verläuft, als Piaget dieses angenommen hatte (Sodian 2012).
Bereits im Säuglingsalter können kulturübergreifend sieben bis zehn Basisemotionen beobachtet werden. Dazu zählen Freude, Angst, Trauer, Wut, Ekel, Verachtung, Überraschung, Interesse, Scham und Schuld (Izard 1999, Dornes 2012). Im Film „Alles steht Kopf“, der vom Emotionsforscher Dacher Keltner mitentwickelt wurde, wird sichtbar, wie sehr Gefühle die Weltwahrnehmung dominieren und bei gleichzeitigem Auftreten auch verwirren können. Emotionen sind immer von physiologischen Reaktionen und kognitiven Bewertungen begleitet, wobei manchmal die Emotion der Kognition vorausgeht und manchmal umgekehrt die Kognition die Emotion bestimmt (Myers 2014). Auf dieser Basis arbeitet beispielsweise die kognitive Verhaltenstherapie mit depressiven Menschen, in dem sie mit ihren Klienten positive Umdeutungen von chronisch als negativ erlebten Situationen übt (s. Kapitel 6.3). Säuglinge und Kleinkinder sind noch nicht in der Lage, negative Emotionen kognitiv zu beeinflussen, und sind ihren Bedürfnissen und Gefühlen daher – anders als Erwachsene – ausgeliefert. Sie brauchen in der Regel Unterstützung bei ihrer Emotions- und Spannungsregulation.
Besonders evident wird dies bei sogenannten Trotzanfällen. Trotzanfälle, die in der Regel im dritten und vierten Lebensjahr auftreten, resultieren entwicklungspsychologisch betrachtet aus einer faktischen Diskrepanz zwischen dem wachsenden Autonomieanspruch des Kindes auf der einen und seinen im Vergleich dazu noch nicht ausreichenden Fähigkeiten auf der anderen Seite. Das Kind kann weder alles, noch darf es alles. Infolgedessen ist es häufig frustriert und drückt in Trotzanfällen seine Wut und seinen Ärger aus. Ebenso kann Trotzverhalten entstehen, wenn das Kind sich schämt und diese Scham nicht aushalten kann (Wurmser 1998). Trotzanfälle können aber auch dann auftreten, wenn sich das Kind gar nicht in Interaktion befindet. Beispielsweise kann es darum gehen, dass ein Kind sich zwischen zwei Spielzeugen oder Aktivitäten nicht entscheiden kann und der entstehende Motivkonflikt zu einer totalen Handlungsblockade führt.
„Mit dem Ich als erlebtem Zentrum des Wollens und der Möglichkeit, sich Handlungsalternativen vorzustellen, entsteht also die Notwendigkeit, interne Motivkonflikte zu managen. Das Kind muss also als nächstes lernen, dass Selbst-Wollen-Können nicht bedeutet, alles gleichzeitig wollen zu können“ (Bischof-Köhler 2011, 160).
Diese Fähigkeit erwirbt das Kind aber meist erst nach dem vierten Lebensjahr. In den Trotzanfällen verbirgt sich manchmal auch eine interaktive Machtthematik; das Kind möchte in diesem Alter seine Bezugspersonen herausfordern. In der Regel wird dieser Aspekt aber von den erwachsenen Interaktionspartnern überschätzt, die strafend oder ignorierend auf das trotzige Verhalten reagieren. Dieses resultiert oftmals aus der gefühlten Ohnmacht, die sich vom Kind auf den Erwachsenen überträgt. Auch die Mutter kann nichts daran ändern, dass ihr zweijähriger Sohn noch nicht in der Lage ist, die Schleife am Schuh zu binden, und sie kann ihn in dieser Situation nicht zufriedenstellen.
„‚Nein‘ und ‚Selbermachen-Wollen‘ ist die Devise; diese Phase führt unausweichlich zum Zusammenprall mit den grenzsetzenden Erwachsenen, aber auch zur narzisstischen Kränkung, dass die Geschicklichkeit noch fehlt, um gewisse Handlungen fehlerfrei durchzuführen […] eine existenziell wichtige Aufgabe […] ist, dem Kind die Erfahrung zu vermitteln, dass es eine aversive Position einnehmen kann und dass in der Folge die Gemeinsamkeit gefahrlos wiederherstellbar ist“ (Ornstein/Rass 2014, 30f.).
Der Umgang mit diesem Phänomen ist insbesondere bei der Elternarbeit, wie auch in der direkten sozialpädagogischen Arbeit mit kleinen Kindern, enorm reflexionsbedürftig, weil Trotzreaktionen wie wenig andere Phänomene, autoritäre, machtdemonstrierende und z.T. auch gewalttätige Impulse in uns selbst oder bei den betroffenen Eltern hervorrufen (Brisch 2015). Zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr resultieren viele Kinderschutzfälle daraus, dass Eltern mit ohnmächtiger Wut auf das, von ihnen als bösartig und ungehorsam interpretierte Verhalten ihrer Kinder reagieren.
Eine sozialpädagogische Aufgabe könnte in dieser Situation beispielsweise sein, die an der Interaktion beteiligten Menschen darin zu stützen, die Ohnmacht auf beiden Seiten – auf Seiten des Kindes, etwas nicht zu können, und auf Seite der Erwachsenen, nicht helfen zu können, – auszuhalten und eher in die Trost-, denn in die Bestrafungsreaktion zu gehen. Dazu bedarf es allerdings auf Seiten der SozialarbeiterInnen, gelegentlich einen – freundlichen – Blick auf die eigenen trotzigen Seiten zu werfen (Bräutigam 2016).
2.6 Entwicklung der Kindheit
„Kindsein war: hinfallen, im Tunnel schreien, ins Badewasser pinkeln, Läuse haben, nicht auf Gehwegplatten mit Sprung treten, Brille kriegen, schaukeln und kotzen, nicht den Boden berühren!, Brottasche schleudern, Muttervaterkind spielen, Scherben sammeln, Schlüssel verlieren, aus der Zahnlücke Blut saugen, Puppe operieren, der Katze das Laufen auf zwei Beinen beibringen […] “ (Budde 2010).
In Bezug auf die kognitive Entwicklung beginnt laut Piaget etwa nach Abschluss des zweiten Lebensjahrs das sog. präoperatorische Stadium, das in etwa bis zum siebten Lebensjahr anhält (Sodian 2012). Es bilden sich auf Menschen und auf Gegenstände bezogen stabile mentale Repräsentationen. Die Kinder sind nicht mehr nur auf das Hier und Jetzt bezogen, sondern es entsteht langsam eine Repräsentation von Vergangenheit und Zukunft und die Vorstellungskraft nimmt zu. Nach wie vor sind bestimmte logische Operationen, z.B. Reversibilität, noch nicht möglich. In sozialer Hinsicht spricht Piaget von Egozentrismus, der auch noch bei Vorschulkindern herrsche. Kinder in diesem Alter seien noch nicht in der Lage, aus der Perspektive eines Dritten zu sehen (Myers 2014). Auch hier unterschätzte Piaget jedoch die kindlichen Fähigkeiten (s. Kapitel 2.6.1 :das Maxi-Paradigma).
Es folgt mit Eintritt des Schulalters – so Piaget – das konkretoperatorische Stadium, das mit der Entwicklung von Zahl- und Zeitbegriffen einhergeht. Die logischen Operationen von Verknüpfungen, wie z.B. Addition und Reversibilität (9 + 5 = 14 und 14 – 9 = 5), werden möglich.
In Bezug auf die kindliche Persönlichkeitsentwicklung können Kinder im Alter zwischen zweieinhalb und fünf Jahren beobachtbare Züge des Selbst konstruieren (ich habe blaue Augen, bin kitzlig und mag Eierkuchen). Diese Selbstbeschreibungen stehen aber weitgehend unverbunden nebeneinander. Kinder entwickeln bereits ab dem 3. Lebensjahr eine soziale Identität, d.h., ein Gefühl für „ihre Gruppe“, und favorisieren diese. Bereits mit vier Jahren entwickeln Kinder einen differenzierten Zeitbegriff und sind in gewisser Hinsicht in der Lage vorausschauend zu denken. Ab dem sechsten Lebensjahr können Merkmale der Selbstbeschreibung miteinander verknüpft werden. Das Kind kann sich und andere mit Hilfe von Gegensatzpaaren beschreiben (Mathilde hat grüne Augen und ich blaue, Mattis kann gut rennen und ich gut zeichnen). Der egozentrische Standpunkt verringert sich noch weiter und der Standpunkt anderer beginnt wirksam zu werden. Das Kind vermag sich nun vorzustellen, was ein Anderer über einen Dritten oder es selbst denkt. Kinder verfügen in etwa ab diesem Zeitpunkt über ein differenziertes und relativ stabiles Selbstkonzept, das mit zunehmendem Alter immer realistischer wird. Ebenso gewinnen Freunde an Bedeutung, auch wenn Freundschaft noch eher zweckorientiert ist – man braucht jemanden zum Spielen und jemanden, der einem hilft und dem man vertrauen kann (Heidbrink 2013).
Ab dem neunten Lebensjahr können Eigenschaften beschrieben werden, die hinter einzelnen Verhaltensweisen stehen und die Vereinbarkeit gegensätzlicher Eigenschaften wird möglich (ich bin eigentlich kein wütender Mensch, aber in bestimmten Situationen raste ich aus). Ab ungefähr zehn Jahren können Kinder ihre eigene Perspektive mit der Anderer vergleichen. Sie können die Perspektive einer dritten Person einnehmen und auf dieser Grundlage die Ansichten von zwei weiteren Personen bewerten (Kray/Schaefer 2015).
In Bezug auf die sozioemotionale Entwicklung sind Kontrollüberzeugungen und das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit von besonderer Bedeutung. In dem sehr interessanten und vielzitierten Marshmallow-Experiment von Mischel (2015) waren manche vierjährige Kinder in der Lage, auf eine Belohnung zu warten, wenn sie durch das Warten eine attraktivere und größere Belohnung bekamen, als wenn sie sie gleich erhielten. Diese Kinder waren offenbar bereits in der Lage, sich vorzustellen, das Gewünschte später nachzuholen; der Aufschub war somit leichter. In späteren Langzeitstudien wurde deutlich, dass die Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub ein wesentlicher Prädiktor für späteren Schul- und beruflichen Erfolg darstellte (Shoda et al. 1995). Die Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub hat übrigens auch etwas mit Bindungssicherheit zu: bindungssichere Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Bedürfnisse verlässlich und mit aushaltbaren Zeitverschiebungen erfüllt werden.
In den folgenden beiden Abschnitten werden exemplarisch zwei weitere Funktionen bzw. Fähigkeiten beschrieben, die bei der sozioemotionalen Entwicklung im Kindesalter und im Kontext der Sozialen Arbeit eine herausragende Rolle spielen.
2.6.1 Theory of mind und die Entwicklung von Mentalisierung
Die Psychologen David Premack und Guy Wodruff (1978) haben den Begriff der Theory of mind (Theorie über mentale Zustände) geprägt. Dieser bezeichnet die Fähigkeit, innere Zustände anderer Menschen erkennen zu können. Zwei- bis Dreijährige wissen zwar, z.B. dass jemand anderes etwas sehen kann, was sie selbst gerade nicht sehen, oder dass man vorgestellte Bonbons nicht essen kann. Sie wissen aber in der Regel bis zum vierten Lebensjahr noch nicht, dass Überzeugungen zu Sachverhalten nur Annahmen sind, die den realen Tatbestand treffen oder auch verfehlen können.
Wimmer und Perner (1983) führten dazu ein Experiment durch, das heute als Maxi- oder auch als das Schokoladen Paradigma beschrieben wird. Sie zeigten Kindern eine Bildergeschichte, in der Maxi Schokolade in eine Schublade legt und dann zum Spielplatz geht. Während Maxi auf dem Spielplatz ist, legt ihre Mutter die Schokolade in eine andere Schublade. Die Kinder wurden nun gefragt, in welcher Schublade Maxi die Schokolade nun suchen würde. Dreijährige Kinder antworten, in der Regel, dass Maxi die Schokolade in der Schublade sucht, in die die Mutter sie hineingetan hat – sie werden somit als naive Realisten bezeichnet und erliegen dem „false belief“. Erst mit vier Jahren antworten die Kinder, dass Maxi die Schokolade in der Schublade suchen würde, in die sie sie hineingelegt habe, weil sie ja nicht wissen könne, dass die Mutter sie weggelegt hat (Sodian 2012).
Vor dem vierten Lebensjahr ist somit noch keine Perspektivübernahme möglich. Kinder können sich in den anderen zwar hineinversetzen, verstehen diesen aber gemäß von ihrem eigenen Erleben. Ab vier Jahren ist eine einfache Perspektivübernahme möglich, die Subjektivität der Perspektiven wird bewusst und es entsteht die Idee, dass der andere etwas anderes denken könnte, als man selbst.
Sicher gebundene Kinder sind aufgrund der oben beschriebenen markierten Spiegelungserfahrungen (s. Kapitel 2.3.3) durch ihre feinfühligen Bezugspersonen ab etwa vier Jahren in der Lage, ihre eigenen Gefühlszustände von denen ihres Gegenübers zu differenzieren und somit „mentalisieren“ zu können.
„Mentalisieren heißt, sich auf die inneren Zustände in sich selbst und im anderen zu beziehen“ (Brockmann/Kirsch 2010, 279).
Das Mentalisierungskonzept wurde von dem britischen Psychologen und Psychoanalytiker Peter Fonagy et al. (2004) entwickelt und ist über die mentalisierungsbasierte Psychotherapie mittlerweile auch ein relevantes Konzept in der Sozialen Arbeit (Kirsch 2016). Die Fähigkeit zur Mentalisierung, d.h. also die eigenen inneren Befindlichkeiten von denen des Gegenübers differenzieren zu können, ermöglicht zwischenmenschliches Verständnis und eine daraus resultierende Handlungsfähigkeit. Sie erleichtert zudem aus sozialarbeiterischer Perspektive in den meisten Fällen die Beziehungsaufnahme zum Klienten.
Im Falle von dem bereits geschilderten Fallbeispiel von Max und seinen Eltern bestand beispielsweise ein Großteil der familientherapeutischen Arbeit, mit den Eltern und Max zu üben, Gefühle als solche zu identifizieren – also beispielsweise zwischen Wut, Traurigkeit, Verlassenheit und Enttäuschung zu unterscheiden – und diese dann nach und nach in Sprache zu bringen. In einem zweiten Schritt ging es dann darum, diese Gefühle beim Gegenüber wahrzunehmen und ebenfalls benennen, d.h. „mentalisieren“ zu können.
Dies könnte in der oben beschriebenen Situation konkret bedeuten, dass Max Mutter in der Lage wäre, zu Max zu sagen: „Max, ich bin wütend, weil Du Dich nicht anziehen willst, und möchte deshalb rausgehen. Ich bekomme aber mit, dass es Dir Angst macht, wenn ich Dein Zimmer verlasse“. Und Max könnte sagen: „Ich habe Angst, dass ich nicht wieder nach Hause kommen darf. Ich bekomme mit, dass Du vor mir Angst hast, wenn ich Dinge kaputt mache oder Dich beschimpfe.“
Viele der Klienten, mit denen SozialarbeiterInnen zu tun haben, sind nur sehr begrenzt in der Lage zu mentalisieren, zum einen aufgrund von biographischen bindungsbezogenen Erfahrungen, und zum anderen weil die Mentalisierungsfähigkeit generell in Stresssituationen beschränkt und eingeengt ist. Ein gutes Beispiel dafür sind Sorgerechtsstreitigkeiten prinzipiell gut reflektierter Elternteile, die in dieser Situation aufgrund trennungsbedingter Verletzungen wenig bis gar nicht in der Lage sind, die Gefühlszustände ihres Ex-Partners oder auch der gemeinsamen Kinder zu mentalisieren. Für SozialarbeiterInnen ist es somit eine grundlegende Aufgabe und Anforderung, ihre KlientInnen in ihren Mentalisierungsfähigkeiten zu stützen, da diese der Reflexion und Emotionsregulation dienen.
2.6.2 Die Entwicklung von Empathie
Empathie ist ein in der Sozialen Arbeit viel benutzter und z.T. recht strapazierter Begriff. Empathie ist „irgendwie wichtig“. Nicht selten bezeichnen sich Studierende der Sozialen Arbeit oder auch der Psychologie gern zu Beginn ihres Studiums als sehr sensibel bzw. empathisch und meinen damit, dass sie oft darunter leiden, wenn es anderen schlecht geht.
Was aber meint Empathie genau und wie entwickelt sich diese? Empathie beschreibt die Erfahrung, unmittelbar der Gefühlslage oder auch der Intention eines anderen teilhaftig zu werden und sie dadurch zu verstehen. Trotz dieser Teilhabe bleiben das wahrgenommene Gefühl oder Intention dem anderen zugehörig. Empathie ist also gleichbedeutend mit Einfühlung oder Mitempfindung, unterscheidet sich aber von Mitgefühl.
Empathie ist laut Bischof-Köhler (2011) generell zu unterscheiden von der Perspektivübernahme einerseits und dem Begriff der Gefühlsansteckung andererseits. Die Perspektivübernahme meint einen Erkenntnisakt, bei dem die subjektive Verfassung des anderen rein rational erschlossen wird, ohne dass eigenes Mitempfinden daran beteiligt sein muss.
Bei der Gefühlsansteckung ergreift die Stimmung des anderen dagegen vom Beobachter selbst Besitz und wird dabei zu seinem eigenen Gefühl, ohne dass ihm der andere als dessen Auslöser bewusst wird. Wenn also Menschen beschreiben, dass sie immer so sehr darunter leiden, wenn es anderen schlecht geht, beschreiben sie häufig das Phänomen der Gefühlsansteckung, was bedeutet, dass die bei anderen beobachteten Gefühle eigene Emotionen triggern, d.h. auslösen. Somit nehmen sie vor allem ihre eigenen Emotionen wahr und nicht die der anderen. Die Fähigkeit zur Differenzierung zwischen Gefühlsansteckung und Empathie ist eines der wesentlichen Lernziele in der Ausbildung von SozialarbeiterInnen.
Nach Feshbach (1978) gibt es zwei kognitive und eine emotionale Voraussetzung für Empathie: Die kognitiven Fähigkeiten bestehen darin, affektive Zustände anderer zu erkennen und zu benennen und Perspektivübernahme zu betreiben. Hinzukommen muss die emotionale Erlebnisfähigkeit, um das beobachtete Gefühl teilen zu können. Laut Hoffman (1982) geht die Ausformung von Empathie folgendermaßen vonstatten: Die globale Empathie, die mit Gefühlsansteckung gleichzusetzen ist, tritt bereits bei Neugeborenen auf, die sich vom Schreien der anderen Babys anstecken lassen. Es folgt eine Phase der egozentrischen Empathie, d.h., die Annahmen über die Gefühle des anderen sind ganz nach der Maßgabe der eigenen Bedürfnisse geprägt. So bringt ein dreijähriges Kind einem Kind, das gerade hingefallen ist, zum Trost das eigene Lieblingsspielzeug, weil es noch nicht in der Lage ist zu begreifen, dass das hingefallene Kind vielleicht ein ganz anderes Lieblingsspielzeug hat. Etwa mit vier Jahren tritt die Empathie für den anderen ein. Es entsteht ein Bewusstsein darüber, dass die Verfassung des anderen von der eigenen unabhängig ist. Als wesentliche Einflüsse auf die Empathieentwicklung gelten die familiäre Sozialisation, ein warmherziger und emotional beteiligter Erziehungsstil und die elterliche Feinfühligkeit, insbesondere eine prompte Reaktion auf kindliche Bedürfnisse und Anteilnahme an dessen Nöten und Verletzungen. Auch die Sensibilisierung von und für Schuldgefühle wirkt sich positiv auf die Empathieentwicklung aus (Bischof-Köhler 2011).
Die Fähigkeit zur Empathie, zur Perspektivübernahme und zur Mentalisierung basieren auf einer sicheren Bindung, die sich in den ersten Lebensjahren entwickelt. Alle diese drei Fähigkeiten sind als zentral für sozialarbeiterische Arbeit mit KlientInnen anzusehen, von denen viele in der Ausbildung genau dieser Kompetenzen benachteiligt sind.
2.7 Entwicklung der Jugend
„Wer außer mir wird später diese Briefe lesen? Wer außer mir wird mich trösten? Ich habe so oft Trost nötig. Ich bin so häufig nicht stark genug und versage öfter, als dass ich den Anforderungen genüge. Ich weiß es und versuche immer wieder, jeden Tag aufs Neue, mich zu bessern.
Ich werde unterschiedlich behandelt. Den einen Tag ist Anne so vernünftig und darf alles wissen und am nächsten höre ich wieder, dass Anne noch ein kleines dummes Schaf ist, das nichts weiß und nur glaubt, Wunder was aus Büchern gelernt zu haben! Ich bin nicht mehr das Baby und das Hätschelkind, das immer ausgelacht werden darf. Ich habe meine eigenen Ideale, Vorstellungen und Pläne, aber ich kann sie noch nicht in Worte fassen.“ (aus dem Tagebuch der Anne Frank, 30.10.1943, 143)
Anne Frank ist, als sie Obiges schreibt, 14 Jahre alt. Mit 15 zitiert sie selbst aus einem Buch, welches sie offenbar sehr beeindruckt hatte, dass die Jugend einsamer als das Alter sei. Das Jugendalter gilt als eine subjektiv oftmals sehr anstrengend empfundene Phase der Transformation, die u.a. eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körperbild und Körperidealen, mit der eigenen Identität, dem Umbau der sozialen Beziehungen und der Entwicklung eines partnerschaftlichen Bindungsverhaltens beinhaltet (Oerter/Dreher 2008).
„Wie jede Lebensphase ist Jugend nicht allein durch die körperliche Entwicklung definiert, sondern zugleich durch kulturelle, wirtschaftliche, soziale und ökologische Faktoren beeinflusst“(Hurrelmann/Quenzel 2016, 9).
Bereits Corey (1947) nennt fünf zentrale Entwicklungsaufgaben, die die Jugendlichen zu bewältigen haben. Dazu zählen die Annahme der körperlichen Veränderungen, die Loslösung von den Eltern, die Gestaltung von Peerbeziehungen und die Integration sexueller Bedürfnisse, die Entwicklung eines neuen Wertesystems und die Gewinnung einer sozialen sowie beruflichen Identität. Laut Piaget ist die Jugendphase in kognitiver Hinsicht vom Eintritt in das formal-operatorische Stadium gekennzeichnet. Nun sind beispielsweise hypothetische oder theoretische Herangehensweisen an Problemstellungen möglich.
In einem Elterngespräch klagt die Mutter einer vierzehnjährigen Jugendlichen über Folgendes: Marie will sich nichts mehr von mir sagen oder vorschreiben lassen, jeder kleinste Kommentar von mir wird als Einmischung oder Übergriff erlebt. Also lasse ich sie weitgehend in Ruhe und habe sie neulich auch nicht gefragt, ob sie mit mir Plätzchen backen will. Da war sie dann total enttäuscht und hat stundenlang auf ihrem Zimmer geheult.
Die Entwicklungsphase Adoleszenz fordert, wie in diesem Beispiel ersichtlich wird, von den Jugendlichen ebenso wie von ihrer nächsten Umgebung einen Umgang mit oftmals sehr rasch wechselnden und diametral entgegengesetzten Bedürfnissen nach vollkommener Zugehörigkeit sowie totaler Autonomie (Bräutigam 2011).
„Jugendliche sind Grenzgänger – gewissermaßen ‚borderliners‘ –, die sich im Niemandsland zwischen fremd verantworteten Leben der Kindheit und der eigenständigen Verantwortung des Erwachsenendaseins befinden und sich darin zurechtzufinden versuchen. Dieser Zustand des Übergangs verlangt es, so viel Ungewissheit und Konfliktgeladenheit auszuhalten und so viel Lernfähigkeit und Anpassungsvermögen zu erbringen, wie wohl in keinem anderen Stadium der menschlichen Entwicklung“ (Ludewig, 2001, 165).
Jugendliche sind wie bereits beschrieben in vielfacher Weise Transformationsprozessen ausgesetzt, die nicht selten zu Krisen führen. Zu diesen zählen in erster Linie Identitäts-, Selbstwert-, Beziehungs- und Autoritätskrisen (Resch 1999). Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf die im Körper verankerte Identität der/ des Jugendlichen gelegt werden (Lemma 2016). Daraus können internalisierende Formen der Problemverarbeitung, z.B. Depressionen oder Essstörungen, oder auch externalisierende Formen, wie Störungen des Sozialverhaltens oder übermäßiger Alkohol und Drogenkonsum, resultieren (Seiffge-Krenke 2015).
Nach Erik Erikson (1950/2005) ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität das entscheidende Merkmal der Adoleszenz. Dabei geht es darum, ein Gefühl für die Einheitlichkeit und Unverwechselbarkeit der eigenen Person über unterschiedliche Kontexte hinweg zu erlangen. James Marcia hat dieses Konzept weiterentwickelt und weiter differenziert (Marcia 1980, Mey 1999). Er unterscheidet zwischen einer diffusen Identität, einer erarbeiteten, einer kritischen und einer übernommenen Identität. In Bezug auf jugendliche KlientInnen könnte das heißen, dass Jugendliche mit einer diffusen Identität extrem unsicher über ihre Haltung und Einstellung zu Themen wie Arbeit, politische Einstellung etc. sind, während Jugendliche mit einer erarbeiteten Identität sich bereits einen eigenen Standpunkt erarbeitet haben. Jugendliche mit einer kritischen Identität erleben sich vor allem in Abgrenzung, während Jugendliche mit einer übernommenen Identität oftmals einfach die elterlichen Werte übernehmen.
Inzwischen besteht nahezu allgemeiner Konsens darüber, dass von einer verlängerten Adoleszenz, die durchaus bis in die späten 20er gehen kann, gesprochen werden darf (Seiffge-Krenke 2012) und dass die Auseinandersetzung mit Identitätsfragen nicht länger ein Vorrecht Jugendlicher ist. Dabei ist im sozialarbeiterischen Umgang mit Jugendlichen eine gute Reflexion der eigenen Adoleszenz notwendig, weil diese Phase oftmals mit besonderen Kränkungserfahrungen verbunden ist. Im Umgang mit Jugendlichen können diese Kränkungserfahrungen leicht getriggert werden und zu emotionalen, nicht reflektierten Reaktionen wie extrem autoritär/abgrenzendem oder eher anbiederndem/gleichmachendem Verhalten gegenüber den Jugendlichen führen.
2.8 Entwicklung des mittleren und höheren Erwachsenenalters
„Man altert langsam: Zuerst altert die Lust am Leben und an den Menschen, weißt du, allmählich wird alles so wirklich, du verstehst die Bedeutung von allem, alles wiederholt sich auf beängstigend langweilige Art […] Und mit einem mal beginnt die Seele zu altern: Denn der Körper mag alt geworden sein, die Seele aber hat noch ihre Sehnsüchte, ihre Erinnerungen, noch sucht sie, noch freut sie sich, noch sehnt sie sich nach Freude. Und wenn die Sehnsucht nach Freude vergeht, bleiben nur noch die Erinnerungen oder die Eitelkeit; und dann ist man wirklich alt, endgültig“ (Márai 1942, 199f.).
Die Entwicklung des mittleren Erwachsenenalters ist ein noch recht junges Forschungsgebiet (Freund/Nikitin 2012). In diesem Rahmen sollen daher zumindest einige Hinweise zu Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen des Erwachsenenalters beschrieben werden. Die Bestimmung dieser Lebensphase erfolgt in erster Linie über die Markierung wichtiger Entwicklungsthemen, wie z.B. berufliche und familiäre Entwicklung. Dabei ist insbesondere auf den Begriff der „Sandwich-Generation“ zu verweisen; dieser meint, dass Menschen in den mittleren Jahren in der Regel zwischen zwei Generationen stehen und oftmals vielfältige Verpflichtungen gegenüber ihren eigenen Kindern und ihren alternden Eltern haben.
„Dies kann zu einer zeitlichen und auch emotionalen Belastung führen: Die vorangehende Generation – also die eigenen Eltern, können in dieser Lebensphase pflegebedürftig werden und emotionale wie auch instrumentelle soziale Unterstützung benötigen, während die eigenen Kinder noch zu Hause wohnen und sowohl materielle wie auch zeitliche und emotionale Ressourcen in Anspruch nehmen“ (Freund/Nikitin 2012, 265).
Das höhere Erwachsenenalter bezeichnet in etwa den Altersbereich von 65 bis 80 Jahren. Menschen, die älter als 80 Jahre alt sind, werden auch als hochaltrig bezeichnet. In diesen Altersphasen müssen sich Menschen zwangsweise, neben dem Funktionserhalt, auch mit der Regulation von Verlusterfahrungen – z.B. Verlust der motorischen und manchmal auch kognitiven Beweglichkeit – auseinandersetzen. In Bezug auf die intellektuelle Entwicklung gilt ein sogenanntes Zweikomponentenmodell der intellektuellen Entwicklung (Baltes 2011, Baltes et al. 1999, Lindenberger/Staudinger 2012), die zwischen alterungsanfälligen und alterungsresistenten Fähigkeiten differenzieren. Zu den alterungsanfälligen Fähigkeiten zählen die Merkfähigkeit, das räumliche Vorstellungsvermögen sowie die Aufnahme und Verarbeitung neuer Informationen. Als alterungsresistent gelten interessanterweise das Kopfrechnen, verbale Fähigkeiten und die Verfügung von Wissensbeständen. Lindenberger und Staudinger (2012) weisen darauf hin, dass mit dem Alter der Bedarf an Kultur wächst; dabei meint Kultur:
„[…] alle psychischen, sozialen, materiellen und wissensbasierten Ressourcen, die die Menschheit im Laufe ihrer historischen Entwicklung produziert hat. Ein Buch fällt in diesem Sinne ebenso unter den Begriff Kultur wie die Krankenversicherung.“ (Lindenberger/Staudinger 2012, 285).
Um die in diesem Altersabschnitt anstehenden Entwicklungsaufgaben – die Häufigkeit nicht kontrollierbarer Verlustereignisse sowie eine Verkleinerung des Aktionsradius – einigermaßen gut bewältigen zu können, ist ein flexibler Umgang mit sich selbst gesteckten Zielen notwendig. Dieser fällt älteren Menschen aber nicht immer leicht. Oft brauchen sie hierbei eine freundliche und an ihren Stärken orientierte Unterstützung.
Bischof-Köhler, D. (2011): Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend. Bindung, Empathie, theory of mind. 1. Aufl. Kohlhammer, Stuttgart
Rass, E. (2012): Bindung und Sicherheit im Lebenslauf. Psychodynamische Entwicklungspsychologie. 2. Aufl. Klett Cotta, Stuttgart
Schneider, W., Lindenberger, U. (2012): Entwicklungspsychologie. 7. vollst. überarb. Aufl. Beltz, Weinheim
Wicki, W. (2015): Entwicklungspsychologie. 2. akt. u. erw. Aufl. Ernst Reinhardt, München/Basel
Was meint der Begriff Entwicklungsaufgaben? Diskutieren Sie, ob und welche Entwicklungsaufgaben bestimmten Lebensaltern zugerechnet werden können.
Benennen Sie zwei unterschiedliche Entwicklungsmodelle sowie die wesentlichen Merkmale moderner Entwicklungspsychologie.
Charakterisieren Sie die unterschiedlichen Bindungsstile und begründen Sie, ob, und wenn wodurch sich diese im Laufe eines Lebens verändern können.
Beschreiben Sie relevante Risiken für die frühkindliche Entwicklung rund um Schwangerschaft und Geburt, und diskutieren Sie, wie Sie als Fachkräfte der Sozialen Arbeit darauf einwirken können.
In welchen vier Stadien vollzieht sich die Entwicklung des Selbst?
Differenzieren Sie Gefühlsansteckung von Empathie.
Diskutieren Sie das Identitätskonzept von James E. Marcia, und überlegen Sie, ob und wie dieses den sozialarbeiterischen Umgang mit Jugendlichen sinnvoll beeinflussen kann.
Inwiefern können Fachkräfte der Sozialen Arbeit ältere Menschen angesichts eingetretener oder drohender Funktionsverluste unterstützen?