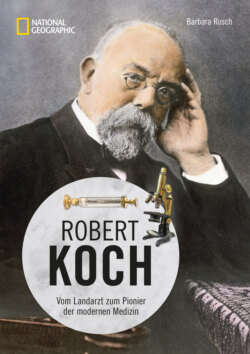Читать книгу Robert Koch - Barbara Rusch - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEin neuer Weg
STUDIUM UND ERSTE FORSCHUNGSERFOLGE
»Robert Koch hat erklärt, Philologie studieren zu wollen, während es bisher schien, als werde er sich dem Studium der Medizin oder der Mathematik und Naturwissenschaften widmen. Er hat eine Anlage, die ihm als Gymnasiallehrer allerdings zu statten kommen würde: die des mündlichen Vortrages, den ein sehr treues Gedächtnis unterstützt; wenigstens konnte man einzelne Leistungen dieser Art sehr gut nennen.«
So lautete das Urteil eines der Lehrer von Robert Koch. Allerdings wünschte man sich generell die Vorbereitung gerade zum philologischen Fach doch etwas vollständiger. Es würde nun darauf ankommen, ob Koch seine Kraft konzentriert und konsequent auf das vorgesteckte Ziel richte; die Fähigkeit ließe sich nicht leugnen. Philologie? Man meint die fragend hochgezogene Braue des Schuldirektors sehen zu können, der diese Beurteilung des Schülers Robert Koch vor dem mündlichen Abitur der Prüfungskommission vorlegte. Angesichts seiner Zensuren und seiner offensichtlichen Begabungen schien dieser Berufsplan überhaupt nicht zu ihm zu passen. Was war geschehen?
»Gerade bei meinen Brüdern habe ich die Überzeugung gewonnen, daß nicht die Schule, sondern das Leben den Kaufmann zu dem macht, was er sein soll.«
ROBERT KOCH
Was Roberts Berufsplanung anging, hing bei den Kochs wohl schon längere Zeit der Haussegen so schief, dass sogar der Familienrat in Hamburg bei Roberts Onkel Eduard Biewend tagte. Im April 1861 schrieb Mathilde Koch dazu besorgt an ihre Schwägerin: »Daß Hermann mit Robert kommt, geschieht in einer wichtigen Angelegenheit, daß Robert fest in der Wahl seines künftigen Berufes wird. Er spricht noch immer, daß er Kaufmann werden möchte, und das wünschen wir nicht und da soll nun Robert mit Euch und Wilhelm an Ort und Stelle in Hermanns Beisein Rücksprache nehmen.«
Offensichtlich war Robert drauf und dran, die Schule aufzugeben, war sie doch um einiges langweiliger als der Weg, den seine Brüder einschlagen wollten: Der älteste Bruder, Adolf, war damals schon Landwirt und plante unumstößlich nach Amerika auszuwandern. Wilhelm, nur ein Jahr älter als Robert, hatte die Schule vor dem Abitur verlassen, absolvierte in Hamburg eine kaufmännische Lehre und war ebenso wie Adolf fest zur Emigration entschlossen. Auch die beiden jüngeren Brüder Arnold und Albert zeigten wenig Ehrgeiz, in der Schule, im Harz oder auch nur in Europa zu bleiben. Die Koch-Brüder lagen mit ihren Plänen ganz im Trend der Zeit: Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Auswanderungswelle mit jährlich über 100 000 Emigranten bislang unerreichte Dimensionen angenommen. Und 90 Prozent der Auswanderer zogen in die Vereinigten Staaten, wo deutsche Immigranten eine der größten Gruppen bildeten.
Der etwa 21-jährige Robert Koch als Student in Göttingen. Der angehende Arzt braucht nun schon eine Brille gegen seine starke Kurzsichtigkeit.
Wie seine Brüder sehnte sich Robert danach, ferne Länder kennenzulernen, Abenteuer zu erleben. »Am liebsten«, schrieb sein Cousin Robert Biewend Jahre später, »hätte Robert Koch sich wohl ganz dem Studium der Naturwissenschaften gewidmet und bei seiner ausgesprochenen Neigung, fremde Länder zu bereisen und zu studieren, würde er wohl einen ausgezeichneten Forschungsreisenden abgegeben haben. Aber hierzu fehlten die Mittel.«
Auswanderung bedeutete Mitte des 19. Jahrhunderts meist einen Abschied für immer, und es ist leicht nachzuvollziehen, dass Hermann und Mathilde Koch nicht alle ihrer älteren Söhne ziehen lassen wollten. Sie legten ihr entschiedenes Veto ein. Offensichtlich schien ihnen Robert, der sich mit seinen vielfältigen Interessen nicht sehr zielstrebig zeigte, auch nicht besonders geeignet für diesen Schritt. Angesichts der finanziellen Lage der Familie und Roberts Begabungen kristallisierten sich im Lauf der Auseinandersetzungen zwei mögliche Berufswege heraus: entweder Arzt oder Gymnasiallehrer für naturwissenschaftliche Fächer. Der Lehrerberuf schien schneller und sicherer zu einer Stellung zu führen, die Robert ernähren würde, und wurde deshalb als »Plan A« behandelt. Vielleicht war es ja eine Trotzreaktion, dass Robert in der Schule als Wunschstudium »Philologie« angab: Wenn einem der Traumberuf verwehrt bleibt, dann ist die Alternative auch egal …
»Ich möchte einiger meiner damaligen Lehrer in Dankbarkeit gedenken, nämlich des Anatomen Henle, des Klinikers Hasse und besonders des Physiologen Meissner, welche den Sinn für wissenschaftliche Forschung in mir geweckt haben.«
ROBERT KOCH
Ostern 1862 verließ Robert Koch Clausthal zusammen mit seinem knapp vier Jahre jüngeren Bruder Arnold, der in Goslar eine kaufmännische Ausbildung begann. Der 18-jährige Robert schrieb sich am 23. April an der Georg-August-Universität in Göttingen in den Naturwissenschaften ein, noch verfolgte er das Berufsziel Lehrer. In einem Brief vom Mai 1862 berichtete er seinen Eltern von den von ihm belegten Fächern: »nämlich Trigonometrie und Stereometrie bei Ulrich, Physik bei Weber und Botanik bei Griesebach. Zusammen sind es 17 Stunden und doch habe ich für diese wenigen Kollegia so viel zu thun, daß mir nicht viel Zeit übrig bleibt. Selbst der Sonnabend und Sonntag sind durch botanische Excursionen in Anspruch genommen. Herr Professor Ulrich hat mir abgerathen, jetzt schon in das mathematisch-physikalische Seminar zu gehen und so habe ich es denn auch gelassen.«
Das Studium war teuer und die Finanzierung bereitete ihm Kopfzerbrechen. »… Trotzdem ich so viel als möglich zu sparen suche, verschwindet das Geld im Umsehen. Über 16 Thaler habe ich für Kollegien, 7 Thaler für die Immatrikulation bezahlen, dann theure Lehrbücher anschaffen und eine Menge Geld für Kleinigkeiten ausgeben müssen«, schrieb er im selben Brief. Der junge Student versuchte deshalb, so weit wie möglich an den Lebenskosten zu sparen.
Abgehärtet durch das raue Oberharzer Klima, fand er neben seiner finanziellen Lage auch das Wetter in Göttingen bemerkenswert unangenehm: »Hier ist es wie im August so heiß; kaum kann man noch des Mittags aus dem Hause gehen vor Hitze. Diese Hitze ist aber auch das Einzige, was mich plagt, sonst habe ich mich recht schnell an alles gewöhnt, als: schlechtes Wasser, ein Bett, in dem man vor vielen Decken verschwindet, Wirthshausessen und was sonst noch für Kleinigkeiten sind. Mein Essen habe ich so billig, als nur irgend möglich ist, eingerichtet. Morgens trinke ich Milch und esse ein Stück Brod dazu, Mittags den sogenannten Aschanti und zwar dreiviertel Portion von der schlechtesten Sorte und Abends ein Schmalzbrod. An Frühstück und Nachmittagsbrod darf ich nicht denken, weil sonst mein Brod nicht ausreicht.« Der »Aschanti« war ein billiges Mittagessen für die Studenten, das in einer schmuddeligen Garküche verkauft wurde. Es muss – vor allem im Sommer – so grauenhaft gewesen sein, dass es selbst der genügsame Robert Koch irgendwann nicht mehr ertragen konnte. Um sich keine Vergiftung zu holen, abonnierte er für sechs Taler im Monat Mittagessen in einem Wirtshaus.
»Leider können wir in Göttingen uns nicht rühmen, in der von ihm eingeschlagenen Richtung seine Lehrer gewesen zu sein.«
KARL EWALD HASSE
Größere Begeisterung als die Verpflegung löste das Studium aus. Nach einem Semester hatte Robert Koch die Lehrerausbildung aufgegeben und sich der Medizin zugewandt, die ihm erst als vernünftiger Kompromiss erschienen war und ihn nun immer mehr faszinierte. Chemie belegte er bei Friedrich Wöhler, der seit 1836 als Professor für Medizin, Chemie und Pharmazie an der Universität lehrte. Des Weiteren besuchte er Kurse bei dem bekannten pathologischen Anatom Wilhelm Krause und hörte Psychologie bei Hermann Lotze. Besonders tief beeindruckten ihn die Lehrveranstaltungen von Georg Meissner, Karl Ewald Hasse und Jakob Henle. Hasse, der sich in seinen Memoiren an Koch an einen »blassen, jungen Menschen von stillem, sinnig beobachtendem Wesen« erinnerte, der sich nicht »der Aufmerksamkeit des Lehrers entgegen« drängte, gab 1893 jedoch freimütig zu, dass weder er noch ein anderer Dozent Robert Koch damals zu seinen späteren innovativen Forschungen anleitete: »Ich selbst stand … der Lehre von der Bedeutung der Mikroorganismen noch ziemlich skeptisch gegenüber. Zwar hatte ich von Anfang meiner Lehrtätigkeit an die Forderung einer wohlbegründeten Ätiologie betont die Überzeugung ausgesprochen, daß die bekannten scharf gezeichneten Krankheiten, insbesondere die ansteckenden, nicht anders als durch ganz eigenartige (spezifische) Ursachen entstehen können. Es schien mir jedoch vorschnell, überall die Bakterien so ohne weiteres als das Wesentliche der Entstehung der Krankheiten hinzustellen.«
Der bedeutende Anatom und Pathologe Jakob Henle zählte zu Robert Kochs wichtigsten Lehrern an der Universität in Göttingen.
Es bleibt die Frage, welchen Einfluss Jakob Henle auf Robert Koch hatte. Henle hatte schon 1840 in seiner theoretischen Abhandlung »Von den Miasmen und Contagien und von den mismatisch-kontagiösen Krankheiten« die Idee lebender, parasitärer Erreger von Infektionskrankheiten behandelt. Sie gilt heute als Anfang der Erforschung bakterieller Infektionen, da darin bereits bestimmte Anforderungen an den Nachweis mikrobiologischer Krankheitserreger formuliert wurden. Diese mündeten letztendlich Jahrzehnte später in den sogenannten Henle-Koch-Postulaten, die heute jeder Anfänger in der Mikrobiologie lernen muss: Erreger müssen im erkrankten Organismus nachgewiesen und außerhalb des Organismus in Reinkultur gezüchtet werden können und in ihrer Reinkultur die Krankheit – im Tierexperiment – wieder erzeugen.
Siegel der 1737 gegründeten Georg-August-Universität in Göttingen, an der Robert Koch in den 1860er-Jahren Medizin studierte. Dort lernten und lehrten bislang über 40 Nobelpreisträger.
Jakob Henle war damit ein theoretischer Wegbereiter der Bakteriologie, doch galt der Verfasser des 1855 veröffentlichten berühmten »Handbuchs der systematischen Anatomie des Menschen« in den 1860er-Jahren vor allem als führender Anatom. Man kann heute nur mehr spekulieren – und tatsächlich wird auch in Fachkreisen gerne darüber gestritten –, inwieweit Henle seine Ideen von lebenden Krankheitserregern in der damaligen Zeit in der Lehre behandelte, ob und in welchem Maß dies Robert Koch, der ab 1864 bei Henle studierte, beeinflusste und warum er dies später nicht erwähnte. Ganz sicher lernte der junge Student bei Jakob Henle, dem Begründer der Histologie und mikroskopischen Anatomie, akribisch zu mikroskopieren und zu präparieren, streng wissenschaftlichrational vorzugehen und im Kleinsten nach den Ursachen zu forschen.
Das Medizinstudium machte Robert Koch Spaß, offensichtlich hatte er endlich eine Fachrichtung gefunden, die seinen Interessen und Begabungen gut entsprach. Er kniete sich in den Lehrstoff, und im Sommer 1864 konnte er seiner Familie in Clausthal schon erste Beweise seiner neu erlernten Kunst zeigen. »Robert ist seit etwa 4 Wochen hier und ist sehr vergnügt und lieb zu allen. Er ist unser Hausarzt und hat Mariens Fuß, den sie vertreten, und Ajaxs Hundefuß, der kläglich überfahren war, wieder kuriert und mich zu verschiedenen Malen, denn ich bin öfters etwas piepelig gewesen.«, schrieb Mathilde Koch erfreut über die Fortschritte ihres Sohnes in einem Brief.
»Auf der Universität habe ich keine unmittelbare Anregung für meine spätere wissenschaftliche Richtung empfangen, einfach aus dem Grunde, weil es damals noch keine Bakteriologie gab. «
ROBERT KOCH
Im darauffolgenden Jahr überraschte Robert seinen Vater, der zu seinem eigenen Missvergnügen zugenommen hatte, mit dem Ratschlag, weniger Kartoffeln zu essen. Dieser Tipp scheint bei den Kochs eher auf verblüfften Unglauben gestoßen zu sein, denn Robert Koch nahm später darauf Bezug – in einem Brief, in dem er zudem gute Neuigkeiten berichten konnte: »Obgleich du bei unserem letzten Zusammensein keine allzu hohe Meinung zu haben schienst, von meinem medicinischen Wissen im allgemeinen und von der merkwürdigen Eigenschaft der Kartoffeln, magere Leute fett zu machen, insbesonders, so ereignet es sich doch bisweilen, daß auch eine blinde Taube ein Korn findet, wie es mir jetzt z.B. ergangen ist. Nämlich bei der diesmaligen Preisvertheilung ist mir für meine Arbeit der Preis zuerkannt.«
Besagter Preis war 1864 von der Georg-August-Universität ausgeschrieben worden und beinhaltete folgende Aufgabenstellung: durch »eine genügende Reihe von Untersuchungen festzustellen, ob und in welcher Verbreitung die Nerven des Uterus Ganglien enthalten«. Robert Koch hatte sich zur Teilnahme entschlossen, und vielleicht schürte dabei auch eine persönliche Konkurrenz seinen Ehrgeiz: Adolf Polle, mit dem er zusammen in Clausthal sein Abitur abgelegt hatte, nahm die gestellte Aufgabe ebenfalls ziemlich zielstrebig in Angriff. Während Polle seine Wettbewerbsarbeit vor allem am Institut des Anatomen Wilhelm Krause ausführte, war Koch wahrscheinlich hauptsächlich im Institut von Jakob Henle tätig.
Im Juni 1865 erwarteten beide bei der jährlichen Universitätsfeier mit gespannter Erwartung die Verkündigung der Preisträger – und beide konnten nach einer quälend langen und fantastisch langweiligen Preisrede jubeln: Sowohl Adolf Polle als auch Robert Koch hatten den ersten Preis gewonnen, und die Arbeiten der beiden Studenten wurden von der Universität als Preisschriften veröffentlicht. Kochs Abhandlung, »Über das Vorkommen von Ganglienzellen an den Nerven des Uterus« trug das Motto »Numquam otiosus«, »Niemals müßig«, und die Widmung: »Dem geliebten Vater widmet als Ausdruck seiner Zuneigung und Dankbarkeit diese erste Frucht seiner Studien der Verfasser.« Roberts Eltern waren sehr stolz auf den Erfolg ihres Sohnes. »Robert hat uns wieder eine große Freude gemacht«, schrieb Hermann Koch in einem Brief an seinen ältesten Sohn Adolf. »In unserer Freude haben Mama und ich Robert in Göttingen besucht und einen recht vergnügten Tag mit ihm verlebt.«
»Auf meinen Wanderungen durch das medizinische Gebiet stieß ich auf Strecken, wo das Gold noch auf dem Wege lag.«
ROBERT KOCH
Die Begeisterung war umso größer, da es offensichtlich seit Jahresbeginn wieder Auseinandersetzungen um die berufliche Karriere Roberts gegeben hatte. Bereits Anfang 1865 hatte er am Pathologischen Institut eine Assistentenstelle übertragen bekommen – eine Auszeichnung für einen Studenten, der erst im sechsten Semester studierte –, aber wie immer warf die Finanzierung Fragen und Sorgen auf. Hermann Koch freute sich über Roberts wissenschaftlichen Erfolg, schrieb jedoch im Februar 1865 an seinen Sohn Adolf, der damals schon nach Amerika ausgewandert war: »Es ist dieses ein Beweis dafür, daß Robert sich besonders ausgezeichnet hat … Diese Ehre wird freilich viel Geld kosten, da er sich hat verpflichten müssen, noch 3 Jahre in Göttingen zu bleiben, und nur 40 Thaler Jahresgehalt bekömmt. Er wird aber in dieser Stelle viel lernen, kann die akademische Karriere machen oder erhält, wenn er in die Praxis geht, gleich eine gute Stelle.« Offenbar gingen einige besorgte Briefe hin und her, in einem schrieb Robert Koch noch im Februar an seinen Vater: »Zugleich kann ich Dir die erfreuliche Mittheilung melden, daß ich die Stelle vor 8 Tagen schon definitiv … angetreten habe. Bis Ostern habe ich nur das Sektions-Protokoll zu führen, was mich an meinen Studien durchaus nicht behindert. Im nächsten Semester werde ich dann freilich mehr Beschäftigung davon haben, aber doch auch solche, die mir für meine praktische Ausbildung nützlich ist, wie ich denn überhaupt meine ganze Richtung stets darauf richten werde, später als praktischer Arzt zu fungiren.«
Die Unsicherheit über Roberts Berufsweg war trotz aller Erfolge und des gewonnenen Preises nicht kleiner geworden. »Er sowohl wie Papa sind nur noch nicht entschlossen, ob Robert praktischer Arzt werden oder sich der akademischen Laufbahn widmen soll. Der Geldpunkt ist noch schwer zu überlegen …«, schrieb Mathilde Koch im Sommer 1865 über die Auseinandersetzungen in der Familie. Zugleich freute sie sich, dass Robert nun langsam erwachsen wurde, ihr zu Hause in den Sommerferien »Trost, Stütze und lieber Gesellschafter« und »zum ratgebenden Freunde herangewachsen« war.
In seinem Studium hielt Robert Koch weiter mehrere Optionen offen: Er belegte Seminare, die ihn in der ärztlichen Praxis unterrichteten, behielt aber auch ein Standbein in der Forschung. Noch 1865 wechselte er als Assistent zu Georg Meissner, wo er im wahrsten Sinne des Wortes mit Leib und Seele Wissenschaft betrieb. Um herauszufinden, wie Bernsteinsäure im menschlichen Körper entsteht, nahm er im klassischen Selbstversuch aufgelösten apfelsauren Kalk, Asparagin (in Form von Unmengen von Spargel) und »fünf Tage lang Nachmittags ein halbes Pfund Butter mit etwas Brot« zu sich. Nach dieser Fettorgie wurde ihm verständlicherweise entsetzlich übel, und er musste den Versuch »wegen sich einstellender Verdauungsstörungen« aufgeben. Bernsteinsäure ist ein Zwischenprodukt des Fett- und Kohlenhydratstoffwechsels. Durch seine Versuche konnte Robert Koch beweisen, dass sie zum einen unter solchen Ernährungsbedingungen in großen Mengen im Urin auftritt und dass sie im Magen-Darm-Kanal entsteht. Seine Forschungsarbeit wurde noch 1865 in der »Zeitschrift für rationelle Medizin« veröffentlicht und bei seinem Abschluss als Doktorarbeit anerkannt.
Mit einem besseren finanziellen Hintergrund hätte Robert Koch schon damals eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen können. Da daran jedoch nicht zu denken war, genoss er erst einmal den Sommer. Er fuhr im September zur Tagung der »Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte« nach Hannover und unternahm mit seinem Vater eine Erholungsreise nach Hamburg, Lübeck und Helgoland. In dieser Zeit führte er viele Gespräche mit seinem Vater und seinem Onkel Eduard Biewend über seinen weiteren Berufsweg. Bei dieser schwierigen Entscheidung gab letztendlich wieder einmal das finanziell Machbare den Ausschlag – und vielleicht auch die Liebe, von der seine Familie zu jener Zeit noch nichts wusste.
Ab dem Wintersemester 1865 bereitete sich Robert Koch an der Universität auf den Abschluss als praktischer Arzt vor. Er schlug sogar ein Angebot seines Onkels aus, der ihn bei einer Forschungsarbeit über Trichinen finanziell unterstützt hätte. Da der Entschluss jetzt gefasst war, ging alles sehr schnell: Fast Hals über Kopf meldete er sich am 3. Januar 1866 zur Promotion an, am 13. Januar bestand er die mündliche Prüfung, am 16. Januar hielt er seinen obligatorischen lateinischen Vortrag und schwor die Eidesformel der Ärzte. Noch am selben Tag konnte er mit dem Doktordiplom in der Hand die Universität Göttingen verlassen. Die erste große Hürde auf seinem Berufsweg war geschafft.
WEGBEREITER DER MEDIZIN – ROBERT KOCHS LEHRER IN GÖTTINGEN
Robert Koch erhielt an der Georg-August-Universität eine für die damalige Zeit sehr moderne Ausbildung, die ihn für die Medizin und die wissenschaftliche Forschung begeistern konnte. Aus seinen Studienbüchern geht hervor, dass er in einigen Fächern bei den Größen der jeweiligen Disziplinen hörte.
So belegte er Kurse bei Friedrich Wöhler. Der Chemiker hatte 1824 durch die Synthese von Oxalsäure und 1828 von Harnstoff experimentell bewiesen, dass organische Stoffe aus anorganischen künstlich erzeugt werden konnten. Mit dieser Entdeckung widerlegte er die Vorstellungen des Vitalismus, die Anfang des 19. Jahrhunderts noch vorherrschten. Dem Vitalismus zufolge war die Bildung von Materie in Lebewesen – also von organischen Stoffen – nur unter Einwirkung einer transzendenten Lebenskraft möglich, die vis vitalis genannt wurde. Wöhlers Arbeiten waren wegweisend in der anorganischen Chemie und trugen dazu bei, die Medizin auf eine naturwissenschaftliche Basis zu stellen.
Psychologie hörte Robert Koch bei Hermann Lotze, der seit 1844 als Professor für Medizin und Philosophie in Göttingen lehrte. Lotze stellte sich vehement gegen die Idee der vis vitalis und zählte zu den einflussreichsten Akademikern jener Jahre. Seine Werke behandelten naturwissenschaftliche, philosophische und metaphysische Themen. Lotzes psychologische Studien zählten zu den Pionierarbeiten der Disziplin.
Der Physiologe Georg Meissner hatte den Plexus submucosus entdeckt – einen Teil des Nervensystems, das die Sekretion der Drüsen von Magen und Darm steuert. Zu seinen Entdeckungen zählten auch die nach ihm benannten Meissner-Tastkörperchen in der Haut, die auf Druck reagieren.
Auch Karl Ewald Hasse, Professor der Pathologie und Leiter der Medizinischen Klinik in Göttingen, hatte sich mit seinen Arbeiten über Nerven, Herz- und Lungenkrankheiten einen hervorragenden Ruf erworben.
Jakob Henle schließlich gilt heute als Wegbereiter der Bakteriologie sowie als Begründer der Histologie und mikroskopischen Anatomie. Er formulierte bereits 1841 in seiner Allgemeinen Anatomie die Grundlagen der naturwissenschaftlichen Medizin: »Die Physiologie der Gewebe ist die Grundlage der allgemeinen oder rationellen Pathologie, welche die Krankheitsprozesse und Symptome als gesetzmäßige Reaktionen einer mit eigenthümlichen und unveräußerlichen Kräften begabten organischen Materie gegen abnorme äußere Einwirkungen zu begreifen sucht.«